Abmahnfallen: Die Klassiker

Wir stellen übersichtlich die häufigsten Abmahnfallen im Bereich des Wettbewerbsrechts dar. Zudem zeigen wir Wege auf, wie Fehler und damit kostspielige Abmahnungen in diesem Bereich vermieden werden können.
Inhaltsverzeichnis
- Amazon
- 1. Unzulässig-I: Neuanlage einer Artikeldetailseite für bereits vorhandenes Produkt
- 2. Unzulässig-II: Anhängen an bestehenden Markenartikel
- 3. Augen auf bei Amazon-Rechtstexten: Amazon fordert Entfernung von Impressums-Pflichtangaben
- 4. Amazon löscht Angaben zu den Versandkosten – Handlungsbedarf für Amazon-Händler
- 5. Ändern einer fremden Amazon-Artikelbeschreibung kann unzulässig sein!
- 6. Amazon-Seller haftet für die automatische Zuordnung von Produktbildern durch Amazon
- 7. Amazon zeigt bei fehlendem Grundpreis einige Produktkategorien nicht mehr an!
- 8. Neue Bestellbestätigungen genügen nicht den gesetzlichen Anforderungen
- Anzeigepflichten
- 1. Bei Batterien/ Akkus
- Bestellabwicklung
- 1. Pflicht zur Übersendung der AGB & Kundeninfo, Widerrufsbelehrung & Widerrufsformular
- Datenschutz
- 1. Fehlende Datenschutzerklärung
- 2. Online-Kontaktformular - Einwilligung erforderlich?
- 3. SSL-Verschlüsselung bei Webformularen (z.B. Kontaktformular) und Check-Out Pflicht
- 4. Versand von Newslettern
- 5. Unzulässige Weitergabe von Kunden-E-Mailadressen an Paketdienstleister
- 6. Cookie-Hinweis bzw. Cookie-Zustimmung erforderlich?
- 7. Versendung von Aufforderungen zur Bewertungsabgabe (Feedbackanfrage)
- 8. Anmeldung zum E-Mail-Newsletter
- 9. Pflicht zur Erteilung eines Cookie-Hinweises für ausgewählte Google-Services
- 10. Einsatz von Google-Analytics muss anonymisiert und datenschutzrechtlich geregelt sein
- 11. Verschlüsselung des Online-Shops angeraten
- eBay
- 1. Achtung bei der Angabe des Grundpreises auf eBay
- 2. Problem der mangelnden Gesamtpreisangabe bei Multirabatt-Artikeln auf eBay
- 3. Widersprüchliche Angaben zur Widerrufsfrist
- 4. Widersprüchliche Angaben zur Rücksendekostentragung
- 5. Kein transparentes Impressum bei „eBay-Shops“
- 6. Problematische Werbung für „ebay plus“ und „eBay-Garantie“
- 7. Erfüllung der Online-Kennzeichnungspflichten auf eBay
- 8. Verkauf von mangelhafter Ware und Gewährleistungsverkürzung auf eBay
- 9. Was eBay-Händler bei dem Verkauf differenzbesteuerter Ware beachten müssen
- E-Mail Signaturen
- Etsy
- Geoblocking
- Google-Analytics
- Google-Shopping
- 1. Falsche Versandkostenangaben bei Google Shopping
- Herstellergarantie
- 1. Fehlende Information über bestehende Herstellergarantie
- Impressum
- 1. Verwendung von Sonderrufnummern für Kundenservicehotlines abmahnbar
- 2. Fehlen bestimmter Pflichtangaben: im Impressum
- 3. Impressum: Pflicht zur Benennung des redaktionell Verantwortlichen?
- 4. Angabe der WEEE-Registrierungsnummer im Impressum: verpflichtend für Hersteller von Elektrogeräten
- 5. Facebook: Problem mit Impressumsdarstellung
- 6.Keine Platzhalter im Impressum verwenden!
- Energie-Kennzeichnung
- 1. Seit 01.08.2017: Verschärfung der Energieverbrauchskennzeichnung in der Werbung
- 2. Aktuell abgemahnt: Fehlende Angaben zum Spektrum bei energieverbrauchsrelevanten Produkten
- Gerichtsstandsvereinbarungen
- Informationspflichten
- 1. Auslaufmodelle: Pflicht zum Hinweis
- 2. Bestellvorgang: vor Abschluss wesentliche Produktmerkmale anzeigen
- 3. Jugendschutzbeauftragten bei jugendgefährdenden Inhalten nennen
- 4. Elektrogeräte: Neue Informationspflichten für Vertreiber seit dem 25.07.2016
- Jugendschutz
- 1. Multimediadatenträger (wie z.B. Computer- und Konsolenspiele, DVD/ Blu-Ray, etc.)
- Kennzeichnungspflichten
- 1. Verkäufer haften für fehlende physische Kennzeichnung von Verbraucherprodukten durch den Hersteller
- Kostenpflichtige Rufnummern
- Newsletter
- 1. Newsletteranmeldung: Achtung bei der Formulierung der Einwilligungserklärung
- 2. Double-Opt-In-Bestätigungsmail ohne werblichen Inhalt ist trotzdem unzumutbare Belästigung, wenn..
- Preisangabenverordnung:
- 1. Der richtige Umgang mit der Angabe "inkl. MwSt." bei Kleinunternehmern und bei Differenzbesteuerung
- 2. Was gilt bei Kleinunternehmern?
- 3. Was gilt bei der Differenzbesteuerung?
- 4. Wie setzen Sie das konkret im eigenen Online-Shop, auf eBay & Amazon um?
- 5. Grundpreise: Häufig Gegenstand von Abmahnungen
- Pflicht zur Grundpreisangabe
- Wahrnehmung des Gesamt- und Grundpreises auf einen Blick
- Vorsicht bei Grundpreisangabe mit Bezugnahme auf die Mengeneinheit 100g / 100ml
- Sonderfall: Grundpreise müssen bei eBay in Artikelüberschrift dargestellt werden
- Grundpreise: Sonderfall Preissuchmaschine
- Grundpreise: Problematik Warensets
- Grundpreise: Abtropfgewicht bei festen Lebensmittel
- Grundpreise: Besonderheit bei Garne und Wolle
- Grundpreise: Besonderheit bei Parkett, Fliesen, Beläge
- Achtung bei Suchergebnissen grundpreispflichtiger Artikel
- Grundpreise: Besonderheiten bei speziellen Lebensmitteln
- Variantenartikel auf eBay: Achtung bei der Grundpreisangabe
- Preisaktionen
- 1. Verlängerung einer zeitlich befristeten Preisrabattaktion ist unzulässig
- Produktbilder
- 1. Produktbilder spiegeln Lieferumfang des angebotenen Produkts wieder
- Registrierungspflichten
- 1. Elektrogeräte
- Verhaltenskodex
- Verpackungsgesetz
- 1. Abmahnungen wegen fehlender Registrierung nach dem Verpackungsgesetz
- 2. Hinweispflichten ("EINWEG", "MEHRWEG") bei pfandpflichtigen Einweg - und Mehrweggetränkeverpackungen
- Versand / Versandkosten
- 1. Versandkostenangaben für Ausland
- 2. Versand ins Nicht-EU-Ausland: Hinweis auf anfallende Zölle und Steuern
- 3. Einmalige Falschlieferung von Waren kann abmahnbar sein
- 4. Ausverkaufte Ware als „lieferbar“ anbieten
- 5. Werbung mit "versandkostenfrei"
- 6. Werbung mit "versichertem Versand"
- Werbung
- 1. Streichpreise (Preisgegenüberstellung)
- 2. Prüf- und Qualitätszeichen und Prüfsiegeln: Prüfkriterien angeben
- 3. Nutzung einer Weiterempfehlungsfunktion („Tell-a-Friend“)
- 4. Werbung mit Testergebnissen
- 5. Werbung mit einer Allein- oder Spitzengruppenstellung
- 6. Verlängerung einer zeitlich befristeten Preisrabattaktion ist unzulässig
- 7. Finanzierungen
- 8. Werbung in "No Reply" Bestätigungsmails
- 9. Werbung mit nicht existierender, veralteter oder falscher UVP
- 10. Achtung bei der Versendung von Bewertungsanfragen (sog. Feedbackanfragen)
- 11. Werbung mit Auszeichnungen
- 12. Kundenzufriedenheitsanfrage via Rechnungsmail: nur mit Einwilligung
- 13. Werbung in E-Mail-Signatur ist unzulässig
- 14. Kaufabbruch-E-Mails kein zulässiges Werbemittel
- Widerrufsbelehrung
- 1. Nicht korrekt formatierte Widerrufsbelehrung bzw. Muster-Widerrufsformular
- 2. Fehlende Telefonnummer in Widerrufsbelehrung
- 3. In das Muster-Widerrufsformular gehört keine Telefonnummer
- 4. Bei eBay: Widersprüchliche Angaben zu Widerrufsfrist
- Zahlung / Zahlungsarten
- 1. Seit dem 13. Januar 2018 gilt: Aufschläge für Überweisungen, Lastschriften, Visa und Mastercard verboten
- 2. Betrifft Online-Shops: Zumindest ein zumutbares unentgeltliches Zahlungsmittel ist anzubieten
Amazon
1. Unzulässig-I: Neuanlage einer Artikeldetailseite für bereits vorhandenes Produkt
Das OLG Hamm hat entschieden (Urteil vom 12.01.2017 Az. 4 U 80/16) , dass die Neuanlage einer weiteren Artikeldetailseite für ein bereits über eine Artikeldetailseite auf der Internetplattform Amazon angebotenes Produkt unzulässig sei, da der unzutreffende und irreführende Eindruck erweckt werde, die Neuanlage sei der einzige Anbieter für dieses Produkt. Die Nutzer der Internetplattform Amazon, zumindest aber ein nicht unerheblicher Teil dieser Nutzer sollen nach Meinung des OLG Hamm nämlich davon ausgehen, dass Amazon für jedes Produkt nur eine (!) Artikeldetailseite bereit hält und dementsprechend alle Anbieter dieses Produktes über die Artikeldetailseite aufzufinden sind.
Hiervon sind nicht nur Amazon-Händler betroffen, die selbst eine solche neue Artikeldetailseite angelegt haben (obwohl eine solche bereits existiert), sondern auch alle Amazon-Händler, die sich an eine derartige (unzulässige) Neuanlage angehängt haben!
Was Amazon-Händler tun sollten: Wir raten Amazon-Händlern von der Neuanlage einer Artikeldetailseite für ein bereits über eine Artikeldetailseite auf der Plattform Amazon angebotenes Produkt dringend ab. Wenn Händler sich an bestehende Angebote angehängt haben oder erstmalig anhängen möchten, muss kontrolliert werden, ob es zu dem Produkt eventuell mehrere Artikelanlagen gibt und - falls dies der Fall sein sollte - sich an die älteste Artikelanlage anhängen.
2. Unzulässig-II: Anhängen an bestehenden Markenartikel
Wie vorstehend bereits erwähnt ist das Anhängen an bestehende Amazon-Artikel mit Vorsicht zu genießen. Zwar erlaubt das Prinzip-Amazon, bei dem grds. mehrere Händler 1 Artikel anbieten sollen und dürfen, das Anhängen an Bestandsartikel - aber das in Grenzen. Eine Grenze ist das Anhängen an Markenartikel bzw. an Artikel, die den Händlernamen enthalten (meist in der Unterüberschrift unter "von").
Exkurs Markenrecht: Wer unter einem eingetragenen Markenzeichen Ware anbietet, muss sicherstellen, dass er auch die original Markenware liefern kann. In den Anhänge-Fällen ist das oft nicht gegeben. Denn hier hängt sich meist ein Anbieter an, der möglicherweise einen ähnlichen oder optisch sogar fast identischen Artikel liefern kann, aber eben nicht das Markenprodukt. Dies wird dann als klassischer Markenverstoß gewertet und entsprechend den hohen Gegenstandswerten im Markenrecht teuer abgemahnt.
Was in der Abmahn-Praxis oft über das Markenrecht gelöst wird, hat aber auch wettbewerbsrechtliche Relevanz. Teilweise wird aus verschiedenen Gründen in der Abmahnung in solchen Konstellationen nicht auf das Markenrecht zurückgegriffen (etwa weil (noch) keine eingetragene Marke existiert), sondern auf das Wettbewerbsrecht. Begründet wird dies mit einer Irreführung, da über die Herkunft des angebotenen Produktes getäuscht wird, was einen Wettbewerbsverstoß darstellt. Sprich: Angeboten wird ein Artikel der Marke X, der anhängende Mitbewerber liefert aber dann ein Produkt der Marke Y - gleiches gilt für die Täuschung über den Hersteller/Händler. Sofern dies im Rahmen einer Testbestellung belegt werden kann, ist das in der Tat wettbewerbsrechtlich bedenklich, auch wenn also keine eingetragene Marke besteht.
Tipp: Amazon-Händler sollten genau prüfen, welche Angaben beim "von"-Hinweis der Artikelunterschrift bei Amazon angegeben werden und ob es sich insgesamt um einen Markenartikel handelt, an den sie sich anhängen wollen. Steht in diesem von-Hinweis der Name eines anderen Händlers oder dort oder in den Artikelmerkmalen eine Marke, läuft der sich anhängende Händler Gefahr, wegen der Täuschung über die betriebliche Herkunft der angebotenen Ware wettbewerbsrechtlich abgemahnt zu werden.
Einen guten Überblick über die gängigsten Abmahnfallen auf Amazon finden Sie in diesem Beitrag.
3. Augen auf bei Amazon-Rechtstexten: Amazon fordert Entfernung von Impressums-Pflichtangaben
Mehrere Mandanten der IT-Recht Kanzlei berichten, dass Amazon in deren Rechtstexte eingreift und wichtige Pflichtangaben entfernt bzw. nachdrücklich zu Entfernung von Pflichtangaben im Impressum auffordert.
Insbesondere an der Angabe von Telefonnummer und Email-Adresse im Impressum des Händlers scheint sich Amazon zu stören und fordert von manchem Händler, diese Angaben aus dem Impressum zu streichen. Folgt der Händler dieser Empfehlung, tappt er in eine Abmahnfalle.
Ferner stört sich Amazon zum Teil wohl an der Angabe der Email-Adresse des Händlers in der Widerrufsbelehrung. Hier wird sogar berichtet, dass Amazon die per Email an den Kunden verschickte Widerrufsbelehrung manipuliert hat und die Angabe der Email-Adresse dort durch die Angabe „[E-Mail-Adresse entfernt]“ ersetze. Auch liefert eine Google-Suche entsprechend falsche Widerrufsbelehrungen bei Amazon Marketplace, so dass möglicherweise auch die online abrufbare Widerrufsbelehrung von Marketplace-Händlern davon betroffen sein könnte. Auch eine Widerrufsbelehrung ohne Email-Adresse wäre abmahnbar.
Sollte Amazon von Ihnen fordern, Angaben aus dem Impressum bzw. der Widerrufsbelehrung zu entfernen (insbesondere Telefonnummer oder Email-Adresse), weisen Sie Amazon bitte nachdrücklich darauf hin, dass es sich dabei um gesetzlich geforderte Pflichtangaben handelt, deren Fehlen jederzeit abgemahnt werden kann und widersprechen der Forderung. Ferner sollten Sie Ihre online vorgehaltene und per Email an den Kunden versendete Widerrufsbelehrung bei Amazon regelmäßig überprüfen, ob diese entsprechend manipuliert worden ist.
Weitere Hintergründe lesen Sie hier:
4. Amazon löscht Angaben zu den Versandkosten – Handlungsbedarf für Amazon-Händler
Der nachfolgende Hinweis richtet sich an alle Händler, die bei Amazon verkaufen. Es werden derzeit bei vielen Verkäufern mit Eigenversand (FBM) hinterlegte Versandkostenangaben auf der Verkäuferprofilseite unter der Rubrik „Versand“ seitens Amazon entfernt. Anstelle der Angaben des jeweiligen Verkäufers zu anfallenden Versandkosten findet sich dort dann nur noch der folgende Hinweistext seitens Amazon:
„Die Versandkosten hängen von der ausgewählten Versandart sowie von Gewicht und Größe der Artikel ab.
So ermitteln Sie die anwendbaren Versandkosten für Artikel in Ihrem Einkaufswagen:
1. Wählen Sie Zur Kasse gehen aus.
2. Wählen Sie Ihre Lieferadresse aus oder fügen Sie sie hinzu.
3. Wählen Sie eine Versanddauer aus und klicken Sie auf Weiter.
4. Wählen Sie eine Zahlungsweise aus und klicken Sie auf Weiter.
Die Gesamtkosten für Versand und Bearbeitung werden unter Bestellungsübersicht angezeigt.“
Dieser Hinweis ist nach unserer Auffassung nicht ausreichend für eine korrekte Information über die anfallenden Versandkosten, so dass eine konkrete Abmahngefahr besteht, wenn von Ihnen bei einem Eigenversand der Waren keine Versandkosten mehr unter der Rubrik „Versand“ hinterlegt sind.
Hintergrund ist, dass über die Höhe der anfallenden Versandkosten bereits bei Einleitung des Bestellvorgangs (= Einlegen der Ware in den virtuellen Warenkorb) informiert werden muss. Die Information seitens Amazon, die Höhe der Versandkosten sei im Bestellablauf / Checkout ersichtlich, wird den gesetzlichen Erfordernissen damit nicht gerecht.
Wir fordern daher alle Amazon-Händler, die bei Amazon verkaufen auf, unverzüglich zu prüfen, ob die selbst hinterlegten Versandkostenangaben seitens Amazon gelöscht wurden und – falls auf der Verkäuferprofilseite unter „Versand“ keine konkret anfallenden Versandkosten (mehr) dargestellt werden - die Information zu den Versandkosten gemäß unserer Handlungsanleitung (wieder) einzufügen. Da die „Löschung“ sukzessive zu erfolgen scheint, schauen Sie bitte auch in den kommenden Tagen und Wochen nach, ob die Informationen zu den Versandkosten noch vorhanden sind.
Die entsprechende Handlungsanleitung finden Sie gerne hier.
5. Ändern einer fremden Amazon-Artikelbeschreibung kann unzulässig sein!
Die Tatsache, dass autorisierte Händler auf Amazon theoretisch jede beliebige Artikelbeschreibung ändern können, dürfte Amazon-Händlern bekannt sein. Das LG Düsseldorf hat entschieden, dass ein solches Abändern von Produkt- oder Markenzeichen in fremden Artikelbeschreibungen auf Amazon sowohl marken- als auch wettbewerbsrechtliche Unterlassungsansprüche auslösen kann.
6. Amazon-Seller haftet für die automatische Zuordnung von Produktbildern durch Amazon
Neben
- fehlenden bzw. falschen Angaben in der Artikelbeschreibung (wie etwa fehlende Grundpreise oder unzureichende Garantiewerbung), weil dritte Verkäufer bzw. Amazon unbemerkt die Artikelbeschreibung anpassen können,
- dem „Anhängeproblem“ an fremde Marken und Listings,
- dem unlauteren „Mehrfachlisting“
noch eine weitere Baustelle für die Amazon-Seller:
Wer in Lieferumfang bzw. Beschaffenheit vom „Standard“ abweichende Waren bei Amazon anbietet, läuft nicht selten Gefahr, dass Amazon dazu unpassende Artikelbilder ausspielt. Dies stellt in der Regel eine Irreführung des Kunden dar. In der Folge drohen unzufriedene Kunden und auch Abmahnungen durch Mitbewerber.
Dieses Problem stellt ferner eine weitere Möglichkeit, „unliebsame“ Anhänger vom Listing zu bekommen.
Hintergrundinformationen hierzu siehe hier.
7. Amazon zeigt bei fehlendem Grundpreis einige Produktkategorien nicht mehr an!
Auch auf Amazon müssen nach Gewicht, Volumen, Länge oder Fläche verkaufte Produkte grundsätzlich sowohl mit dem Gesamtpreis als auch dem Grundpreis gekennzeichnet werden. Marketplace-Händler, die gegen die Vorgaben der Preisangabenverordnung verstoßen, setzen sich einer Abmahngefahr aus. Nun zeigt Amazon seit dem 31.03.2021 Produkte gewisser Waren-Kategorien überhaupt erst nicht mehr an, sofern eine Grundpreisangabe fehlt.
Mehr zu diesem Thema siehe hier.
8. Neue Bestellbestätigungen genügen nicht den gesetzlichen Anforderungen
Online-Händler müssen ihren Kunden nach einer Bestellung im Fernabsatz eine Bestätigung des Vertrags, in der der Vertragsinhalt wiedergegeben ist auf einem dauerhaften Datenträger zur Verfügung zu stellen. Dies gilt freilich auch für Händler, die ihre Waren über den Marktplatz von Amazon verkaufen. Nunmehr hat Amazon den Inhalt seiner automatisch per E-Mail versendeten Bestellbestätigungen dergestalt geändert, dass der konkrete Vertragsinhalt dort nicht mehr angezeigt wird. Dies betrifft auch solche E-Mails, die Amazon im Auftrag von Marktplatz-Händlern an deren Kunden versendet.
Die rechtlichen Auswirkungen beleuchten wir in diesem Beitrag.
Anzeigepflichten
1. Bei Batterien/ Akkus
Abmahnfalle:
Händler verkaufen aus dem Ausland importierte Batterien (oder Produkte, die Batterien enthalten), ohne dies zuvor beim Umweltbundesamt anzuzeigen.
Rechtslage:
Werden Batterien und Akkumulatoren (auch in Geräten enthalten) in Deutschland erstmals in den Verkehr gebracht, muss dies dem Umweltbundesamt zuvor entsprechend angezeigt werden. Wer dieser Anzeigepflicht nicht nachkommt, handelt wettbewerbs- und ordnungswidrig.
Wie kommt man dieser Anzeigepflicht nach? Umfangreiche Informationen zum Thema "Anzeige beim Batterie-Melderegister" erhalten Sie hier.
Während das UBA in der Vergangenheit allem Anschein nach nur dann gegen „Trittbrettfahrer“ vorgegangen ist, die von der Konkurrenz dort „angeschwärzt“ worden sind, zeichnet sich in den letzten Monaten ab, dass man hier nicht mehr nur auf eine Selbstregulierung des Marktes setzt, sondern nunmehr aktiv selbst gegen nichtregistrierte Hersteller von Elektro- bzw. Elektronikgeräten sowie gegen Batteriehersteller, die ihre Marktteilnahme nicht angezeigt haben, vorgeht. Die Zahl der Ratsuchenden wegen entsprechender vom UBA eingeleiteter Ordnungswidrigkeitenverfahren ist in letzter Zeit sprunghaft gestiegen,
Tipp: Was haben Online-Händler darüber hinaus beim Verkauf von Batterien zu beachten? Lesen Sie hierzu diesen weiterführenden Beitrag der IT-Recht Kanzlei.
Bestellabwicklung
1. Pflicht zur Übersendung der AGB & Kundeninfo, Widerrufsbelehrung & Widerrufsformular
Es werden Online-Händler abgemahnt, die es unterlassen, ihren Kunden nach der Bestellung die
- AGB nebst Kundeninformationen,
- Widerrufsbelehrung und
- das Widerrufsformular
auf einem dauerhaften Datenträger (z. B. E-Mail, Fax, Brief) zur Verfügung zu stellen.
Hintergrund: Nach der gesetzlichen Regelung des § 312f Abs. 2 BGB müssen Online-Händler die AGB (mit Kundeninformationen), die Widerrufsbelehrung und das Widerrufsformular nach der Bestellung auf einem dauerhaften Datenträger (z.B. per E-Mail, Fax oder ausgedruckt der Warensendung beiliegend) im Volltext zur Verfügung stellen. Diese Übermittlung an den Kunden sieht der Gesetzgeber als zwingende Pflicht zur Dokumentation des geschlossenen Vertrags an. Achtung: Es genügt daher nicht, wenn die vorgenannten Rechtstexte ausschließlich online abrufbar gehalten werden, da der Gesetzgeber ergänzend hierzu verlangt, dass die Rechtstexte zusätzlich an den Kunden in der vorbeschriebenen Weise übermittelt werden.
Datenschutz
1. Fehlende Datenschutzerklärung
Immer häufiger wird das gänzliche Fehlen einer Datenschutzerklärung abgemahnt - egal ob im eigenen Onlineshop oder auf Handelsplattformen wie Etsy oder eBay. Nach Art. 13 DSGVO müssen Diensteanbieter den Nutzer zu Beginn des
Nutzungsvorgangs über Art, Umfang und Zwecke der Erhebung und Verwendung personenbezogener Daten sowie über die Verarbeitung seiner Daten in allgemein verständlicher Form zu unterrichten. Diensteanbieter ist grds. auch jeder Shopbetreiber. Soviel zur datenschutzrechtlichen Vorschrift. Lange umstritten aber war, ob ein Verstoß dagegen einen abmahnfähigen Wettbewerbsverstoß darstellt. Davon gehen mittlerweile aber doch zumindest einige Gerichte aus - es wird argumentiert, dass es sich bei der datenschutzrechtlichen Informationspflicht um eine Marktverhaltensregelung i.S.d. §§ 3, 3a UWG (vgl. etwa OLG Hamburg, Urteil vom 27.06.2013, Az. 3 U 26/ 12) handele.
Tipp der IT-Recht Kanzlei: Hier sollte man sich gar nicht auf irgendein ein Risiko einlassen und einfach eine Datenschutzerklärung vorhalten - in unseren Rechtstexte-Angeboten ist dies, egal ob für Onlineshop oder Plattformaccount, jedenfalls inkludiert.
2. Online-Kontaktformular - Einwilligung erforderlich?
Das OLG Köln hat in einer bislang weniger beachteten Entscheidung geurteilt, dass ein Fehlen einer Datenschutzerklärung im Falle des Vorhaltens eines Online-Konktaktformulars einen wettbewersrechtlichen Verstoß darstellt, denn: Nach Art. 13 DSGVO hat der Online-Seitenbetreiber den Nutzer zu Beginn des Nutzungsvorgangs über Art, Umfang und Zwecke der Erhebung und Verwendung personenbezogener Daten in allgemein verständlicher Form zu unterrichten. Hierzu zählt auch das Vorhalten eines Online-Kontaktformulars, bei welchem personenbezogene Daten (z.B. E-Mailadresse, Name, etc.) erhoben und verarbeitet werden.
Hinweis: Die Datenschutzerklärung der IT-Recht Kanzlei sieht eine solche Information des Nutzers übrigens bereits vor, eine Anpassung Ihrer Datenschutzerklärung ist nicht veranlasst!
Fraglich bleibt nach der Entscheidung des OLG Köln jedoch, ob der Online-Seitenbetreiber im Falle des Vorhaltens eines Online-Kontaktformulars eine aktive Einwilligung des Nutzers in die Datenerhebung und -verarbeitung einholen muss, denn diese Frage hatte das OLG Köln nicht hinreichend klar beantwortet. Das Datenschutzrecht gestattet die Verarbeitung personenbezogener Daten, die für die Erfüllung eines Rechtsgeschäfts erforderlich sind. Mit diesem gesetzlichen Erlaubnistatbestand lässt sich gut vertreten, dass eine Einwilligung im Rahmen eines Kontaktformulars nicht zwingend eingeholt werden muss.
Tipp der IT-Recht Kanzlei: Wir sehen momentan noch keinen Anlass für das Einholen einer Einwilligung des Nutzers für den Fall der Bereitstellung eines Online-Kontaktformulars, wer allerdings auf Nummer sicher gehen möchte, kann eine (nicht vorangecheckte) Einwilligungsbox im Zusammenhang mit dem Kontaktformular bereithalten, welche der Nutzer vor der Übersendung der Kontaktanfrage zwingend anzuhaken hat. Hierbei wäre folgender Einwilligungstext im Zusammenhang mit der Check-Box verwendbar:
"Sie erklären sich mit der Übersendung Ihrer Anfrage über unser Kontaktformular einverstanden, dass wir Ihre mitgeteilten personenbezogenen Daten zur Beantwortung Ihres Anliegens speichern und verarbeiten. Ihre Einwilligung können Sie jederzeit durch Übersendung einer Nachricht an die im Impressum genannte E-Mailadresse mit Wirkung für die Zukunft widerrufen."
Ein Muster für die DSGVO-konforme Gestaltung eines Kontaktformulars finden Sie gerne hier
3. SSL-Verschlüsselung bei Webformularen (z.B. Kontaktformular) und Check-Out Pflicht
Derzeit werden einige Händler von Datenschutzbehörden wegen unverschlüsselt übertragener Webformulare kontaktiert.
Zum Hintergrund: Nach den Vorschriften des Bundesdatenschutzgesetzes ist bei Webformularen, wie etwa Kontaktformulare oder Formulare mit Kommentarfunktion, die in Internetauftritten eingebunden sind und die es Webseitenbesuchern ermöglichen, personenbezogene Daten einzugeben und über das Internet zu übertragen, eine Transportverschlüsselung erforderlich - dabei ist, laut Gesetz, ein Verschlüsselungsverfahren nach dem Stand der Technik zu verwenden. Nach Ansicht der Datenschutzbehörden entspricht die SSL-Verschlüsselung (Secure Sockets Layer) mit HTTPS einem solchen Verfahren. Wir raten daher an, bei allen einschlägigen Formularen (Kontaktformulare, Formulare mit Kommentarfunktion aber auch Check-Out eines Online-Shops) eine SSL-Verschlüsselung einzubinden oder alternativ die Kontaktformulare vom Internetauftritt zu entfernen.
Weitere Informationen hierzu siehe hier.
4. Versand von Newslettern
Für die Versendung eines Newsletters mit werblichem Inhalt bedürfen Sie grundsätzlich der ausdrücklichen Einwilligung des jeweiligen Empfängers. Achtung: Nach der derzeitigen Rechtsprechungspraxis ist davon auszugehen, dass ausschließlich die sog. „Double-Opt-In“- Methode geeignet ist, die Einwilligung des Adressaten beweisbar einzuholen.
Zum Begriff „Double-Opt-In“: Hierbei muss der Adressat in einem ersten Schritt für den Newsletterbezug seine E-Mailadresse angeben und den Bezug des Newsletters ausdrücklich bekunden (z.B. durch Anchecken einer Opt-In-Checkbox oder Betätigung eines Bestellbuttons). Anschließend erhält der Adressat eine E-Mail in der er in einem zweiten Schritt nochmals ausdrücklich befragt wird, ob der Bezug des Newsletters gewollt ist. Erst nachdem der Adressat einen Bestätigungs-Link in dieser E-Mail für den Bezug des Newsletters angeklickt hat, wird die E-Mailadresse für den Versand von Newslettern freigegeben.
Tipp: Unser Beitrag „Newsletter rechtssicher gestalten“ befasst sich eingehend mit den rechtlichen Voraussetzungen der Versendung von Newslettern! Im Rahmen unseres folgenden Beitrags informieren wir Sie zudem über die rechtssichere Gestaltung einer Newsletteranmeldung.
5. Unzulässige Weitergabe von Kunden-E-Mailadressen an Paketdienstleister
Wir wurden häufiger von Mandanten gefragt,
- ob die Weitergabe von E-Mailadressen im Rahmen der Ankündigung von Paketlieferungen nach der Datenschutz-Grundverordnung zulässig ist.
- was bez. der Weitergabe der Telefonnummer bei der Speditionslieferung gilt.
Umfangreiche Informationen zu diesem Thema finden Sie in diesem Beitrag.
6. Cookie-Hinweis bzw. Cookie-Zustimmung erforderlich?
Häufig wird die IT-Recht Kanzlei mit der Frage konfrontiert, ob es eine Pflicht zur Belehrung über Cookies (das sind kleine Textdateien, durch deren Einbindung in den Quelltext eine Markierung auf dem Gerät des Besuchers gespeichert wird) auf Webseiten gibt. Seit dem Urteil des EuGH im Herbst 2019 herrscht hier Klarheit. Der EuGH hat entschieden, dass für technisch nicht zwingend notwendige Cookies vor deren Setzung die Einwilligung des Seitenbesuchers eingeholt werden muss.
Zunächst muss also unterschieden werden, ob nur technisch zwingend notwendige Cookies gesetzt werden sollen (z.B. für den Warenkorbinhalt) oder auch technisch nicht notwendige Cookies (z.B. solche für Analyse- oder Trackingtools).
Für technisch zwingend notwendige Cookies gilt das Einwilligungserfordernis nicht. Auch ist für solche Cookies kein Cookie-Banner erforderlich.
Für alle anderen Cookies muss vor deren Setzung jeweils eine ausdrückliche Einwilligung des Seitenbesuchers eingeholt werden. Andernfalls dürfen solche Cookies nicht gesetzt werden bzw. Dienste / Tools, die solche Cookies setzen, nicht verwendet werden.
Zur Einholung der notwendigen Einwilligung empfehlen wir die Nutzung eines sog. "Cookie Consent Tool". Die IT-Recht Kanzlei bietet hierfür entsprechende Kooperationen an.
Zusammenfassend: Ein bloßer Cookie-Hinweis bzw. Cookie-Banner hat seit der Rechtsprechung des EuGH keinen Anwendungsbereich mehr. Vielmehr muss - werden technisch nicht notwendige Cookies verwendet - ein sog. Cookie-Consent-Tool zum Einsatz kommen.
Weiterführende Hinweise zu dieser Thematik finden Sie gerne im folgenden Beitrag
7. Versendung von Aufforderungen zur Bewertungsabgabe (Feedbackanfrage)
Derzeit sehr beliebt ist die Versendung elektronischer Bewertungsanfragen (Feedbackanfragen), also E-Mails an Kunden, die (gerade) ein Produkt gekauft haben, entweder unmittelbar nach dem Kauf oder einige Tage oder Wochen später mit der Bitte, das gekaufte Produkte und/oder den Webshop zu bewerten.
Die IT-Recht-Kanzlei warnt ausdrücklich vor der Übersendung dieser Bewertungsanfragen, wenn der Angeschriebene zuvor nicht ausdrücklich in die Übersendung einer solchen E-Mail eingewilligt hatte! Derartige Feedbackanfragen sind als Werbung anzusehen, da diese dazu dienen, künftig weitere Produkte abzusetzen. In der Konsequenz dürfen Kunden nur dann zum Zwecke einer Feedbackanfrage kontaktiert werden, wenn diese im Vorfeld (etwa im Rahmen des Registrierung-oder Bestellprozesses) die ausdrückliche Einwilligung erteilt hatten. Aktuell sind vermehrt Abmahnungen im Umlauf, da Betroffene angeschrieben werden, ohne dass eine zuvorige Einwilligung eingeholt worden ist.
Tipp: in Ihrem Online-Mandantenportal finden Sie Im Rahmen der Konfigurationsmöglichkeit Ihrer Datenschutzerklärung für den eigenen Online-Shop den Auswahlpunkt „Kontaktaufnahme zur Bewertungserinnerung“. Hier können Sie die Bewertungsanfrage entsprechend konfigurieren und eine Handlungsanleitung für die Einholung einer wirksamen Einwilligung abrufen!
8. Anmeldung zum E-Mail-Newsletter
In dem Zusammenhang werden leider "traditionell" viele Online-Händler abgemahnt.
Wie kann der Anmeldungsvorgang zum Newsletter nach den Vorgaben der Datenschutz-Grundverordnung rechtssicher gestaltet werden? Wir stellen Ihnen eine umfangreiche Handlungsanleitung zur Verfügung - inkl. vieler nützlicher Musterformulierungen.
9. Pflicht zur Erteilung eines Cookie-Hinweises für ausgewählte Google-Services
Ab dem 30.09.2015 verpflichtet Google seine Kunden der Services Google AdSense, DoubleClick for Publishers und DoubleClick Ad Exchange zur Mitteilung eines sog. Cookie-Hinweises. Hierbei sind Webseitenbetreiber und Appanbieter zur Einbindung eines speziellen Hinweisbanners verpflichtet, der den Seiten- bzw. Appbesucher darüber informiert, dass Cookies der genannten Services verwendet werden, des Weiteren ist auf die Datenschutzerklärung hinzuweisen, welche ihrerseits über die Möglichkeiten der Widerspruchsausübung des Seiten- bzw. Appbesuchers informieren muss. Ausführliche weitere Informationen und Praxistipps für die Umsetzung des Cookie-Hinweises finden Sie in unserem umfangreichen Beitrag!
10. Einsatz von Google-Analytics muss anonymisiert und datenschutzrechtlich geregelt sein
Es werden Händler abgemahnt, die Google-Analytics im Einsatz haben, diesen Dienst aber nicht bzw. falsch in der Datenschutzerklärung geregelt haben oder generell nicht anonymisiert nutzen. Sollte Sie den Dienst "Google-Analytics" verwenden, so vergewissern Sie sich bitte, dass
- Sie die Datenschutzerklärung der IT-Recht Kanzlei entsprechend konfiguriert haben.
- Sie Google Analytics nur unter der Voraussetzung der Aktivierung des „_anonymizeIp()“ Tracking-Codes nutzen. Mit Anbringung dieses „_anonymizeIp()“ Tracking-Codes werden vor jeder weiteren Verarbeitung der anfragenden IP-Adresse die letzten 8 Bit gelöscht. Damit ist eine Identifizierung des Webseiten-Besucher ausgeschlossen. Eine grobe (datenschutzrechtlich zulässige) Lokalisierung bleibt möglich. Dieses Verfahren ist von den Datenschutz-Aufsichtsbehörden in Deutschland anerkannt und wird auch von anderen Webanalyse-Anbietern verwendet.
11. Verschlüsselung des Online-Shops angeraten
Der nachfolgende Hinweis richtet sich an Mandanten, die einen eigenen Online-Shop / Blog oder eine Internetpräsenz unterhalten.
Derzeit liegen der IT-Recht Kanzlei mehrere Schreiben vor, die einen vier- bis fünfstelligen Schadensersatzbetrag wegen unterbliebener Verschlüsselung von Kontaktformularseiten zum Gegenstand haben. Ob diese Forderungsschreiben berechtigt sind, werden die Gerichte zu klären haben. Allerdings sollten Sie nicht erst abwarten, sondern dem drohenden Verstoß gegen die DSGVO proaktiv vorbeugen. Gewerbetreibende sollten im Idealfall ihre komplette Internetseite SSL-verschlüsseln, um potentiellen Angreifern keine Angriffsfläche zu bieten. Zumindest aber die Online-Bereiche, in denen personenbezogene Daten der Kunden verarbeitet werden (Kontaktformular, Bestellprozess, etc.) sollten SSL-verschlüsselt werden.
Weitere Einzelheiten zu diesem Thema können Sie hier nachlesen.
eBay
1. Achtung bei der Angabe des Grundpreises auf eBay
Wer gemäß § 4 Abs. 1 Preisangabenverordnung Waren nach Gewicht, Volumen, Länge oder Fläche anbietet oder bewirbt, muss grundsätzlich den Preis je Mengeneinheit (= Grundpreis) für die betreffende Ware angeben. Wichtig ist hierbei die Forderung der Preisangabenverordnung, dass bereits im Rahmen der bloßen Bewerbung grundpreispflichtiger Waren der jeweilige Grundpreis mitzuteilen ist!
Konsequenz: Jedes (!) Mal, wenn eine grundpreispflichtige Ware unter Nennung eines Gesamtpreises werblich dargestellt wird, muss zugleich auch die Grundpreisangabe erfolgen. Auf der Plattform eBay gibt es eine Vielzahl von Darstellungsmöglichkeiten der Artikel, wobei oftmals der Gesamtpreis genannt wird und damit die Grundpreisangabepflicht für den Händler ausgelöst wird.
a) Fehlende Grundpreisangabe in Cross-Selling-Angeboten (Ansicht "Käufer haben sich auch folgende Artikel angesehen")
Nachstehend ist auf der Artikeldetailseite von eBay ein sog. Cross-Selling-Angebot unter der Bezeichnung "Käufer haben sich auch folgende Artikel angesehen" aufgeführt. In diesem Fall wird der Preis und das Produkt benannt und damit im Sinne der PAngV geworben:

Betrachtet man sich das beworbene Produkt in der Artikeldetailansicht, stellt man fest, dass der betreffende Online-Händler eigentlich die automatische Grundpreisanzeige von eBay verwendet:
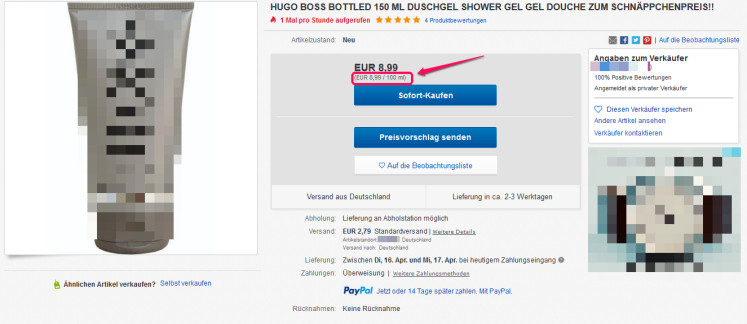
Auf der Artikeldetailseite wird ersichtlich, dass der Grundpreis im Backend von eBay hinterlegt wurde. Dieser erscheint jedoch nicht der vorhergehenden Cross-Selling-Ansicht!
b) Fehlende Grundpreisangabe in der Suchtrefferansicht
Allerdings existieren noch weitere Ansichten auf der Verkaufsplattform eBay, welche die seitens eBay zur Verfügung gestellte Grundpreisansicht nicht unterstützen, wie z.B. die Suchtrefferansicht. Auch wird ein grundpreispflichtiger Artikel unter Nennung des Gesamtpreises beworben, obschon die Grundpreisangabe nicht mitgeteilt wird:

Betrachtet man sich auch hier die Artikeldetailseite, erkennt man, dass der Händler den Grundpreis bei eBay hinterlegt hat - allerdings wird dieser nicht in der vorerwähnten Ansicht ausgegeben:
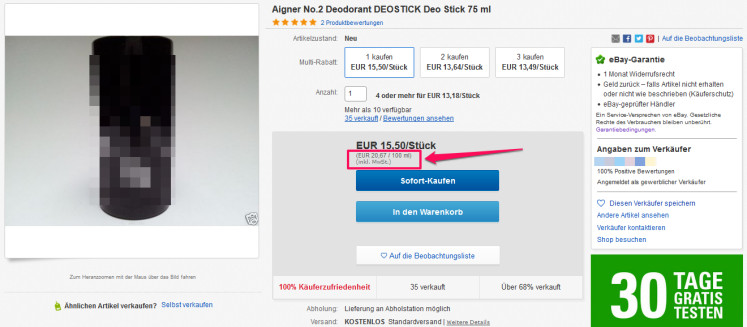
Tipp der IT-Recht Kanzlei: Händler sollten sich für eine korrekte Grundpreisanzeige nicht auf die bereit gestellte Grundpreisanzeigefunktion von eBay verlassen, da diese unzureichend ist und eine wettbewerbsrechtliche Abmahnung droht. Um den Grundpreis auf der Plattform eBay tatsächlich in allen relevanten Ansichten wettbewerbskonform anzeigen zu lassen, ist der Händler (zumindest noch derzeit) verpflichtet, diesen am Anfang der Artikelüberschrift zu platzieren.
Auch das LG Hamburg geht davon aus, dass der Grundpreis in der Artikelüberschrift genannt sein muss!
c) Problem der Grundpreisangabe bei Mengenrabatt-Angeboten auf eBay
Im Rahmen von Mengenrabatt-Aktionen können Händler mehr Exemplare eines Artikels pro Bestellung verkaufen und hierfür einen gestaffelten Rabatt (abhängig von der Anzahl der gekauften Artikel) gewähren.
Weitere Informationen zum Mengenrabatt auf eBay finden Sie hier.
Beispiel: So sieht ein Mengenrabatt-Artikel auf eBay aus:
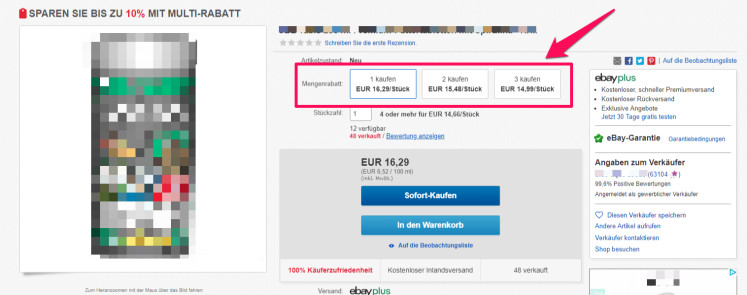
Das bedeutet, dass grundpreispflichtige Mengenrabatt-Artikel mit einer Grundpreisangabe versehen werden müssen, wenn diese unter Nennung des Gesamtpreises dargestellt werden (= Artikelseite).
Problem: Der Grundpreis ändert sich bei jeder Preisstaffelung, da der Preis hierdurch günstiger wird und damit auch der zugehörige Grundpreis!
Der Grundpreis kann auch nicht in der Mengenrabatt-Box angegeben werden. Eine Grundpreisangabe unterhalb der Preisnennung für einen Artikel ist ebenfalls falsch, da dieser Grundpreis ja nur für den Abgabepreis für einen Artikel gilt und gerade nicht für die günstigeren Mengenrabatt-Preisstaffeln.
Lösung: Die sicherste Vorgehensweise wäre daher, bei Mengenrabatt-Artikeln mit unterschiedlichen Grundpreisen einzelne eBay-Angebote zu erstellen und an der Mengenrabatt-Aritkelanzeige von eBay nicht weiter festzuhalten.
Die Angabe der Grundpreise am Anfang der Artikelbeschreibung dürften nicht mehr den vom BGH neu aufgestellten Anforderungen an eine unmittelbare Grundpreisangabe genügen (da der BGH fordert, dass die Vorgabe der klaren Erkennbarkeit des Grundpreises nur dann erfüllt sei, wenn der Grundpreis so in unmittelbarer Nähe des Gesamtpreises angegeben wird, dass er zusammen mit diesem auf einen Blick wahrgenommen werden könne).
Auch das LG Hamburg hatte bereits im Jahr 2011 festgestellt, dass die ausschließliche Anführung von Grundpreisen in der Artikelbeschreibung den Anforderungen der PAngV nicht gerecht wird (Urteil vom 24.11.2011 - Az.: 327 O 196/11).
Mehr zum Problem der Mengenrabatt-Angebote auf eBay finden Sie in diesem Beitrag.
d) Problem der Grundpreisangabe bei Variantenartikel-Angeboten auf eBay
Variantenartikel sind Angebote, die in verschiedenen Ausführungen vorliegen und in einem einzigen Angebot mit Festpreis oder zu unterschiedlichen Festpreisen veröffentlicht werden.
Dies bedeutet, dass grundpreispflichtige Variantenartikel mit einer Grundpreisangabe versehen werden müssen, wenn diese unter Nennung des Gesamtpreises dargestellt werden (= Artikelseite).
Nachstehend exemplarisch ein Variantenartikel auf eBay:

Auch in dieser Variantenauswahlansicht muss der zutreffende Grundpreis gemäß § 4 Abs. 1 PAngV angegeben werden. Während eBay noch vor einiger Zeit auf seiner Hilfeseite mitteilte, dass die Angabe eines Grundpreises nicht möglich sei, ist die Grundpreisangabe nunmehr durch eBay geschaffen worden.
Bei der Angabe des Grundpreises im Zusammenhang mit Artikelvarianten ist das Folgende zu beachten:
Wenn alle Varianten einen einheitlichen Grundpreis haben, empfehlen wir, einen einzigen Grundpreis am Anfang der eBay-Artikelüberschrift anzugeben.
Wenn die einzelnen Artikelvarianten unterschiedliche Grundpreise haben, empfehlen wir, den Grundpreis jeweils vor die Variante zu setzen, damit dieser bei allen Varianten vollständig angezeigt werden kann, wie im nachstehenden Beispiel:

Mehr zum Problem der Variantenartikel-Angebote auf eBay finden Sie in diesem Beitrag.
2. Problem der mangelnden Gesamtpreisangabe bei Multirabatt-Artikeln auf eBay
a) Gesamtpreisangabe – was ist das?
Nach der maßgeblichen Vorschrift des § 1 Abs. 1 PAngV (Preisangabenverordnung) muss jeder Onliner-Händler (beim Anbieten von Waren) die Preise angeben, die einschließlich der Umsatzsteuer und sonstiger Preisbestandteile zu zahlen sind (sog. Gesamtpreise).
b) Problem bei eBay - die sog. Multirabattangebote
eBay-Händler stehen bei sog. Multirabattangeboten vor einem evtl. Problem.
Was sind Multirabatt-Artikel auf eBay? Im Rahmen von Multirabatt-Aktionen können Händler mehr Exemplare eines Artikels pro Bestellung verkaufen und hierfür einen gestaffelten Rabatt (abhängig von der Anzahl der gekauften Artikel) gewähren. Weitere Informationen zum Multirabatt auf eBay finden Sie hier.
Beispiel: So sieht ein Multirabatt-Artikel auf eBay aus:
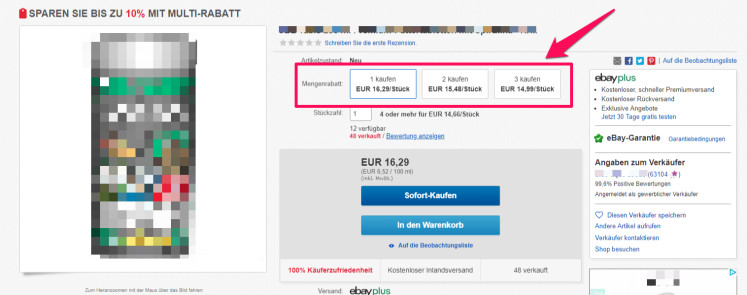
Der Kunde kann bei diesen Multirabatt-Angeboten wählen. Es können unterschiedliche Verkaufseinheiten eines Produkts angeboten werden. Diese Angebote werden plakativ mit einer separaten Schaltfläche als eigenständige Angebote beworben, hierbei wird ein reduzierter Einzelpreis je Mengen-Angebot angegeben.
c) Das konkrete Problem der Gesamtpreisangabe auf eBay:
Eine Gesamtpreisangabe könnte im Rahmen dieser dargestellten Angebote fehlen! Der Kunde würde dann nicht erfahren, welche Gesamtkosten für das jeweilige Angebot entstehen.
Auch im Falle des Anklickens einer Angebots-Box führt bei der eigentlichen (Gesamtpreis-) Angabe nur dazu, dass der Preis pro Stück angezeigt wird, nicht jedoch der Gesamtpreis für die ausgewählte Anzahl des jeweiligen Artikels:
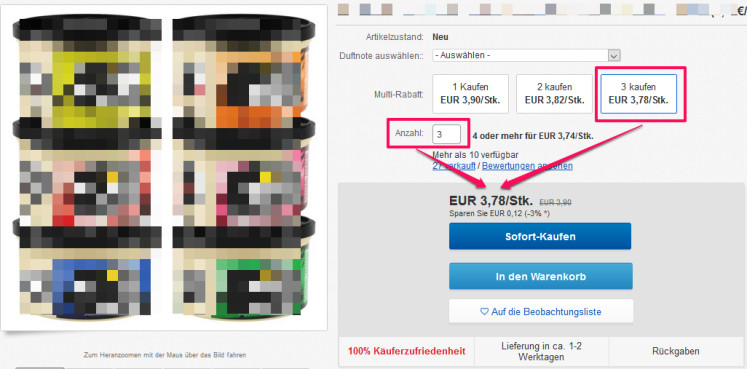
Bislang ist noch nicht letztverbindlich geklärt, ob die konkrete Darstellung auf eBay auch von den Gerichten als Wettbewerbsverstoß gewertet werden wird. Allerdings hatte das ! Es bleibt hier abzuwarten, wie sich die Rechtsprechung zu diesem Problem äußern wird! Das LG Bochum (Az.: I-12 O 161/19) hat allerdings schon einmal eine einstweilige Verfügung gegen einen eBay-Händler aufgrund der fehlenden Gesamtpreisangabe bei Multi-Rabattangeboten erlassen.
d) Best Practice – wie könnte eine Lösung des Problems aussehen?
eBay-Händler sollten ihre Angebote auf der Plattform eBay dahingehend prüfen, ob dort Mulitrabatt-Artikel angeboten werden.
Sollte sich die Ansicht der zwingenden Gesamtpreisangabe durchsetzen, kann die Gesamtpreisangabe bei Multirabattangeboten (derzeit wohl) nicht auf eBay dargestellt werden. Der falsche Gesamtpreis wird dann prominent angegeben, die Nachholung der korrekten Gesamtpreisnennung im Rahmen der Artikelbeschreibung kann ebenfalls keine Abhilfe schaffen, denn: zwei sich widersprechende Gesamtpreisangaben würden gegen das preisrechtliche Gebot der Preisklarheit und Preiswahrheit verstoßen (§ 1 Abs. 7 PAngV) .
Die sicherste Vorgehensweise wäre daher, auf die Multirabatt-Artikel bei eBay zu verzichten. Solange eBay keine Gesamtpreisangabe unterstützt, sind eBay-Händler im Falle von Multirabatt-Artikeln latent abmahngefährdet. Es bleibt allerdings noch abzuwarten, ob die Gerichte diese konkrete Darstellung auf eBay ebenfalls als wettbewerbswidrig ansehen werden.
Mehr zum Problem der Variantenartikel-Angebote auf eBay finden Sie in diesem Beitrag.
3. Widersprüchliche Angaben zur Widerrufsfrist
Online-Händler sind verpflichtet, den Verbraucher auf das diesem zustehende hinzuweisen. In zeitlicher Hinsicht muss diese Belehrung vor der Abgabe der Vertragserklärung des Verbrauchers geschehen.
Auf der Verkaufsplattform eBay ist es für Online-Händler möglich, die Widerrufsbelehrung und das Widerrufsformular in der Informationsbox am Ende der Artikelbeschreibung anzeigen zu lassen.
Oberhalb dieses Textfeldes ist es möglich bzw. durch eBay zwingend vorgeschrieben, dass unter der Überschrift "Frist" ein Hinweis auf die Widerrufsfristlänge mitgeteilt wird:
Es ist ganz wesentlich für den Online-Händler, dass dieser sowohl im Rahmen der gesetzlichen Widerrufsbelehrung, als auch im von eBay vorgesehenen Angabenfeld zur Widerrufsfristlänge eine einheitliche Aussage zur Widerrufsfristlänge mitteilt. Es besteht die Pflicht des Online-Händlers, dass insbesondere über die Bedingungen des Widerrufsrechts „klar und verständlich“ informiert werden muss.
Bei vielen Händlern findet sich allerdings die Aussage in der Widerrufsbelehrung, dass die Widerrufsfrist 14 bzw. 30 Tage beträgt, in der rechtlichen Informationsbox oberhalb der Widerrufsbelehrung wird sodann auf eine einmonatige Widerrufsfrist verwiesen, wie z.B. nachstehend:
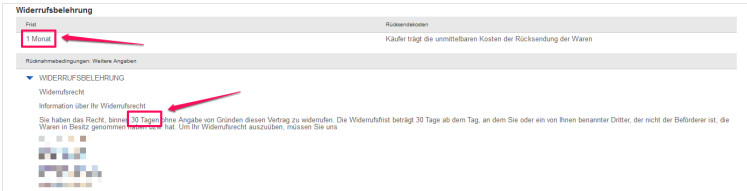
In diesem Fall wird der Verbraucher über zwei unterschiedliche Fristen zum Widerruf informiert, dies stellt wiederum einen Wettbewerbsverstoß dar, da in diesem Fall nicht mehr davon ausgegangen werden kann, dass der Verbraucher „klar und verständlich“ über das Widerrufsrecht bzw. die Widerrufsfrist belehrt wird.
Leider wurden und werden immer noch zahlreiche eBay-Händler wegen irreführender (weil unterschiedlicher) Widerrufsfristlängen abgemahnt!
Tipp der IT-Recht Kanzlei: Überprüfen Sie Ihre Angaben im rechtlichen Informationskasten dahingehend, dass über die Widerrufsfrist einheitlich belehrt wird. Die Aussagen zur Widerrufsfristlänge müssen im Gleichklang kommuniziert werden! Sollten Sie die Widerrufsbelehrung noch an anderen Stellen im Rahmen Ihres eBay-Auftritts verwenden, sollten Sie auch hier kontrollieren, ob die Angaben zur Widerrufsfristlänge evtl. widersprüchlich sind.
4. Widersprüchliche Angaben zur Rücksendekostentragung
Einen weiteren Fallstrick stellt die Angabe über die Rücksendekostentragung dar. Diese Problematik ist identisch mit der vorbenannten Widersprüchlichkeit in Bezug auf die Angabe der Widerrufsfristlänge.

Ebay verlangt nämlich einen Hinweis, wer im Falle des Widerrufs die unmittelbaren Kosten der Rücksendung zu tragen hat. Auch diesbezüglich ist unbedingt darauf zu achten, dass hier ein Gleichlauf zwischen diesem Hinweis und der Formulierung dazu in der von Ihnen vorgehaltenen Widerrufsbelehrung besteht.
Sofern Sie bei eBay im Rahmen des Hinweises auswählen „Käufer trägt die unmittelbaren Kosten der Rücksendung der Waren“ muss in der Widerrufsbelehrung die Aussage „Sie tragen die unmittelbaren Kosten der Rücksendung der Waren.“ erscheinen, welche sich mit den Angaben im Hinweis bei eBay deckt (mit „Sie“ wird der Verbraucher angesprochen).
In diesem Fall darf im Rahmen der Widerrufsbelehrung dann nicht die alternative Formulierung „Wir tragen die Kosten der Rücksendung.“ enthalten sein, da dies dann im Widerspruch zum Hinweis bei eBay stünde und abmahnbar wäre.
Dagegen muss bei Auswahl des ausgewählten Hinweises „Verkäufer trägt die Kosten der Rücksendung“ dann in der Widerrufsbelehrung die Aussage „Wir tragen die Kosten der Rücksendung.“ stehen.
Tipp der IT-Recht Kanzlei: Überprüfen Sie Ihre Angaben im rechtlichen Informationskasten dahingehend, ob Sie über die Rücksendekostentragung einheitlich belehren. Die Aussagen zur Tragung der Rücksendekosten müssen im Gleichklang kommuniziert werden! Sollten Sie die Widerrufsbelehrung noch an anderen Stellen im Rahmen Ihres eBay-Auftritts verwenden, sollten Sie auch hier kontrollieren, ob die Angaben zur Rücksendekostentragung evtl. widersprüchlich sind.
5. Kein transparentes Impressum bei „eBay-Shops“
Die Plattform eBay.de ermöglicht gewerblichen Verkäufern, gegen monatliche Gebühren einen eignen „eBay Shop“ zu eröffnen. In diesem Falle stellt eBay.de dem Verkäufer über die eigentlichen Verkaufsangebote hinaus einen eigenständigen „Shop“ bei eBay.de zur Verfügung, den der Verkäufer zum Teil auch selbst gestalten kann (z.B. indem er ein eigenes Layout hinterlegt und individuelle Informationen, z.B. über sein Unternehmen hinzufügt).
Sofern ein solcher Shop betrieben wird, kann dieser über den folgenden Link aufgerufen werden:
https://www.ebay.de/str//xxxxx
(xxxxx ist dabei durch den eigenen Mitgliedsnamen zu ersetzen).
Nachstehend ein Beispiel:
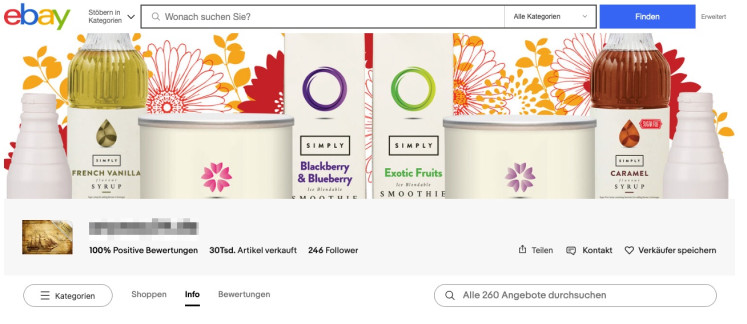
Problematisch dabei ist, dass im Rahmen der Standardeinstellungen auf diesen „Shopseiten“ dann kein Impressum des Verkäufers dargestellt wird. Ein solches ist zwar theoretisch erreichbar, wenn ein im Shop dargestelltes Angebot aufgerufen wird oder auf den Reiter „Info“ geklickt wird.
Es fehlt jedoch an einem eindeutigen Hinweis darauf, dass das Impressum auf diese Art erreicht werden kann. Der Betrachter dieser Seiten erschließt sich damit nicht auf Anhieb, wie er zum Impressum des „Shopbetreibers“ gelangen kann. Leider gibt es hier nach unseren Informationen keine Lösung, um das Impressum transparenter darzustellen.
6. Problematische Werbung für „ebay plus“ und „eBay-Garantie“
a) Was hat es mit dem eBay-plus-Programm auf sich?
Auf eBay.de wird ein Programm angeboten, welches Kunden ermöglichen soll, bestimmte Vorteile (wie kostenfreier Premiumversand, längere Widerrufsfrist, immer kostenfreie Rücksendung) in Anspruch zu nehmen.
Verkäufer erhalten bei Teilnahme ein besseres Ranking und können Verkaufsprovisionen sparen. Käufer müssen für eine Teilnahme an diesem Programm namens „ebay plus“ grundsätzlich eine jährliche Gebühr an eBay entrichten. Regelmäßig wird zu Werbezwecken jedoch ein kostenloser, 30-tägiger Testzeitraum für „ebay plus“ angeboten.
Seit einiger Zeit blendet eBay.de oberhalb der Angaben zum Verkäufer bei bestimmten Angeboten eine entsprechende Werbung für „ebay plus“ ein. Konkret geschieht dies wie folgt:

Zunächst muss man sich natürlich fragen, was genau eBay mit der Aussage „30 Tage gratis Rückversand“ eigentlich zum Ausdruck bringen möchte.
Zunächst könnte man diese als Werbung für den Gratis-Test von „ebay plus“ verstehen (der Testzeitraum für die kostenlose Nutzung von „ebay plus“ beträgt ja 30 Tage). Würde man die Aussage so verstehen wollen, würde aber die darüber stehende Aussage „Kostenloser Premiumversand“ keinen Sinn machen (da dieser Vorteil dann ja auch nur 30 Tage lang greifen würde und dort keine entsprechende zeitliche Beschränkung vorangestellt wird).
Da eBay.de seinen Verkäufern, die an „ebay plus“ teilnehmen möchten vorschreibt, dem Verbraucher (mindestens) eine Widerrufsfrist von 30 Tagen einzuräumen, dürfte der Hinweis eher dahingehend zu verstehen sein, dass ebay-plus-Kunden den so beworbenen Artikel 30 Tage lang kostenfrei zurücksenden können.
eBay.de stellt für Teilnehmende nämlich folgende Regelung auf:
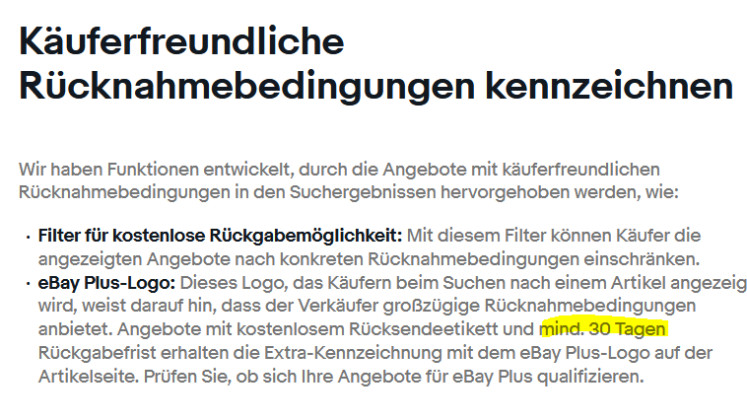
b) Worin besteht konkret das Problem?
Auch ein Verbraucher dürfte den Hinweis „30 Tage gratis Rückversand“ wohl so verstehen, dass er den dergestalt beworbenen Artikel binnen 30 Tagen kostenfrei an den Verkäufer zurückschicken kann, mithin so, dass ihm bezüglich dieses Artikels also ein Widerrufsrecht von 30 Tagen zusteht.
Das ist erstmal kein Problem. Jedenfalls dann nicht, wenn der Verkäufer des so beworbenen Artikels ein Widerrufsrecht von 30 Tagen Dauer einräumt.
Bei eBay.de können Verkäufer jedoch verschiedene, längere (als das gesetzliche Minimum von 14 Tagen) Widerrufsfristen einstellen: 30 Tage, 1 Monat oder gar 60 Tage.
Das Problem dabei:
eBay.de stellt die Aussage auch bei Artikeln dar, bei denen sich der Verkäufer dazu entschieden hat, ein Widerrufsrecht von einem Monat Dauer anzubieten und dies auch in den Rücknahmeeinstellungen bei eBay.de so hinterlegt hat.
Weiter unten wird im selben Angebot dann also wie folgt informiert:

Ferner problematisch: Der Hinweis wird ebenfalls bei Artikeln eingeblendet, bei denen der Verkäufer eine Widerrufsfrist von 60 Tagen einräumt. Weiter unten im mit dem Hinweis beworbenen Angebot heißt es dann:

c) 30 Tage vs. 1 Monat bzw. vs. 60 Tage
Etliche Online-Händler haben in Vergangenheit bereits Erfahrungen mit unliebsamen Abmahnungen gesammelt, wenn sie im Rahmen eines Angebots einmal von einer Widerrufsfrist von 30 Tagen und einmal von einer Widerrufsfrist von einem Monat sprachen.
Gerade die Gestaltung von eBay.de ist dahingehend für entsprechende Abweichungen prädestiniert (siehe die beiden letzten Abbildungen), wenn oberhalb der Widerrufsbelehrung eine andere Frist genannt wird als dann in der Widerrufsbelehrung selbst.
Gerichte haben dann kein Erbarmen, denn nicht jeder Monat hat 30 Tage. Der Februar hat weniger und sechs Monate haben mehr Tage. Damit liegt in jedem Fall eine Irreführung über die Modalitäten des Widerrufsrechts vor, erfolgen abweichende Informationen zu Länge der Widerrufsfrist im selben Angeboten.
Noch plastischer wird die Sache, wenn es einmal 60 Tage und einmal 30 Tage heißt. Dann wäre die Frist schließlich einmal doppelt so lang, wie an anderer Stelle angegeben.
Da ein Verbraucher die Aussage „30 Tage gratis Rückversand“ ohne Weiteres als Angabe mit Bezug zur Länge der Widerrufsfrist bei dem so beworbenen Angebot verstehen kann, droht eine entsprechende Irreführung (30 Tage vs. 1 Monat bzw. vs. 60 Tage) auch bei der dargestellten Werbung für „ebay plus“.
Mit anderen Worten: Wenn ein eBay-Verkäufer mit einer Widerrufsfrist von einem Monat bzw. von 60 Tagen operiert, dann ist die Darstellung dieser Werbung für „ebay plus“ alles andere als optimal. Derzeit sind der IT-Recht Kanzlei zwar noch keine Abmahnungen aus diesem Grund bekannt. Es erscheint aber nicht ausgeschlossen, dass ein Wettbewerbsverband oder ein Mitbewerber diese Werbung zum Anlass für eine Abmahnung nehmen könnte.
d) Was können Sie als betroffener eBay-Händler tun?
Zunächst wäre daran zu denken, auch die eigentliche Widerrufsfrist einheitlich auf 30 Tage anzupassen (also sowohl beim Hinweis oberhalb der Widerrufsbelehrung als auch im Text der Widerrufsbelehrung jeweils 30 Tage anzugeben). Doch dagegen spricht eine andere Werbung eBays:
Die ebenfalls bei sehr vielen Angeboten eingeblendete Werbung mit der „eBay -Garantie“:

Diese weitere Werbung wird etwas unterhalb der Werbung für „ebay plus“ dargestellt. Klickt man dort dann auf „Mehr erfahren“, öffnet sich diese Erläuterungsseite.
Dort heißt es:
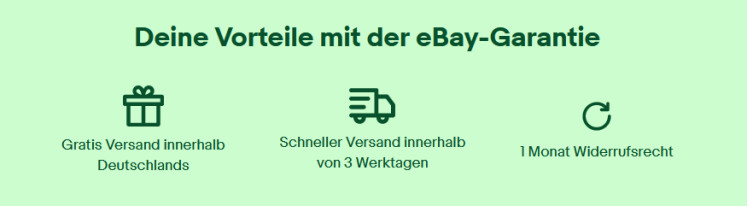
Im Rahmen der „eBay -Garantie“ wird also für das jeweilige Angebot ausdrücklich damit geworben, dass der Kunde einen Monat Widerrufsrecht hat. Schon aus diesem Grunde verbietet es sich daher leider, mit einer Widerrufsfrist von 30 Tagen zu arbeiten (denn dann wäre die Irreführung nicht beseitigt, sondern nur verlagert worden).
Vermutlich verschwindet die problematische Werbung für „ebay plus“ nur dann, wenn der jeweilige Artikel nicht für „ebay plus“ qualifiziert ist (z.B. wegen Lieferdauer oder eben einer definierten Widerrufsfrist kleiner 30 Tage).
Das Anpassen der Widerrufsfrist auf 30 Tage kann das Problem alleine nicht lösen (jedenfalls solange gleichzeitig die Werbung für die „eBay-Garantie“ angezeigt wird.
e) Folgeproblem bei Nutzung von eBay plus und eBay-Garantie
Dem aufmerksamen Leser wird auffallen, dass die „eBay-Garantie“ nicht nur die Beseitigung des Ausgangsproblems verhindert, sondern sogar ein ganz neues Problem schafft:
Aber: Langsam wird es etwas kompliziert. Daher nochmal der Reihe nach:
1. Problem: Werbung mit „30 Tage gratis Rückversand“ bei gleichzeitiger Verwendung einer Widerrufsfrist von einem Monat bzw. 60 Tagen.
2. Problem: Eine Vereinheitlichung der Angaben zur Widerrufsfrist auf 30 Tage scheitert an der Werbung mit der „eBay-Garantie“.
Das Folgeproblem besteht nun dergestalt: Die dargestellte Werbung mit der „eBay-Garantie“ und dem dazu genannten einmonatigen Widerrufsrecht wird auch bei solchen Artikeln eingeblendet, bei denen der Verkäufer bei eBay eine Widerrufsfrist von 60 Tagen hinterlegt hat.
3. Problem also: Die Werbung mit der „eBay-Garantie“ spricht bei Artikeln mit 60-tägiger Widerrufsfrist von einem Widerrufsrecht von einem Monat Dauer, was eine klare Irreführung über die Länge der Widerrufsfrist darstellt.
Es ist schwer, den Überblick zu behalten.
Festzustellen bleibt, dass die Werbung, die eBay für „ebay plus“ und die „eBay-Garantie“ einblendet, vielen Verkäufern Probleme bereiten kann.
f) Best Practice - wie könnte eine Lösung des Problems aussehen?
Bereits bislang galt: Augen auf bei eBay.de wegen abweichender Angaben zur Widerrufsfrist (einmal oberhalb der Widerrufsbelehrung beim Hinweis „Frist“ und zum anderen in der Widerrufsbelehrung selbst). Wer hier verschiedene Längen nennt (verschieden sind auch „30 Tage“ und „ein Monat“!), der begibt sich seit jeher in konkrete Abmahngefahr. Deswegen dürften bereits tausende eBay-Händler abgemahnt worden sein.
Nun kommt aber hinzu, dass auch die dargestellten Werbeboxen für „ebay plus“ und die „eBay-Garantie“ den Händlern Probleme hinsichtlich der einheitlichen Angabe der Widerrufsfrist bereiten können. Die Werbung durch eBay erfolgt wohl ohne Zutun des jeweiligen Händlers und kann von diesem auch nicht direkt gesteuert werden.
Lösung: Wer hier als eBay-Händler ganz sichergehen möchte, sollte dafür sorgen, dass die Werbung für „ebay plus“ bei seinen Angeboten nicht dargestellt wird. Dies klappt wohl nur, wenn das Angebot die Kriterien für „ebay plus“ nicht erfüllt. In Bezug auf die Werbung mit der „eBay-Garantie“ muss darauf geachtet werden, dass die Widerrufsfrist dann oberhalb und in der Widerrufsbelehrung exakt mit einem Monat angegeben wird. Wer dann z.B. eine Widerrufsfrist von 60 Tagen angibt, begibt sich in Abmahngefahr.
Hinweis: Auch im Zusammenhang mit dem pauschalen Hinweis zu den Rücksendekosten bei Programm eBay Plus drohen Probleme. Welche Probleme das sind und was wir als Lösung vorschlagen, können Sie in diesem Beitrag nachlesen.
7. Erfüllung der Online-Kennzeichnungspflichten auf eBay
Wer im Internet energieverbrauchsrelevante Produkteanbietet, ist nach EU-Recht grundsätzlich verpflichtet, den Angeboten das Effizienzetikett und das Produktdatenblatt in elektronischer Form beizustellen.
Diese Vorgaben, die für diverse Produktkategorien zum 01.03.2021 reformiert wurden, gelten nicht nur im eigenen Shop, sondern auch auf Marktplätzen wie eBay und Amazon. Dass bei Verstößen gegen die Kennzeichnungspflichten nicht nur wettbewerbsrechtliche Abmahnungen, sondern auch kostenpflichtige Verfahren der Landesämter für Verbraucherschutz drohen können, zeigt ein der IT-Recht Kanzlei vorliegendes Verwaltungsschreiben.
Viele Händler sind der Ansicht, an der misslichen Lage bei fehlerhafter Umsetzung der Kennzeichnungsvorgaben auf eBay keine Schuld zu haben.
Der Irrglaube, auf eBay ließe sich der Pflicht zur Anführung elektronischer Etiketten und Datenblätter nicht nachkommen, hält sich hartnäckig.
Allerdings bietet eBay eine Option für die Energieverbrauchskennzeichnung an und bedient sich hierfür eines externen Dienstleisters.
Laut eigener Aussage von eBay müssen Händler nur die Marke des Produktes und die Herstellernummer in den eBay-Artikelmerkmalen angeben, damit die korrekten energieverbrauchsrelevanten Informationen systemseitig korrekt zugeordnet und angezeigt werden.
Mehr zu diesem Thema können Sie in diesem Beitrag lesen.
8. Verkauf von mangelhafter Ware und Gewährleistungsverkürzung auf eBay
Seit dem 01.01.2022 gilt ein neues Kaufrecht. Die beiden wohl gravierendsten Auswirkungen beim Verkauf von Waren betreffen den künftigen Verkauf von Waren mit Mängeln (im Folgenden der Einfachheit halber „Mängelexemplar“) sowie den Verkauf von Gebrauchtware unter Verkürzung der Verjährungsfrist für Mängel von zwei Jahren auf ein Jahr.
a) Verkauf von mangelhaften Waren
Die bloße Information über entsprechende Abweichungen, also Mängel der Ware im Rahmen der Artikelbeschreibungen ist ab dem 01.01.2022 nicht mehr ausreichend, um die Beschaffenheit der zu verkaufenden Ware dahingehend zu vereinbaren, dass dem Käufer wegen der genannten Abweichungen keine Mängelrechte mehr zustehen.
Es bedarf eine sog. negativen Beschaffenheitsvereinbarung, welche erfordert, dass
- der Verbraucher vor der Abgabe seiner Vertragserklärung eigens davon in Kenntnis gesetzt wurde, dass ein bestimmtes Merkmal der Sache von den objektiven Anforderungen abweicht, und
- die Abweichung im Vertrag ausdrücklich und gesondert vereinbart wurde.
Lesetipp „gebraucht = mangelhaft?“: Ob es sich bei gebrauchten Waren automatisch um mangelhafte Ware handelt, haben wir in diesem Beitrag näher untersucht.
b) Verkürzung der Mängelhaftung (bei Gebrauchtwaren)
Eine Verkürzung der Verjährungsfrist für Mängel ist seit dem 01.01.2022 noch dann wirksam möglich, wenn
- der Verbraucher vor der Abgabe seiner Vertragserklärung von der Verkürzung der Verjährungsfrist eigens in Kenntnis gesetzt wurde, und
- die Verkürzung der Verjährungsfrist im Vertrag ausdrücklich und gesondert vereinbart wurde.
Von den formalen Anforderungen besteht also eine Parallelität zur bereits oben besprochenen Vereinbarung einer Negativabweichung bei der Beschaffenheit.
c) Best Practice - wie könnte eine Lösung der Probleme aussehen?
Für die Vereinbarung einer negativen Beschaffenheit haben wir hier einen Lösungsvorschlag näher dargelegt.
Für die Verkürzung der Mängelhaftung bei Gebrauchtwaren haben wir hier einen Lösungsansatz entwickelt.
9. Was eBay-Händler bei dem Verkauf differenzbesteuerter Ware beachten müssen
Auch beim Vertrieb von Waren im Rahmen der Differenzbesteuerung hat bei der Preisangabe der Hinweis „inkl. MwSt.“ bzw. „inkl. USt.“ zu erfolgen. Darüber hinaus müssen Händler klar und eindeutig darüber aufklären, dass eine Differenzbesteuerung vorliegt - ansonsten drohen Abmahnungen. Dies gilt zumindest für den Regelfall, dass sich das Angebot nicht ausschließlich an Verbraucher richtet.
Die nachfolgenden Hinweise gelten nicht, wenn Sie umsatzsteuerpflichtig sind oder den Kleinunternehmerstatus in Anspruch nehmen.
Um die potentiellen unternehmerischen Käufer nicht über die Höhe der enthaltenen Umsatzsteuer zu täuschen, sollten Sie den nachstehenden Hinweis zu Klarstellungszwecken angeben:
Dieser Artikel unterliegt gem. § 25a UStG der Differenzbesteuerung, ein Ausweis der Mehrwertsteuer auf der Rechnung erfolgt nicht.
Sollten Sie sowohl umsatzsteuerpflichtige Ware, als auch differenzbesteuerte Ware verkaufen, müssen Sie den nachstehenden Hinweis verwenden:
Umsatzsteuer wird ausgewiesen, sofern der Artikel nicht gem. § 25a UStG der Differenzbesteuerung unterliegt und daher kein Ausweis der Mehrwertsteuer auf der Rechnung erfolgt.
Wichtig: Wenn Sie umsatzsteuerpflichtige Ware und differenzbesteuerte Ware verkaufen, müssen Sie spätestens an der Stelle, in dem der Kaufvorgang eingeleitet werden kann (= Einlegen der Ware in den virtuellen Warenkorb) darauf hinweisen, ob der konkrete Artikel der Differenzbesteuerung unterliegt. Hierzu können Sie den kurzen Vermerk „Differenzbesteuerter Artikel“ anbringen.
Konkrete Umsetzung bei eBay: Der vorstehende Hinweis sollte auf jeden Fall im Freitextfeld unterhalb der Impressumsangaben im Rahmen der rechtlichen Informationen zum Verkäufer mitgeteilt werden. Es ist nicht abschließend geklärt, ob die Platzierung an dieser Stelle ausreichend ist. Wenn Sie den sichersten Weg folgend handeln möchten, sollten Sie den Hinweis zusätzlich am Anfang der Artikelbeschreibung platzieren.
Lesetipp: Weiterführende Informationen zum Thema Differenzbesteuerung und Kleinunternehmerstatus können Sie in unserem Beitrag Kleinunternehmer bzw. Differenzbesteuerung:Der Umgang mit dem Hinweis „inkl. MwSt.“ bei der Preisangabe nachlesen!
E-Mail Signaturen
Abmahnfalle:
Es werden E-Mails ohne oder nur mit unvollständigen E-Mail Signaturen verschickt.
Rechtslage:
Meist enthalten E-Mails am Ende nur ein nettes, abschließendes Grußwort. Eine Signatur mit Name und Anschrift fehlt häufig. Doch E-Mail-Signaturen erleichtern nicht nur die Kontaktaufnahme potenzieller Kunden für telefonische Rückfragen. Oftmals sind sie in der Regel gesetzlich vorgeschrieben.
Wir haben in Ihrem Mandantenportal für folgende Rechtsformen Muster abmahnsicherer E-Mail Signaturen hinterlegt: AG, GmbH, UG, Kaufleute, OHG und KG
Tipp: Für nicht im Handelsregister eingetragene Gewerbetreibende besteht derzeit grundsätzlich keine gesetzliche Pflicht, eine E-Mail-Signatur bereitzuhalten.
Etsy
Die Plattform „etsy.com“ ist in den letzten Jahren zu einem der größten E-Commerce-Portale für Handgemachtes und Künstlerbedarf avanciert und wird von vielen Online-Händlern genutzt, um ihre Produkte über etwaig bestehende eigene Shops hinaus einem breiten Publikum zugänglich zu machen. Hierbei sind sie allerdings gesetzlich zur Bereitstellung verschiedener, meist dem Verbraucherschutz dienender Pflichtinformationen gehalten.
Wie Etsy-Händler
- AGB, Impressum, Widerrufsbelehrung und Co. rechtssicher darstellen
- bestimmte Etsy-typische Abmahnfallen umgehen können
haben wir für Sie gerne in dieser aktuellen Handlungsanleitung aufbreitet.
Geoblocking
- Mindestbestellwerte nur für ausländische Käufer im Online-Shop sind unzulässig - s. hierzu diesen Beitrag.
- EU-weite Rechnungsadresse muss möglich sein - s. hierzu diesen Beitrag.
Google-Analytics
Derzeit werden Händler abgemahnt, die Google-Analytics im Einsatz haben, diesen Dienst aber nicht bzw. falsch in der Datenschutzerklärung geregelt haben. Sollte auch Sie den Dienst "Google-Analytics" nutzen, so vergewissern Sie sich bitte, dass Sie die Datenschutzerklärung der IT-Recht Kanzlei entsprechend konfiguriert haben.
Google-Shopping
1. Falsche Versandkostenangaben bei Google Shopping
Abmahnfalle:
Bei Google Shopping werden falsche Versandkosten angezeigt.
Rechtslage:
Wenn bei Google Shopping falsche Versandkosten zu einem Produkt angezeigt werden, haftet der jeweilige Händler des Artikels. Dies gilt sogar dann, wenn der Fehler Google selbst unterlief!
Um auf Nummer sicher zu gehen, sollten Sie regelmäßig kontrollieren, ob die für Ihre Produkte in der Plattform aufgeführten Preise und Versandkosteninformationen korrekt dargestellt werden. Melden Sie Google Shopping oder anderen Plattformen sofort, wenn sich der Preis für einen Ihrer Artikel geändert hat. Überprüfen Sie auch danach, ob die in der Plattform aufgeführten Informationen dem aktuellen Stand entsprechen.
Herstellergarantie
1. Fehlende Information über bestehende Herstellergarantie
Online-Händler werden abgemahnt wegen fehlender Informationen über eine für die Ware bestehende Herstellergarantie und deren Bedingungen. Wir haben uns unter anderem in diesem Beitrag mit der Thematik auseinandergesetzt.
Impressum
1. Verwendung von Sonderrufnummern für Kundenservicehotlines abmahnbar
Dieser Hinweis richtet sich an alle Händler, die Verträge (auch) mit Verbrauchern schließen und eine Telefonnummer vorhalten, unter der ein Verbraucher sich wegen Fragen oder Erklärungen zu einem bereits geschlossenen Vertrag telefonisch an den Unternehmer wenden kann:
Verwenden Sie bei der Angabe einer solchen Telefonnummer ausschließlich eine gewöhnliche Rufnummer im Fest- oder Mobilfunknetz oder eine für den Anrufer kostenfreie Rufnummer (Vorwahl: 0800). Sie dürfen für solche Zwecke keine Sonderrufnummern (wie etwa solche unter den Vorwahlen 0180x, 0137x, 0700 oder gar 0900) angeben. Andernfalls besteht die Gefahr einer Abmahnung.
Hintergrund ist eine kürzlich ergangene Entscheidung des EuGH (Urt. v. 2.3.2017, Az.: C-568/15), mit welcher der EuGH die Verwendung einer Rufnummer unter der Vorwahl 01805 als Verstoß gegen die Vorschrift des § 312a Abs. 5 BGB eingestuft hat.
Hiervon nicht betroffen sind dagegen solche Rufnummern, über welche nicht Fragen und Erklärungen zu einem geschlossenen Vertrags abgewickelt werden, etwa also reine Bestellhotlines zu Klärung von Fragen im Vorfeld eines Vertragsschlusses. Auch reine Faxnummern werden nicht erfasst.
Darüber hinaus empfiehlt die IT-Recht Kanzlei, auch bei der im Impressum genannten Telefonnummer ausschließlich eine Standardrufnummer aus dem Fest- oder Mobilfunknetz oder eine kostenfreie Rufnummer zu verwenden. Weitere Details zu dieser Thematik finden Sie hier.
2. Fehlen bestimmter Pflichtangaben: im Impressum
Prüfen Sie die Angaben zu Ihrem Impressum auf Richtigkeit und Aktualität Ihrer Daten und nehmen Sie ggf. erforderliche Anpassungen vor. Dies gilt sowohl für die Darstellung Ihres Impressums im Mandantenportal als auch für die Darstellung Ihres Impressums in Ihrer Online-Präsenz.
Beachten Sie in diesem Zusammenhang insbesondere auch folgende Besonderheiten:
1) Es ist die vollständige (ladungsfähige) Adresse anzugeben - nicht ausreichend ist die Angabe eines Postfaches.
2) Sie müssen in Ihrem Impressum weder Ihre Steuernummer noch Ihre Steueridentifikationsnummer angeben.
3) Sie müssen dagegen Ihre Umsatzsteueridentifikationsnummer angeben, sofern Ihnen eine solche vom Finanzamt zugeteilt worden ist.
Als Händler haben Sie diesbezüglich die folgenden Punkte zu beachten:
a. Eine USt-IdNr. haben Sie nur dann im Impressum anzugeben, wenn Ihnen eine solche auf Ihren Antrag hin vom Bundeszentralamt für Steuern (BZSt) zugeteilt worden ist. Mit anderen Worten: Nicht jeder Unternehmer verfügt über eine USt-IdNr. Verfügt er nicht über eine solche, muss er diese auch nicht angeben, da er das ja auch gar nicht kann.
b. Bitte verwechseln Sie die USt-IdNr. nicht mit der Steuernummer oder der Steueridentifikationsnummer. Die Namen klingen ähnlich, es handelt sich aber um vollkommen unterschiedliche Daten. In Deutschland hat eine USt-IdNr. immer das Format der einleitenden Buchstabenfolge „DE“ gefolgt von neun Ziffern, also z.B: DE123456789. Steuernummer und Steueridentifikationsnummer haben in aller Regel mehr Ziffern. Durch die Angabe der Steuernummer und/ oder Steueridentifikationsnummer im Impressum kann die Pflicht zur Angabe einer erteilten USt-IdNr. nicht erfüllt werden.
c. Denken Sie bitte auch an weitere Impressen außerhalb Ihrer „Hauptpräsenzen“ (wie etwa bei Facebook), dort muss die USt-IdNr. natürlich auch genannt werden. Bitte denken Sie ferner daran im Falle einer (später) noch zu erfolgenden Erteilung der USt-IdNr. diese in Ihren Impressen nachzutragen.
3) Wenn Sie für Ihre Online-Präsenz Bilder oder sonstige urheberrechtlich geschützte Inhalte von Drittanbietern nutzen, müssen Sie unter Umständen bestimmte Angaben zum Urheber, zum Rechteinhaber und/oder zur Quelle der jeweiligen Inhalte in Ihrem Impressum machen. Ob und in welchem Umfang Sie entsprechende Angaben machen müssen richtet sich ausschließlich nach den einschlägigen Lizenzbestimmungen des jeweiligen Anbieters, die Sie im Rahmen der Registrierung für einen solchen Dienst akzeptieren müssen.
4) Die Verwendung so genannter Disclaimer (insbesondere zum Haftungsausschluss für externe Links, zum Urheberrecht oder zum Markenrecht) wie man sie im Internet häufig finden kann, ist entgegen einer weitläufigen Meinung weder erforderlich noch hilfreich.
Wir raten daher von der Verwendung solcher Disclaimer kategorisch ab.
5) Informationen zum Datenschutz gehören nicht ins Impressum sondern in die Datenschutzerklärung, die auf einer gesonderten Seite vorgehalten werden sollte.
3. Impressum: Pflicht zur Benennung des redaktionell Verantwortlichen?
Oft werden wir von Mandanten gefragt, ob im Impressum zwingend auf den redaktionell Verantwortlichen hinzuweisen ist.
Nach § 18 Abs. 2 MStV haben Online-Händler, die journalistisch-redaktionelle Angebote bereithalten, stets einen inhaltlich Verantwortlichen in ihrem Impressum zu benennen, der für Rechtsverstöße im Zusammenhang mit der publizistischen Tätigkeit haftbar gemacht werden soll.
Aber: Rein kommerziell ausgerichtete Online-Shops und Händlerpräsenzen sind hiervon ausgenommen.
Wir empfehlen jedoch allen Mandanten, die
- Kundenbewertungen zulassen,
- einen Blog oder ein E-Magazin mit übergeordneten Themenschwerpunkten in Ihre Internetpräsenz eingegliedert haben
den "journalistisch Veranwortlichen" im Impressum zu benennen.
Hierfür kann das nachfolgende Muster genutzt werden:
„Verantwortliche/r i.S.d. § 18 Abs. 2 MStV:
Max Mustermann
Musterstraße 1
00000 Musterstadt“
Hinweis: Als Verantwortlicher darf nur eingesetzt werden, wer
- seinen ständigen Aufenthalt im Inland hat
- nicht infolge Richterspruchs die Fähigkeit zur Bekleidung öffentlicher Ämter verloren hat
- voll geschäftsfähig ist und
- unbeschränkt strafrechtlich verfolgt werden kann.
Sie sind sich unsicher, ob Sie in Ihrem Impressum den "journalistisch Verantwortlichen" zu bennenen haben? Im Zweifel, kommen Sie dem einfach nach. Dies sorgt in jedem Fall für die notwendige Rechtssicherheit, weil nach der Konzeption des MStV nur das Fehlen des Hinweises abmahnbar ist, nicht aber die inhaltlich richtige Benennung trotz eigentlich nicht bestehender Verpflichtung.
Hintergrundinformationen zum Ganzen siehe hier.
4. Angabe der WEEE-Registrierungsnummer im Impressum: verpflichtend für Hersteller von Elektrogeräten
Bereits seit dem 24.10.2015 ist das novellierte ElektroG in Kraft. Durch das neue ElektroG gibt es auch für Hersteller in Bezug auf deren Informationspflichten eine wichtige Neuerung:
Die von der Stiftung EAR dem Hersteller zugeteilte Registrierungsnummer (WEEE-Registrierungsnummer) muss seit dem 24.10.2015 vom Hersteller bereits beim „Anbieten“ genannt werden, vgl. § 6 Abs. 3 ElektroG.
Bietet der Hersteller seine Geräte über das Internet an, ist damit zwingend bereits online über die WEEE-Nummer zu informieren. Anbieten ist dabei „das im Rahmen einer gewerbsmäßigen Tätigkeit auf den Abschluss eines Kaufvertrages gerichtete Präsentieren oder öffentliche Zugänglichmachen von Elektro- oder Elektronikgeräten im Geltungsbereich dieses Gesetzes; dies umfasst auch die Aufforderung, ein Angebot abzugeben“.
Nach bisheriger Rechtslage hatten Hersteller die WEEE-Registrierungsnummer lediglich im schriftlichen Geschäftsverkehr zu führen (also etwa auf Rechnungen oder Lieferscheinen). Dies reicht nun eindeutig nicht mehr aus. Sofern Sie Hersteller im Sinne des ElektroG sind, sorgen Sie bitte umgehend dafür, dass Ihre WEEE-Nummer im Rahmen des Impressums Ihrer Onlinepräsenzen genannt wird, andernfalls besteht Abmahngefahr.
Sowohl Hersteller von Elektro- und Elektronikgeräten, als auch bloße Vertreiber, die der Rücknahmepflicht für Elektro- und Elektronikgeräte unterfallen (und damit auch der Informationspflicht) finden im Mandantenportal Muster, um die neuen Informationspflichten erfüllen zu können.
Weitere Informationen zu diesem Thema finden Sie hier.
5. Facebook: Problem mit Impressumsdarstellung
Die Einhaltung der rechtlichen Vorgaben zur Darstellung der Anbieterkennzeichnung (Impressum) war zugegebenermaßen auf Facebook nicht perfekt gelöst - aber immerhin hatte Facebook eine Möglichkeit geboten unter der Rubrik-Bezeichnung IMPRESSUM die erforderlichen Daten zu hinterlegen. Nun steht diese Möglichkeit auf Facebook scheinbar nicht mehr in allen Fällen zur Verfügung – zumindest bei der Desktop-Version ist dieser Reiter, vermutlich zurückzuführen auf ein Update von Facebook, mitunter verschwunden. Das trifft aber nach unserer Recherche nicht auf alle Facebook-Präsenzen zu.
Wir raten aus dem Grund allen Mandanten, die einen gewerblichen Facebook-Auftritt betreiben, zu überprüfen, ob das Impressum noch angezeigt wird.
Falls nicht, so wäre zumindest folgende provisorische Lösung möglich:
Im Infokasten wird ein Link hinterlegt, der deutlich auf das Impressum (der Firmen-Webseite) verweist:
- Dazu muss die "Seiteninfo" bearbeitet und hier auf das Impressum der Webseite direkt verlinkt werden.
- Dabei sollte der Link den Wortbestandteil "Impressum" enthalten
Nähere Informationen zur Vorgehensweise erhalten Sie auch hier.
Das ist zwar keine ideale Lösung, sollte aber zur Vermeidung von Abmahnung dienlich sein.
6.Keine Platzhalter im Impressum verwenden!
Das OLG Frankfurt am Main hat erst jüngst entschieden, dass keine Platzhalterangaben im Impressum gemacht werden dürfen, wie z.B. "Registernummer: HR 0000" oder "Umsatzsteuer-Identifikationsnummer: DE0000". Sofern der Seitenbetreiber hinsichtlich einzelner Angaben nicht der Impressumsangabepflicht unterliegt, darf er hierzu keinerlei Angaben machen. Es ist daher auch nicht zulässig, eine Angabe im Impressum gleichwohl zu machen und mangels Vorhandensein der Information einen Platzhalter (wie z.B. 000 oder XXX) einzufügen. Durch die Angabe eines Platzhalters kann der Verbraucher nicht darauf schließen, dass keine diesbezüglichen Daten vorliegen. Vielmehr ist eine solche Angabe mehrdeutig und führt den Verbraucher in die Irre.
Energie-Kennzeichnung
1. Seit 01.08.2017: Verschärfung der Energieverbrauchskennzeichnung in der Werbung
Der nachfolgende Hinweis betrifft alle Mandanten, die folgende Geräte verkaufen:
- Einzelraumheizgeräte
- elektrische Lampen und Leuchten
- Fernsehgeräte
- Festbrennstoffkessel und Verbundanlagen aus einem Festbrennstoffkessel, Zusatzheizgeräte, Temperaturregler und Solareinrichtungen
- gewerbliche Kühllagerschränke
- Haushaltsbacköfen und - dunstabzugshauben
- Haushaltsgeschirrspüler
- Haushaltskühlgeräte
- Haushaltswaschmaschinen
- Haushaltswäschetrockner
- Luftkonditionierer
- Raumheizgeräte, Kombiheizgeräte, Verbundanlagen aus Raumheizgeräten, Temperaturregler und Solareinrichtungen sowie von Verbundanlagen aus Kombiheizgeräten, Temperaturreglern und Solareinrichtungen
- Staubsauger
- Warmwasserbereiter, Warmwasserspeicher und Verbundanlagen aus Warmwasserbereitern und Solareinrichtungen
- Wohnraumlüftungsgeräte
Seit dem 01.08.2017 gelten für die visuell wahrnehmbare Werbung für energieverbrauchsrelevante Geräte (s.o.) verschärfte Vorgaben.
Konkret müssen Online-Händler die zwei folgenden Vorgaben beachten:
1. Vorgabe: Angabe der Energieeffizienzklasse
Ab sofort ist bei jeder visuell wahrnehmbaren Werbung oder in technischen Werbematerial für ein bestimmtes Modell die Energieeffizienklasse anzugeben - unabhängig davon, ob diese Werbung energiebezogene oder preisbezogene Informationen enthält.
Beispiel: "Energieeffizienzklasse: A"
2. Vorgabe: Angabe des Spektrums der verfügbaren Effizienzklassen
Darüber hinaus ist bei jeder visuell wahrnehmbaren Werbung oder in technischen Werbematerial für ein bestimmtes Modell nun immer auch auf das Spektrum der auf dem Energielabel verfügbaren Effizienzklassen hinzuweisen.
Beispiel: Für eine Waschmaschine mit Energieeffizienzklasse A+++ bedeutet dies, dass zusätzlich das Spektrum (A+++ bis D) der Energieeffizienklassen angegeben werden muss: "Energieeffiziensklasse A (Spektrum A+++ bis D)“
Hinweis: Unter einer visuell wahrnehmbaren Werbung sind sämtliche Formen der Online-Veröffentlichung eines Produkts zu verstehen, wenn durch die jeweilige Darstellung der Absatz der betreffenden Ware gefördert werden soll. Unter die visuell wahrnehmbare Werbung fallen z.B. Online-Banner, Artikeldetailseiten, Cross-selling-Angebote, (Offline-)Produktkataloge, Google AdWords und Darstellungen in Preisvergleichsportalen. Ob die Erwähnung eines Artikels im Rahmen einer Suchtrefferliste oder in ähnlicher Weise als Werbung im Sinne der Vorschrift angesehen werden muss, ist bislang noch nicht geklärt.
Weiterführende (wichtige !) Informationen zu diesem Thema finden Sie in diesem Beitrag.
2. Aktuell abgemahnt: Fehlende Angaben zum Spektrum bei energieverbrauchsrelevanten Produkten
Seit dem 01.08.2017 gilt die neue EU-Verordnung 2017/1369, welche für Online-Händler neue Vorgaben für die Gestaltung der Werbung mit energieverbrauchsrelevanten Produkten aufstellt - dazu gehört insbesondere auch der Hinweis auf das Spektrum der auf dem Energielabel verfügbaren Effizienzklassen. Erste Abmahnungen sind in dem Zusammenhang bereits in Umlauf.
Zur Erinnerung:
Vertreiber von energieverbrauchsrelevanten Produkten müssen ab sofort in jeder (visuellen) Werbung und in technischem Werbematerial
- sowohl die Energieeffizienzklasse,
- als auch das Spektrum der für die betreffende Ware verfügbaren Effizienzklassen angeben.
Dies gilt unabhängig davon, ob die Werbung energiebezogene oder preisbezogene Informationen enthält. Betroffene Werbemedien sollten unverzüglich überarbeitet werden, um drohende Nachteile, wie z.B. Abmahnungen, zu vermeiden.
Ausführliche Informationen zum Thema mit vielen Tipps und Umsetzungsbeispielen erhalten Sie hier.
Gerichtsstandsvereinbarungen
Immer wieder sind Gerichtsstandsvereinbarungen Anlass für wettbewerbsrechtliche Abmahnungen, da an deren Wirksamkeit komplexe rechtliche Voraussetzungen geknüpft sind. Häufig bemerken Onlinehändler gar nicht, dass sie eine derartige Vereinbarung vorhalten. Aus diesem Grund soll die grundsätzliche Problematik in diesem Beitrag einmal aufbereitet werden.
Informationspflichten
1. Auslaufmodelle: Pflicht zum Hinweis
Es stellt eine (abmahnfähige) Irreführung dar, wenn im Zusammenhang mit einem Verkaufsangebot für eine Ware verschwiegen wird, dass es sich bei der angebotenen Ware um ein Auslaufmodell handelt. Zur Erklärung - ein Auslaufmodell ist ein Gerät, das vom Hersteller nicht mehr produziert und nicht mehr im Sortiment geführt oder von ihm selbst als Auslaufmodell bezeichnet wird. Um Fehlvorstellungen hierüber beim Verbraucher zu vermeiden ist die Angabe dieses Begriffes bei einigen Produktkategorien zwingend vorgeschrieben - so etwa bei hochwertigen Geräten der Unterhaltungselektronik, wie etwa Camcorder oder Haushaltsgeräten. Bei anderen Produktgruppen hingegen ist auf die Eigenschaft als Auslaufmodell nicht hinzuweisen. In jedem Fall muss es sich natürlich stets tatsächlich um ein Auslaufmodell handeln, sofern dieser Begriff verwendet wird. Es kommt hier, wie so oft, auf den Einzelfall an.
2. Bestellvorgang: vor Abschluss wesentliche Produktmerkmale anzeigen
Abmahnfalle:
Auf der Bestellübersichtsseite im Rahmen des Bestellablaufs werden die verkaufsrelevanten Merkmale der Ware nicht angegeben.
Rechtslage
Gerade auch Betreiber von Online-Shop haben dem Verbraucher unmittelbar vor Abschluss des Bestellvorgangs spezifische Informationen, insbesondere über die wesentlichen Merkmale der Ware oder Dienstleistung, bereitzustellen. Das OLG Hamburg (Urteil vom 13.08.2014 - Az. 5 W 14/14) hatte sich mit der Reichweite dieser Hinweisobliegenheit befasst und entschieden, dass die Wesentlichkeit von Warenmerkmalen stets vom Informationsgehalt des konkret zugrunde liegenden Angebots abhängig gemacht werden muss.
Dem Urteil des Oberlandesgerichts lag die Unterlassungsklage eines Mitbewerbers gegen einen Online-Händler von Gartenartikeln zugrunde, der in seinem Shop Sonnenschirme und Zubehör verkaufte, ohne die nach Ansicht des Klägers wesentlichen Informationen beim Check-Out bereitzustellen.
Zwar hatte der Beklagte warenspezifische Angaben über Maße, Form und Farbe gemacht. Es fehlte aber an Informationen über das Material des Gestells, den Stoff und das Gewicht. Dies sei wettbewerbswidrig, so das OLG Hamburg.
Weiter Informationen zur Angabe von wesentlichen Merkmalen finden Sie hier
Rechtlicher Hintergrund: Laut "Button-Gesetz" hat der Unternehmer auf der Bestellübersichtsseite
- die wesentlichen Eigenschaften der Waren oder Dienstleistungen in dem für das Kommunikationsmittel und für die Waren und Dienstleistungen angemessenen Umfang,
- den Gesamtpreis der Waren oder Dienstleistungen einschließlich aller Steuern und Abgaben
- im Falle eines unbefristeten Vertrags oder eines Abonnement-Vertrags den Gesamtpreis
- gegebenenfalls die Laufzeit des Vertrags oder die Bedingungen der Kündigung unbefristeter Verträge oder sich automatisch verlängernder Verträge,
- gegebenenfalls die Mindestdauer der Verpflichtungen, die der Verbraucher mit dem Vertrag eingeht
anzuführen.
3. Jugendschutzbeauftragten bei jugendgefährdenden Inhalten nennen
Abmahnfalle:
Beim Verkauf von entwicklungsbeeinträchtigenden oder jugendgefährdenden Inhalte wird kein Jugendschutzbeauftragter genannt.
Rechtslage:
Seit dem 01.10.2016 ist der neue Jugendmedienschutz-Staatsvertrag (JMStV) in Kraft getreten, geschäftmäßige Anbieter (hiervon ist insbesondere auch der E-Commerce betroffen) von allgemein zugänglichen Telemedien, die entwicklungsbeeinträchtigende oder jugendgefährdende Inhalte enthalten, müssen daher darauf achten, dass diese im Zusammenhang mit der Bestellpflicht eines Jugendschutzbeauftragen insbesondere den Namen und die E-Mail-Adresse (bzw. eine sonstige schnelle elektronische Kontaktaufnahmemöglichkeit) im Rahmen der Impressumsangaben verfügbar halten, damit der Jugendschutzbeauftragte im Falle von jugenschutzrechtlichen Fragen der Seitennutzer kontaktiert werden kann.
Wenn Sie sich unsicher sind, ob Sie für Ihre Internetseite einen Jugendschutzbeauftragten benötigen, empfehlen wir unseren informativen Beitrag zur Lektüre. Gerne können Sie auch direkt mit uns Kontakt aufnehmen: info@it-recht-kanzlei.de
4. Elektrogeräte: Neue Informationspflichten für Vertreiber seit dem 25.07.2016
Diese Information betrifft alle Mandanten, die Elektro- und/ oder Elektronikgeräte – gleich ob neu oder gebraucht – (auch) an Endnutzer verkaufen oder sonst abgeben, und dabei über eine Lager- und Versandfläche für Elektro- und Elektronikgeräte von mindestens 400qm verfügen:
Sofern dies auf Sie zutrifft, müssen Sie im Rahmen Ihres Internetauftritts über die von Ihnen geschaffenen Möglichkeiten der Rückgabe von Elektroaltgeräten informieren.
Hintergrund: Mit der Novellierung des ElektroG geht die neue Pflicht des Handels, Elektroaltgeräte zurückzunehmen einher. Die für die Umsetzung dieser Verpflichtung eingeräumte Karenzzeit läuft zeitnah ab.
D.h.: Bis zum 24.07.2016 müssen Onlinehändler, die über eine Lager- und Versandfläche für Elektro- und Elektronikgeräte (maßgeblich ist also nicht die Lager- und Versandfläche für sämtliche Waren insgesamt) von mindestens 400qm verfügen, die Voraussetzung zur kostenlosen Rücknahme von Elektroaltgeräten geschaffen haben.
Konkret bedeutet dies für Online-Händler, dass diese Rücknahmemöglichkeiten für Altgeräte in zumutbarer Entfernung zu ihren jeweiligen Endkunden im gesamten Bundesgebiet nachweisen müssen. Dies gelingt in aller Regel nur durch Anschluss an ein kollektives Rücknahmesystem.
Wir empfehlen Ihnen daher, sich zeitnah einem geeigneten Rücknahmesystem anzuschließen, damit Sie Ihre Rücknahme- und Informationspflicht auch rechtzeitig erfüllen können.
Da uns immer wieder eine Vielzahl an Anfragen zu den neuen Pflichten nach dem ElektroG erreichen, haben wir Ihnen eine umfangreiche FAQ-Sammlung erstellt. Diese sind hier einsehbar.
Die IT-Recht Kanzlei stellt Ihnen zudem Muster zur Erfüllung der Online-Informationspflichten nach dem ElektroG im Mandantenportal zur Verfügung.
Bitte sorgen Sie dafür, dass Sie die neue Rücknahmepflicht für Elektroaltgeräte und die diesbezüglich bestehende Informationspflicht im Internet umsetzen, da andernfalls eine Abmahngefahr besteht.
Hinweis an Hersteller/Importeure im Sinne des ElektroG: Soweit Sie als Hersteller freiwillig eine Altgeräterücknahme anbieten, müssten Sie im Rahmen Ihrer Informationspflichten im Internet ebenfalls über die von Ihnen geschaffenen Möglichkeiten der Rückgabe von Elektroaltgeräten informieren.
Ein entsprechendes Muster zur Erfüllung der Hersteller-Informationspflichten nach dem ElektroG ist für unsere Update-Service-Mandanten hier abrufbar. Bitte beachten Sie, dass Sie dieses Muster dann noch um die Informationen zu den von Ihnen geschaffenen Möglichkeiten der Rückgabe von Elektroaltgeräten zu erweitern haben.
Jugendschutz
1. Multimediadatenträger (wie z.B. Computer- und Konsolenspiele, DVD/ Blu-Ray, etc.)
Wer Multimediadatenträger (wie z.B. Computer- und Konsolenspiele, DVD/ Blu-Ray, etc.) im Internet anbietet, muss sicherstellen, dass diese Waren ausschließlich an Personen der jeweils freigegebenen Altersstufe abgegeben werden.
Beispiele:
Bei Datenträgern, welche
- von der USK oder FSK mit einer Altersfreigabe „Keine Jugendfreigabe“ bzw. „Freigegeben ab 18 Jahren“ gekennzeichnet sind oder
- keine Alterseinstufung nach USK bzw. FSK besitzen oder
- indiziert sind,
muss der Händler beim Versand sicherstellen, dass die Ware nur an volljährige Empfänger ausgehändigt wird.
Kennzeichnungspflichten
1. Verkäufer haften für fehlende physische Kennzeichnung von Verbraucherprodukten durch den Hersteller
Der nachfolgende Hinweis betrifft alle Händler, die neue, gebrauchte oder wiederaufgearbeitete Produkte, die für Verbraucher bestimmt sind oder unter Bedingungen, die nach vernünftigem Ermessen vorhersehbar sind, von Verbrauchern benutzt werden könnten, anbieten. Das sind letztlich alle Produkte des täglichen Bedarfs.
Der BGH hat kürzlich entschieden, dass auch der (bloße) Verkäufer eines Verbraucherproduktes wettbewerbsrechtlich abgemahnt werden kann, wenn der Hersteller bei dessen physischer Kennzeichnung nach dem Produktsicherheitsgesetz (ProdSG) die gesetzlichen Anforderungen nicht eingehalten hat.
Aus juristischer Sicht muss daher Verkäufern von Verbraucherprodukten zur intensiven Vornahme von Stichproben geraten werden, ob das jeweilige Produkt selbst jeweils mit Name und Kontaktanschrift des Herstellers und einer eindeutigen Kennzeichnung zur Identifikation des Produkts versehen ist.
Werden dabei Defizite festgestellt, sollten Produkthersteller bzw. dessen Bevollmächtigter oder der Einführer umgehend zur Nachbesserung aufgefordert werden und die betroffenen Produkte solange aus dem Sortiment genommen werden. Beim Anbieten bzw. Verkauf unzureichend gekennzeichneter Verbraucherprodukte besteht Abmahngefahr.
Das ProdSG sieht mit der Regelung § 6 Abs. 1 S. 1 Nr.2 und Nr. 3 für Verbraucherprodukte eine Kennzeichnungspflicht dahingehend vor, dass diese Produkte – grundsätzlich auf dem jeweiligen Produkt selbst – mit dem Namen und der Kontaktanschrift des Herstellers oder, sofern dieser nicht im Europäischen Wirtschaftsraum ansässig ist, mit dem Namen und der Kontaktanschrift des Bevollmächtigten oder des Einführers zu kennzeichnen sind. Zudem müssen Verbraucherprodukte auch mit einer eindeutigen Kennzeichnung zur Identifikation des Verbraucherprodukts versehen werden.
Der BGH hat nun entschieden, dass der (bloße) Verkäufer eines Verbraucherproduktes im Rahmen seiner „Mitwirkungspflicht“ nach § 6 Abs. 5 ProdSG auch bloße Formalia zu prüfen hat und – hat das Verbraucherprodukt einen Kennzeichnungsmangel – dann dafür abgemahnt und auf Unterlassung in Anspruch genommen werden kann.
Obwohl die Kennzeichnung im Sinne des § 6 ProdSG grundsätzlich nicht Sache des Händlers ist, sondern bereits auf Herstellerebene zu erfüllen ist muss der Verkäufer letztlich wettbewerbsrechtlich für Versäumnisse bei der Kennzeichnung der Produkte haften.
Weitere Informationen zu dieser Thematik finden Sie hier sowie zur Kennzeichnungspflicht nach § 6 ProdSG hier.
Kostenpflichtige Rufnummern
Viele Unternehmen bieten Ihren Kundenservice bereits über eine kostenfreie Rufnummer an. Jedoch halten zahlreiche Firmen an Kundenservice-Hotlines fest, die für den Anrufer abweichend von seinem normalen Telefontarif mit zusätzlichen Kosten verbunden sind.
Die Verwendung entgeltpflichtiger Kundenservice-Hotlines ist jedoch, sofern sie die Kosten einer gewöhnlichen geografischen Festnetznummer oder einer Mobilfunknummer übersteigen (vgl. Entscheidung des LG Hamburg). Ein Verbot ergibt sich unmittelbar aus § 312a Abs. 5 BGB, der nicht erst dann einschlägig ist, wenn zusätzliche Kosten jenseits der Verbindungskosten erhoben werden.
Newsletter
1. Newsletteranmeldung: Achtung bei der Formulierung der Einwilligungserklärung
Für die Wirksamkeit der Einwilligungserklärung ist insbesondere auf deren Formulierung zu achten (beachten Sie hierzu unseren ausführlichen und informativen Beitrag). Nach neuester Rechtsprechung des BGH hält dieser es für zwingend erforderlich, dass dem potentiellen Empfänger der E-Mails klar ist, welche Produkte oder Dienstleistungen welcher Unternehmer von der Einwilligung konkret erfasst sind. Bitte kontrollieren Sie daher die Einwilligungsklauseln für Ihre Newsletteranmeldung und teilen Sie konkret mit, für welche Art von Produkten bzw. Dienstleistungen Sie im Rahmen des Newsletters werben möchten.
Tipp: Wie eine Einwilligungsklausel zur Newsletteranmeldung aussehen kann, können Sie hier erfahren.
2. Double-Opt-In-Bestätigungsmail ohne werblichen Inhalt ist trotzdem unzumutbare Belästigung, wenn..
Das AG Potsdam hatte sich mit der Frage beschäftigt, wann eine Bestätigungs-E-Mail im Rahmen des Double-Opt-In-Verfahrens unzulässig sein kann. Eine Bestätigungs-E-Mail kann nach Ansicht des Gerichts zwar frei von werblichem Inhalt sein und trotzdem als unzumutbare Belästigung zu qualifizieren sein. Wann dies der Fall sein soll und was Online-Händler hiergegen unternehmen können, lesen Sie in diesem Beitrag.
Preisangabenverordnung:
1. Der richtige Umgang mit der Angabe "inkl. MwSt." bei Kleinunternehmern und bei Differenzbesteuerung
Muss beim Kleinunternehmer bzw. im Fall der Differenzbesteuerung der Hinweis "inkl. MwSt." bzw. "inkl. USt" beim Preis angegeben werden? Bei den steuerrechtlichen Konstellationen des Kleinunternehmers und bei der Differenzbesteuerung ist bereits seit vielen Jahren strittig, ob im Rahmen der Preisangaben ein Hinweis auf die Umsatzsteuer erteilt werden muss. Wir klären unsere Mandanten nachfolgend über die Einzelheiten zu dieser Problematik auf:
Hintergrundinformationen zum Thema "Kleinunternehmer" bzw. "Differenzbesteuerung" finden Sie hier.
2. Was gilt bei Kleinunternehmern?
Vorab: Wer ist Kleinunternehmer? Wenn Sie beim Finanzamt die Einstufung als Kleinunternehmer nach § 19 UStG beantragen und das Finanzamt Sie als Kleinunternehmer anerkennt, brauchen Sie in Ihren Rechnungen keine Umsatzsteuer (= Mehrwertsteuer) auszuweisen. Sie können sich als Kleinunternehmer anerkennen lassen, wenn
- der Umsatz zuzüglich der darauf entfallenden Umsatzsteuer im vorangegangenen Kalenderjahr 22.000 Euro nicht überstiegen hat.
- der Umsatz im laufenden Kalenderjahr 50.000 Euro voraussichtlich nicht übersteigen wird.
- der Kleinunternehmer nicht nach § 19 Abs. 2 UStG zur Umsatzsteuer optiert hat.
Das OLG Hamm hatte geurteilt, dass die Angabe "inkl. MwSt." bzw. "inkl. USt." für Kleinunternehmer nicht erforderlich ist. Zu dieser "Nicht-Erforderlichkeit" der Angabe tritt noch der Umstand hinzu, dass die vorgenannten Angaben eine Irreführung bei gewerblichen Abnehmern bewirken würden.
Hieraus ist im Ergebnis zweierlei zu folgern:
- Die Angabe "inkl. MwSt." bzw. "inkl. USt." sollten Kleinunternehmer unterlassen;
- Kleinunternehmer müssen transparent auf Ihren Kleinunternehmer-Status hinweisen, sowie darauf, dass keine Ausweisung der Umsatzsteuer auf der Rechnung erfolgt.
3. Was gilt bei der Differenzbesteuerung?
Bei der Differenzbesteuerung hat bei der Preisangabe der Hinweis "inkl. MwSt." bzw. "inkl. USt." nach der Rechtsprechung des LG Hamburg zu erfolgen. Es droht allerdings dann bei dieser Angabe ein Irreführungspotential gegenüber gewerblichen Käufern, da diese angesichts der Angabe "inkl. MwSt." der fehlerhafte Vorstellung erliegen könnten, dass der genannte Preis die volle gesetzliche Umsatzsteuer enthält.
Hieraus ist im Ergebnis zweierlei zu folgern:
- Die Angabe "inkl. MwSt." bzw. "inkl. USt." haben Differenzbesteuerte beim Preis anzugeben;
- Differenzbesteuerte müssen transparent auf die Differenzbesteuerung hinweisen, sowie darauf, dass keine Ausweisung der Umsatzsteuer auf der Rechnung erfolgt.
4. Wie setzen Sie das konkret im eigenen Online-Shop, auf eBay & Amazon um?
Wir haben für Sie einen informativen Beitrag verfasst. Hier können Sie nachlesen, wie Sie die vorstehenden Angaben im eigenen Online-Shop, auf eBay & Amazon umsetzen können.
5. Grundpreise: Häufig Gegenstand von Abmahnungen
Pflicht zur Grundpreisangabe
Wenn Sie Waren nach Gewicht, Volumen, Länge oder Fläche verkaufen, dann müssen Sie Grundpreise angeben. Auch bspw. beim Verkauf von Abdeckplanen, Sicherheits- und Fangnetze, Luftpolsterfolie, Klebebänder, Klebebandrollen, Feuerlöscher, Kabeln (auch mit Steckern), Schläuchen und Rohren bzw. rohrähnlichen Produkten wie Abluftkanälen müssen Grundpreise angegeben werden.
Nach einer aktuellen Entscheidung des LG Düsseldorf sind auch Kaffeekapseln und -pads von der Grundpreisangabepflicht betroffen.
Wahrnehmung des Gesamt- und Grundpreises auf einen Blick
Der Gesamt und der Grundpreis eines Produkts müssen auf einen Blick wahrgenommen werden können. Das gilt selbstverständlich auch für "Cross-Selling-Produkte", "Produkte des Monats" etc., die häufig auf der Startseite von Online-Shops beworben werden.
Vorsicht bei Grundpreisangabe mit Bezugnahme auf die Mengeneinheit 100g / 100ml
Der IT-Recht Kanzlei liegen derzeit mehrere Abmahnungen vor, mit welchen die Bezugnahme auf eine falsche Mengeneinheit bei der Angabe des Grundpreises beanstandet wird.
Bitte beachten Sie, dass bei Waren, die gegenüber Verbrauchern in Fertigpackungen, offenen Packungen oder als Verkaufseinheiten ohne Umhüllung nach Gewicht, Volumen, Länge oder Fläche angeboten bzw. unter Angabe von Preisen beworben werden der zwingend anzugebende Preis je Mengeneinheit (=Grundpreis) unter Bezugnahme auf die Mengeneinheit 1 Kilogramm, 1 Liter, 1 Kubikmeter, 1 Meter oder 1 Quadratmeter anzugeben ist.
Für Waren, die nach Gewicht oder Volumen angeboten bzw. beworben werden und deren Nenngewicht oder Nennvolumen üblicherweise 250 Gramm oder 250 Milliliter nicht übersteigt, ist nach dem Gesetz bei der Angabe des Grundpreises ausnahmsweise als Mengeneinheit auch 100 Gramm bzw. 100 Milliliter zulässig.
Dabei ist in der Praxis leider häufig zu beobachten, dass Händler auch bei Waren mit einem Nennvolumen bzw. Nenngewicht von mehr als 250 Gramm bzw. 250 Milliliter den Grundpreis fälschlicherweise mit der Mengeneinheit 100 Gramm bzw. 100 Milliliter angeben. Eine solche Grundpreisangabe ist falsch, entspricht nicht den gesetzlichen Vorgaben und führt zu einer Abmahngefahr. Korrekt wäre bei solchen Waren die Bezugnahme auf 1 Kilogramm bzw. 1 Liter.
Praxistipp: Die Angabe des Grundpreises für Waren Nenngewicht oder Nennvolumen bis maximal 250 Gramm oder 250 Milliliter mit der Mengeneinheit 100 Gramm bzw. 100 Milliliter ist eine „Kann-Vorschrift“. Von dieser Sonderregelung muss also nicht Gebrauch gemacht werden. Sie können vielmehr auch bei diesen Waren bei der „Standard-Mengeneinheit“ 1 Kilogramm bzw. 1 Liter bleiben.
Mit anderen Worten: Wer den Grundpreis bei Waren, die nach Gewicht bzw. Volumen angeboten bzw. beworben werden mit der „Standard-Mengeneinheit“ 1 Kilogramm bzw. 1 Liter angibt macht nie etwas falsch. Die Verwendung ausschließlich der Einheiten 1 Kilogramm bzw. 1 Liter für solche Waren ist damit der einfachste Weg, da dabei nicht das Risiko besteht, versehentlich die 250 Gramm- bzw. 250 Milliliter-Grenze zu „reißen“ und damit eine falsche Bezugsgröße bei der Grundpreisangabe zu riskieren.
Sonderfall: Grundpreise müssen bei eBay in Artikelüberschrift dargestellt werden
Beim Verkauf über eBay ist darauf zu achten, dass der Grundpreis in der eBay-Artikelüberschrift angegeben werden muss, sofern eBay technisch keine andere Möglichkeit bei dem betroffenen Artikel bietet. Nur so kann derzeit beim Verkauf über die eBay-Plattform gewährleistet werden, dass die Grundpreise
- in unmittelbarer Nähe des Endpreises stehen und
- überhaupt in der eBay-Kategorieansicht dargestellt werden.
Und: Es reicht nicht aus, den Grundpreis in der Mitte oder am Ende der eBay-Artikelüberschrift zu nennen. Grundpreise sind ausnahmslos (!) am Anfang in den Artikelüberschriften darzustellen. Grund: Es gibt Ansichten auf der Plattform eBay, in denen die Artikelüberschrift nicht komplett dargestellt wird, wenn der Grundpreis nicht am Anfang der Artikelüberschrift dargestellt wird, kann es passieren, dass die Grundpreisangabe "abgeschnitten" wird.
Schon nicht mehr ausreichend ist es,
- den Grundpreis in der zweiten (kostenpflichtigen) eBay-Artikelüberschrift zu nennen
- erst in der eBay-Artikelbeschreibung auf den Grundpreis hinzuweisen.
- alleine das von eBay zur Verfügung gestellte Grundpreisangabefeld zu nutzen.
Von Abmahnungen sind derzeit insbesondere Multiauktionen auf der Verkaufsplattform eBay betroffen, bei denen der Käufer aus verschiedenen Längen des jeweils angebotenen Produkts auswählen kann. Im Rahmen von Multiauktionen bei eBay stellt sich das Problem, dass dort eine ordnungsgemäße Grundpreisangabe u.E. leider nicht zu realisieren ist. Da bei derartigen Multiauktionen zwischen verschiedenen Produkteinheiten ausgewählt werden kann (z.B. bei einem Verlängerungskabel zwischen den Längen 1 Meter, 3 Meter und 5 Meter) und in der Regel auch der Grundpreis je nach ausgewählter Produkteinheit verschieden ist, lässt sich der Grundpreis dann nicht – wie erforderlich – in der eBay-Artikelüberschrift darstellen. Daher muss bei grundpreispflichtigen Artikeln von der Nutzung solcher Multiauktionen dringend abgeraten werden, es sei denn, der Grundpreis ist je auswählbarer Produkteinheit identisch und kann daher bereits am Anfang der eBay-Artikelüberschrift dargestellt werden.
Tipp: Die von eBay zur Verfügung gestellte Möglichkeit zur Grundpreisangabe genügt nicht, da es bestimmte Einstellung gibt, in denen die Grundpreise nicht dargestellt werden, obgleich die Grundpreisangabe von eBay aktiviert ist und ein Grundpreis auch angezeigt werden müsste.
Grundpreise: Sonderfall Preissuchmaschine
Auch bei "Google-Shopping" und anderen Online-Preissuchmaschinen und/oder –Produktsuchmaschinen müssen grundpreispflichtige Produkte zwingend mit einem Grundpreis versehen sein.
Grundpreise: Problematik Warensets
Immer wieder werden wir in unserer Beratungspraxis mit der Frage konfrontiert, in welchen Fällen bei Online-Angeboten die Angabe eines Grundpreises erfolgen muss. Diese Frage stellt sich insbesondere, wenn das Angebot nicht nur einen bestimmten Artikel sondern mehrere Artikel umfasst, die im Rahmen eines Sets oder eines Bundles angeboten werden. In diesem Zusammenhang möchten wir auch auf zwei jüngere Gerichtsentscheidungen zu diesem Thema hinweisen:
So stellte das LG Koblenz mit Urteil vom 31.01.2017 (1 HK O 93/16) fest, dass es sich bei im Set angebotenen und gleich belastbaren Kabelschläuchen, die sich lediglich in Durchmesser, Materialstärken und Massen unterscheiden, nicht um „verschiedenartige Erzeugnisse“ i. S. d. § 9 Abs. 4 Nr. 2 PAngV handele, mit der Folge dass für solche Sets ein Grundpreis anzugeben sei.
Das LG Nürnberg-Fürth folgte dieser Rechtsprechungslinie kurze Zeit später (Beschluss vom 10.03.2017, 4 HK O 7319/16). Es stellte fest, dass Kartons mit mehreren Ölfarben, die farbliche Unterschiede aufwiesen, keine verschiedenartigen Produkte i. S. d. § 9 Abs. 4 Nr. 2 PAngV seien. Da sich die vom Online-Händler vertriebenen Farbtuben im Hinblick auf ihre Anwendung, Funktion und Wirkung nicht unterscheiden, seien sie nicht verschiedenartig, sondern vielmehr gleichartig. Die Folge: Aufgrund der fehlenden Verschiedenartigkeit der Farbtuben greift die Ausnahmeregelung des § 9 Abs. 4 Nr. 2 PAngV nicht. Für sie muss dementsprechend ein Grundpreis angegeben werden.
Unseren Beitrag mit einigen wichtigen Hinweisen für die Praxis finden Sie hier.
Grundpreise: Abtropfgewicht bei festen Lebensmittel
Auch zu beachten ist, dass bei festen Lebensmitteln in Aufgussflüssigkeiten (z.B. Obst oder Gemüse in Konserven oder Gläsern), die neben der Gesamtfüllmenge auch das Abtropfgewicht ausweisen, der Grundpreis auf das jeweilige Abtropfgewicht zu beziehen ist.
Grundpreise: Besonderheit bei Garne und Wolle
Sofern Sie Garne und/ oder Wolle zum Verkauf anbieten, beachten Sie bitte Folgendes:
Derzeit werden von der Wettbewerbszentrale Angebote abgemahnt, bei denen solche Waren angeboten werden, jedoch nicht das Gewicht der Ware und/ oder nicht der Grundpreis der Ware nach Gewicht angegeben wird.
Die Wettbewerbszentrale argumentiert dabei, dass die Angabe des Gewichts des Produkts bei Garnen und Wolle verkehrsüblich sei. Dem ist beizupflichten, da der Verkehr z.B. alleine anhand der Angabe der Länge des Garns / der Wolle nicht dessen/deren Qualität beurteilen kann.
Die IT-Recht Kanzlei empfiehlt daher, beim Anbieten von Garnen und/oder Wolle immer das Gewicht der Ware zu nennen und den Grundpreis nach Gewicht anzugeben.
Grundpreise: Besonderheit bei Parkett, Fliesen, Beläge
Oftmals bieten Händler
- Parketts
- Fliesen
- oder andere Bodenbeläge
in Paketen an, die eine gewisse Quadratmeterzahl abdecken und nur als solche abgenommen werden können. In dem Fall wird der Gesamtpreis als Preis pro Quadratmeter dargestellt.
Achtung, dies ist falsch und wird derzeit abgemahnt. Der Gesamtpreis hat sich zwingend auf den Paketpreis und nicht auf den Quadratmeterpreis zu beziehen. Der Grundpreis dagegen bezieht sich auf den Quadratmeterpreis, darf aber auf keinen Fall gegenüber dem Gesamtpreis hervorgehoben sein.
Sollten Sie Bodenbeläge verkaufen, dann lesen Sie dringend diesen Beitrag und überprüfen Sie, ob bei Ihren Angeboten die Gesamt- und Grundpreise korrekt dargestellt werden.
Achtung bei Suchergebnissen grundpreispflichtiger Artikel
Sofern Ihr Shopsystem im Rahmen der Ausgabe von Suchergebnissen zum jeweiligen Produkt auch einen Preis darstellt, müssen Sie bei Produkten, die der Pflicht zur Grundpreisangabe unterliegen, dafür Sorge tragen, dass im Rahmen des jeweiligen Suchergebnisses zugleich auch der Grundpreis für das Produkt dargestellt wird. Eine korrekte Grundpreisangabe auf der Kategorieseite, der Artikeldetailseite oder im Warenkorb ist dann nicht ausreichend.
Denn bereits dann, wenn Sie gegenüber Letztverbrauchern für grundpreispflichtige Waren (dies sind Waren in Fertigpackungen, offenen Packungen oder als Verkaufseinheiten ohne Umhüllung, die nach Gewicht, Volumen, Länge oder Fläche angeboten werden) unter Nennung von Preisen werben, haben Sie nach § 2 Abs. 1 S. 2 der Preisangabenverordnung den Grundpreis anzugeben.
Sofern der Grundpreis im Rahmen der Ausgabe der Suchergebnisse nicht dargestellt werden kann, muss die Angabe von Preisen in den Suchergebnissen deaktiviert werden.
Diese Falle der fehlenden Grundpreisdarstellung lauert auch im Rahmen von weiteren Shopfunktionen:
So etwa bei Galerieansichten (insbesondere auch bei eBay.de, wenn dort der Grundpreis nicht bereits ganz am Anfang der Artikelüberschrift dargestellt wird, da dort in der Galerieansicht die Artikelüberschrift oftmals abgeschnitten wird) oder bei Funktionen wie „zuletzt angesehen“ , „zu diesem Artikel passt auch …“ oder „andere Käufer kauften auch …“.
Grundpreise: Besonderheiten bei speziellen Lebensmitteln
Beim Verkauf von flüssigen Lebens- bzw. Nahrungsergänzungsmitteln in Fertigpackungen ist grundsätzlich das Volumen anzugeben, bei Fertigpackungen mit anderen Lebens- bzw. Nahrungsergänzungsmitteln das Gewicht.
(Unter Fertigpackungen versteht man Erzeugnisse in Verpackungen beliebiger Art, die in Abwesenheit des Käufers abgepackt und verschlossen werden, wobei die Menge des darin enthaltenen Erzeugnisses ohne Öffnen oder merkliche Änderung der Verpackung nicht verändert werden kann.)
Abweichend von obigem Grundsatz sind bei Lebens- bzw. Nahrungsergänzungsmitteln anzugeben:
1. Das Gewicht bei Fertigpackungen mit Honig, Pektin, Malzextrakt und zur Verwendung als Brotaufstrich bestimmtem Sirup, Milcherzeugnissen mit Ausnahme der Milchmischgetränke; bei ungezuckerten Kondensmilcherzeu gnissen, die in anderen Behältnissen als Metalldosen oder Tuben abgefüllt sind, ist das Gewicht und das Volumen anzugeben, bei Buttermilcherzeugnissen das Gewicht oder das Volumen, Essigessenz oder Würzen;
2. Das Volumen bei Fertigpackungen mit Feinkostsoßen und Senf, Speiseeis;
3. Bei Fertigpackungen mit konzentrierten Suppen, Brühen, Braten-, Würz- und Salatsoßen das Volumen der verzehrfertigen Zubereitung nach Liter oder Milliliter;
4. Bei Fertigpackungen mit Backpulver und Backhefe das Gewicht des Mehls, zu dessen Verarbeitung die Füllmenge auch noch nach der im Verkehr vorauszusehenden Lagerzeit ausreicht;
5. Bei Fertigpackungen mit Puddingpulver und verwandten Erzeugnissen sowie Trockenerzeugnissen für Pürees, Klöße und ähnliche Beilagen die Menge der Flüssigkeit, die zur Zubereitung der Füllmenge erforderlich ist;
6. Bei Fertigpackungen mit Obst und Gemüse, Backoblaten und Gewürzen die darf die Stückzahl angegeben werden , wenn die Erzeugnisse der allgemeinen Verkehrsauffassung entsprechend nur nach Stückzahl gehandelt werden;
7. Bei folgenden Lebensmitteln darf die Stückzahl angegeben werden, sofern sie in Fertigpackungen mit mehr als einem Stück abgegeben werden und die Füllmenge weniger als 100 Gramm beträgt:
- figürlichen Zuckerwaren, figürlichen Schokoladenwaren, ausgenommen Pralinen, und Dauerbackwaren mit einem Einzelgewicht von mehr als 5 Gramm;
- Kaugummi, Kaubonbons und Schaumzuckerwaren;
8. Bei Fertigpackungen mit Süßstofftabletten ist die Stückzahl anzugeben.
Variantenartikel auf eBay: Achtung bei der Grundpreisangabe
Von Abmahnungen sind derzeit insbesondere Variantenartikel auf der Verkaufsplattform eBay betroffen, bei denen der Käufer aus verschiedenen Längen, Volumen, Gewichten oder Flächen des angebotenen Produkts auswählen kann. Im Rahmen von Variantenartikeln bei eBay stellt sich das Problem, dass dort eine ordnungsgemäße Grundpreisangabe u.E. leider nicht zu realisieren ist (es sei denn, der Grundpreis für die einzelnen Varianten ist identisch). Da bei derartigen Variantenartikeln zwischen verschiedenen Produkteinheiten ausgewählt werden kann und in der Regel auch der Grundpreis je nach ausgewählter Produkteinheit verschieden ist, lässt sich der Grundpreis dann nicht – wie erforderlich – in der eBay-Artikelüberschrift darstellen.
Daher muss bei grundpreispflichtigen Artikeln von der Nutzung solcher Variantenartikel dringend abgeraten werden, es sei denn, der Grundpreis ist je auswählbarer Produkteinheit identisch und kann daher bereits am Anfang der eBay-Artikelüberschrift dargestellt werden.
Wir haben Ihnen die Problematik und Lösungswege der Grundpreisdarstellung im Rahmen von Variantenartikeln auf eBay in diesem Beitrag näher beleuchtet.
Preisaktionen
1. Verlängerung einer zeitlich befristeten Preisrabattaktion ist unzulässig
Mit Urteil vom 08.06.2017 (Az.: 1 HK O 555/17) hat das LG Würzburg entschieden, dass befristete Rabattaktionen zum mitgeteilten Endtermin grundsätzlich beendet werden müssen, sofern nicht ein plausibler, sachlicher Grund für die Verlängerung vorliegt. Das LG Würzburg stufte die Verlängerung der ursprünglich zeitlich befristeten Rabattaktion als Irreführung und damit als Wettbewerbsverstoß ein. Grund: Der Verbraucher gehe davon aus, dass die gewährten Sonderkonditionen nur innerhalb des beworbenen Zeitraumes gewährt werden würden und der Kunde daher schnell aktiv werden müsse, um in den Genuss der Sonderkonditionen zu kommen. Dies gelte insbesondere dann, wenn der Preisnachlass erheblich sei.
Auch das LG Koblenz (Urteil vom 13.12.2016, Az.: 1 HK O 26/16) hatte eine Verlängerung einer zeitlich befristeten Rabattaktion für unzulässig gehalten. Grund: Die Täuschung sei hierbei zum einen in Bezug auf die Dauer der Rabattaktion zu sehen, zum anderen liege die Irreführung in der fehlenden Absicht des Unternehmers, die Aktionsfrist einhalten zu wollen. Es entstehe hierdurch ein vermeintlicher Zeitdruck, der die Kaufentscheidung des Verbrauchers in unzulässiger Weise beeinflussen könne. Dennoch bleibt die Werbung mit befristeten Rabattaktionen grundsätzlich weiterhin zulässig, die Aktion dürfe jedoch nach Aktionsablauf, zu diesen Konditionen nicht mehr beworben und auch nicht verlängert werden.
Produktbilder
1. Produktbilder spiegeln Lieferumfang des angebotenen Produkts wieder
Das OLG Hamm hat entschieden, dass in Produktbildern das abgebildet sein muss, was auch dem Lieferumfang entspricht. Wird auf einem blickfangmäßig dargestellten Produktbild nämlich nicht zum Lieferumfang gehörendes Zubehör, etc. abgebildet, wird hierdurch ein Irrtum beim Betrachter erregt.
Um diese Irreführung auszuschließen, muss nach Ansicht des Gerichts ein klarer und unmissverständlicher (Aufklärungs-)Hinweis erteilt werden, dass das abgebildete Zubehör, etc. nicht zum Lieferumfang gehört. Dieser Hinweis muss dann allerdings seinerseits am Blickfang teilnehmen (z.B. durch Anbringung eines Sternchenhinweises, welcher räumlich nah aufgelöst wird).
Ein lediglich aufklärender Hinweis in der weiteren Produktbeschreibung, welcher nicht mit dem blickfangmäßig dargestellten Produktbild verknüpft ist, soll nach Ansicht des Gerichts nicht ausreichen.
Kein (Aufklärungs-)Hinweis ist in den folgenden Fällen notwendig:
- Der Betrachter identifiziert das auf dem Produktfoto abgebildete Zubehör, etc. eindeutig als sog. schmückendes Beiwerk, welches lediglich zu offensichtlichen Präsentationszwecken abgebildet ist (Beispiel: Neben der angebotenen Handyhülle wird ein Handy abgebildet). Bei der Beurteilung, ob etwas offensichtlich schmückendes Beiwerk darstellt, sollte man vorsichtig sein und eher einen strengen Maßstab anlegen;
- Bei der Werbung für langlebige und kostspielige Güter, bei denen davon auszugehen ist, dass sich der Betrachter vor einer geschäftlichen Entscheidung mit dem gesamten Angebotstext eingehend und nicht nur flüchtig befassen wird (Beispiel: Werbung für eine Schlafzimmerkompletteinrichtung).
Registrierungspflichten
1. Elektrogeräte
Abmahnfalle:
Händler verkaufen nicht-registrierte Elektrogeräte.
Rechtslage:
Hersteller von Elektrogeräten müssen sich nach den Vorschriften des Elektro- und Elektronikgerätegesetzes (ElektroG) vor dem Inverkehrbringen der Geräte bei der Stiftung EAR registrieren lassen. Wer dies als Hersteller versäumt, oder auch als Vertreiber zumindest fahrlässig neue Elektro- bzw. Elektronikgeräte nicht oder nicht ordnungsgemäß registrierter Hersteller anbietet, handelt wettbewerbswidrig. Kostspielige Abmahnungen sind die häufige Konsequenz. Zugleich stellt dieses Verhalten jedoch auch eine Ordnungswidrigkeit dar.
Während das UBA in der Vergangenheit allem Anschein nach nur dann gegen „Trittbrettfahrer“ vorgegangen ist, die von der Konkurrenz dort „angeschwärzt“ worden sind, zeichnet sich in den letzten Monaten ab, dass man hier nicht mehr nur auf eine Selbstregulierung des Marktes setzt, sondern nunmehr aktiv selbst gegen nichtregistrierte Hersteller von Elektro- bzw. Elektronikgeräten sowie gegen Batteriehersteller, die ihre Marktteilnahme nicht angezeigt haben, vorgeht. Die Zahl der Ratsuchenden wegen entsprechender vom UBA eingeleiteter Ordnungswidrigkeitenverfahren ist in letzter Zeit sprunghaft gestiegen,
Verhaltenskodex
Eine nicht funktionierende Verlinkung zu den Bedingungen eines Verhaltenskodex, dem ein Händler sich unterworfen hat, stellt einen abmahnbaren Wettbewerbsverstoß dar. Weitere Informationen siehe hier.
Verpackungsgesetz
1. Abmahnungen wegen fehlender Registrierung nach dem Verpackungsgesetz
Wer als Händler Verpackungen mit Ware befüllt und an Endverbraucher abgibt, ist nach geltendem Verpackungsrecht zur Registrierung und Lizenzierung des Verpackungsmaterials verpflichtet. Ausnahmen für Kleinunternehmer oder bestimmte Verpackungsarten gibt es grundsätzlich nicht. Dass diese Pflichten von vielen Händlern noch stiefmütterlich behandelt werden, machen sich gerade unter Geltung des neuen Abmahnrechts immer mehr Abmahner zu eigen. Die Nichteinhaltung der Verpackungsvorschriften ist nämlich nach wie vor wie gehabt abmahnbar.
Tipp: Das Verpackungsgesetz ist bereits seit dem 01. Januar 2019 in Kraft - doch noch immer erreichen uns viele Anfragen von Mandanten, die mit der Situation überfordert sind und nicht wissen, was als nächstes zu tun ist.
Auch wird in dem Zusammenhang häufig abgemahnt.
Wir stellen daher diesen Leitfaden zur Verfügung, der Schritt für Schritt erklärt, wie Online-Händler ihre Verpflichtung aus dem Verpackungsgesetz erfüllen können.
2. Hinweispflichten ("EINWEG", "MEHRWEG") bei pfandpflichtigen Einweg - und Mehrweggetränkeverpackungen
Das Verpackungsgesetz sieht Hinweispflichten für pfandpflichtige Einweg- und Mehrweggetränkeverpackungen vor. Diese sind auch von Online-Händlern, die entsprechende Verpackungen über das Internet an Endverbraucher vertreiben, zwingend online umzusetzen. In dem Zusammenhang wird auch immer wieder mal abgemahnt.
Umfangreiche Informationen hierzu entnehmen Sie gerne diesem Beitrag.
Versand / Versandkosten
1. Versandkostenangaben für Ausland
Abmahnfalle:
Es wird Auslandversand angeboten, ohne die jeweiligen Versandkosten zu nennen.
Rechtslage:
Im Online-Handel muss der Verbraucher klar und deutlich über anfallende Versandkosten informiert werden, dies gilt nicht nur für den Inlandsversand, sondern auch und gerade für den Versand ins Ausland.
Tipp: Wer ins Ausland liefert, muss die Versandkosten für alle (!) vom Händler belieferten Länder nennen! Vorsicht: Es ist nicht zulässig, wenn Sie Ihren Kunden auffordern, die Auslandsversandkosten erst anzufragen, wenn Sie den Versand in ein bestimmes Ausland bereits in Aussicht gestellt haben!
In zeitlicher Hinsicht muss der Kunde vor dem Einlegen der Waren in den Warenkorb die Möglichkeit erhalten, sich über etwaig anfallende Auslandsversandkosten zu informieren. Auch das OLG Frankfurt und das OLG Hamm hatten bereits entschieden, dass es sich bei der fehlenden Auslandsversandkostenangabe nicht um eine Bagatelle, sondern um einen abmahnbaren Wettbewerbsverstoß handelt.
2. Versand ins Nicht-EU-Ausland: Hinweis auf anfallende Zölle und Steuern
Auf mögliche anfallende Zusatzkosten wie z.B. Zölle und Steuern sollte der Besteller (spätestens) auf der finalen Bestellseite hingewiesen werden. Ein entsprechender Hinweis könnte wie folgt gestaltet werden:
„Bei einem Versand in das Nicht-EU-Ausland fallen im Rahmen Ihrer Bestellung zusätzlich noch weitere Steuern oder Kosten (z.B. Zölle) an, die nicht über uns abgeführt bzw. von uns in Rechnung gestellt werden, sondern von Ihnen direkt an die zuständigen Zoll- oder Steuerbehörden zu zahlen sind. Einzelheiten erfragen Sie bitte bei diesen Behörden.“
Darüber hinaus sollte der Hinweis auch bereits auf der Seite abgebildet werden, auf der die verschiedenen Zahlungsarten und Versandkosten aufgelistet sind, z.B. im Zusammenhang mit der Angabe der „Nicht-EU“-Versandkosten.
Weitere Informationen zu diesem Thema finden Sie hier.
3. Einmalige Falschlieferung von Waren kann abmahnbar sein
Nach neuester Rechtsprechung kann bereits die einmalige Falschlieferung an einen Verbraucher ein abmahnfähiger Verstoß gegen das Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb sein. Dies gilt auch dann, wenn der Versand gar nicht durch den Webshop selbst, sondern einen unabhängigen Versanddienstleister (z.B. Amazon) erfolgt. Ganz andere Probleme können zudem auftreten, wenn solche Versanddienstleister von Kunden zurückerhaltene Retouren in den Lagerbestand anderer Webshops einbuchen.
Die IT-Recht Kanzlei erläutert hier die Hintergründe.
4. Ausverkaufte Ware als „lieferbar“ anbieten
Das OLG Hamm (Urteil vom 11.08.2015, Az.: 4 U 69/15) hat entschieden, dass ein unzulässiges Lockvogelangebot vorliegt, wenn im Rahmen eines Online-Angebots der Hinweis erfolgt, dass eine Ware lieferbar sei, obwohl die so beworbene Ware tatsächlich nicht mehr lieferbar (da z.B. ausverkauft) ist.
Das OLG Hamm setzt strenge Maßstäbe an die Mitteilung der Warenverfügbarkeit und verlangt eine größtmögliche Aktualität von Internetangeboten, da der Verkehr besonders hohe Erwartungen an die inhaltliche Richtigkeit derartiger Internetangebote im Hinblick auf die Warenverfügbarkeit habe, da diese Angebote im Internet ständig aktualisiert werden könnten. Für Online-Händler empfiehlt es sich daher, ein taugliches Warenwirtschaftssystem zu verwenden, welches den tatsächlichen Lagerbestand verwaltet und eine tatsächlich nicht (mehr) lieferbare Ware gerade nicht als lieferbar im Online-Angebot ausweist.
Praxisbeispiel: Es stellt nach dem OLG Hamm ein Lockvogelangebot dar, wenn Sie z.B. ein Fahrrad als "lieferbar" bewerben, obwohl dieses spezielle Fahrradmodell nicht mehr verfügbar ist und auch nicht mehr beschafft werden kann, da es sich z.B. um ein ausverkauftes Altmodell handelt. Wenn die Ware allerdings noch beschafft werden kann, dann darf diese auch weiterhin als "lieferbar" angeboten werden, allerdings ist dann wahrheitsgemäß über die längere Lieferzeit zu informieren!
Ausführlichere Informationen zum Thema siehe auch hier: https://www.it-recht-kanzlei.de/olg-hamm-lockvogelangebot-nicht-lieferbare-ware.html
5. Werbung mit "versandkostenfrei"
Abmahnfalle:
Es wird mit dem Schlagwort "versandkostenfrei" geworben, ohne dass dies uneingeschränkt zutrifft.
Rechtslage:
Sofern der kostenfreie Versand uneingeschränkt zutrifft ist die Werbung damit selbstverständlich rechtlich unbedenklich. Aber sofern es im beworbenen Shop Ausnahmen gibt und teilweise Versandkosten erhoben werden, kann eine Werbung mit diesem Schlagwort eine wettbewerbsrechtlich relevante Irreführung darstellen. Sofern etwa Versandkosten bei Verwendung bestimmter Bezahlarten oder in bestimmte Länder erhoben werden, ist die Versandkostenfreiheit nicht vollständig mehr zutreffend. Dies kann als irreführend angesehen und abgemahnt werden.
In einem vergleichbaren Fall, in dem mit dem Schlagwort "Lieferung frei Haus" trotz Verpackungspauschale geworben wurde, hatte das OLG Hamm (Az. 4 U 31/10) eine Irreführung bejaht.
Daher empfehlen bei der Verwendung des Schlagwortes "versandkostenfrei" oä. unbedingt sicherzustellen, dass
- die Versandkostenfreiheit uneingeschränkt zutrifft oder
- bestenfalls unmittelbar bei der Werbung auf die Ausnahmen hingewiesen wird. Nicht ausreichend ist, wenn allein an anderer Stelle (etwa bei den Versandangaben) über mögliche Ausnahmen aufgeklärt wird, da dies möglicherweise die Eignung zur Irreführung nicht mehr beseitigt.
6. Werbung mit "versichertem Versand"
Abmahnfalle:
Es wird mit dem Schlagwort "versicherter" Versand geworben (Achtung: In der Praxis werden hier auch ganz beiläufige Erwähnungen des Signalwortes "versichert" abgemahnt, es muss nicht zwingend eine klassische Werbung sein)
Rechtslage:
Die ständige Rechtsprechung geht davon aus, dass die Werbung mit "versicherten Versand" im Online-Handel eine Werbung mit Selbstverständlichkeiten und damit unzulässig ist, weil das Transportrisiko bei Verbrauchsgüterkäufen schon per Gesetz den Unternehmer trifft. Nach § 474 Abs. 2 Satz 2 BGB i.V.m. § 447 BGB trägt stets der Verkäufer das Risiko des zufälligen Untergangs, der Beschädigung oder des Verlusts der Ware. Macht ein Online-Händler in seinem Angebot insofern auf diese gesetzliche Bestimmung der Risikoübernahme in einer Weise aufmerksam, die dem Kunden suggeriert, er erhalte eine zusätzliche, vom Verkäufer gewährte (besondere) Serviceleistung, stellt dies grds. eine unlautere geschäftliche Handlung dar.
Werbung
1. Streichpreise (Preisgegenüberstellung)
Abmahnfalle:
Online-Händler folgen bei der Gegenüberstellung von Preisen im Internet nicht den rechtlichen Anforderungen.
Rechtslage:
Preisgegenüberstellungen in Form von Streichpreisen sind gerade im Online-Handel ein beliebtes Mittel, um die eigenen Preise besonders attraktiv erscheinen zu lassen. Doch gibt es hierbei einige rechtliche Besonderheiten zu beachten, um nicht Opfer einer Abmahnung zu werden. In einem aktuellen Beitrag beleuchten wir die verschiedenen Formen von Preisgegenüberstellungen und zeigen deren unterschiedliche rechtliche Besonderheiten auf. Dabei gehen wir insbesondere auf folgende Formen der vergleichenden Werbung ein:
- Vergleich mit eigenen (zuvor verlangten) Preisen
- Vergleich mit der UVP des Herstellers
- Vergleich mit Preisen von Mitbewerbern
Sofern Sie mit Streichpreisen werben oder werben möchten, sollten Sie den Beitrag bitte unbedingt lesen.
Achtung, wichtiger Hinweis zur Frage, wie lange (!) eine Eigenpreisgegenüberstellung beworben werden darf:
Bei der Werbung mit einer eigenen Preisgegenüberstellung (unter Bezugnahme auf den eigenen alten Preis) ist nach der Rechtsprechung darauf zu achten, dass diese nur für eine bestimmte Zeit beworben werden darf. Die Werbung mit einer Preissenkung ist zwar grundsätzlich zulässig. Eine solche ist aber dann irreführend, wenn die Preissenkung schon derart lange Zeit zurückliegt, dass die angesprochenen Verkehrskreise über die Aktualität der Preissenkung getäuscht werden.
- Das LG München I ist der Ansicht, dass es im Rahmen des Verkaufs von langlebigen Wirtschaftsgütern im Online-Bereich bei der Preiswerbung unzulässig sei, wenn Produkte länger als vier Wochen mit einem aktuellen als "jetzt nur" bezeichneten Preis beworben werden, wenn hierbei der ehemalige Verkaufspreis gegenüber gestellt wird.
- Das LG Bochum sieht es als unzulässig an, wenn für Waren des täglichen Bedarfs mit einem Preis geworben wird, dem ein eigener ehemaliger "Statt"-Preis gegenüber gestellt wird, wenn das Verlangen des ehemaligen Preises länger als drei Monate zurückliegt.
Wir raten unseren Mandanten daher, eine Eigenpreisgegenüberstellung nur dann zu bewerben, wenn der gegenüber gestellte ehemalige Preis innerhalb der letzten vier bis sechs Wochen verlangt worden ist.
Tipp für Online-Apotheken: Online-Apotheken dürfen mit einem höheren durchgestrichenen Preis nur dann werben, wenn sie die Kunden hinreichend deutlich darauf hinweisen, was sich hinter diesem Preis verbirgt. Nicht selten wollen Online-Apotheken ihre eigenen (niedrigen) Preise mit den (teureren) sog. Apothekenverkaufspreisen (kurz: AVP, oder auch: Apothekenabgabepreis) in Vergleich setzen. Dies kann jedoch schnell problematisch sein.
Informieren Sie sich zu dem Thema hier.
2. Prüf- und Qualitätszeichen und Prüfsiegeln: Prüfkriterien angeben
Abmahnfalle:
Es werden Prüfzeichen/Prüfsiegel genutzt, ohne genauere Informationen hierzu zu nennen.
Rechtslage:
Durch eine aktuelle Entscheidung des BGH (Urteil vom 21.07.2016, Az.: I ZR 26/15) erfährt die auch bei Online-Händlern beliebte Werbung mit Prüfzeichen bzw. Prüfsiegeln eine Verschärfung der Anforderungen.
Der BGH hat entschieden, dass der Verbraucher bei einer solchen Werbung Anspruch darauf hat, dass ihm die Prüfkriterien genannt werden, ähnlich wie bereits bei der Werbung mit Testergebnissen. Der Verbraucher soll sich ein Bild davon machen können, unter welchen Aspekten und Kriterien das Produkt überprüft worden ist und welche Maßstäbe dabei angelegt wurden. Als Prüfzeichen, Qualitätszeichen oder Prüfsiegel sind grafische oder schriftliche Markierungen an Produkten oder in der Werbung für diese anzusehen, die die Einhaltung bestimmter Sicherheits- oder Qualitätskriterien anzeigen sollen und dabei in aller Regel auf die Überprüfung bzw. Überwachung durch eine dritte Stelle („Prüfstelle“) Bezug nehmen.
Generell gilt bei der Verwendung von Prüfzeichen und Prüfsiegeln nach Empfehlung der IT-Recht Kanzlei: Der Verbraucher muss zugleich darüber informiert werden, wer wann was wie worauf geprüft hat. Insbesondere müssen mit dem BGH nun dem Verbraucher die Prüfkriterien im Rahmen der Werbung genannt bzw. zumindest entsprechend deutlich verlinkt werden. Hierbei kann auch deutlich auf die Seite des Prüfunternehmens verwiesen werden, etwa auf häufig angebotene Zertifikatsdatenbanken.
Auch sollte dabei darauf hingewiesen werden, wer Inhaber des entsprechenden Zertifikats ist bzw. wem die Benutzung entsprechender Zeichen gestattet worden ist (regelmäßig nicht der Händler, sondern der Hersteller), Details hierzu genannt werden (z.B. Zertifikatsnummer oder Nummer des Zeichenbenutzungsvertrags) und eine Möglichkeit genannt werden, wie der Verbraucher von der Prüfstelle weitere Informationen erhalten kann (Angabe der Kontaktdaten der Prüfstelle wie Anschrift und Telefonnummer oder E-Mailadresse).
3. Nutzung einer Weiterempfehlungsfunktion („Tell-a-Friend“)
Abmahnfalle:
Online-Händler nutzen eine Weiterempfehlungsfunktion.
Rechtslage:
Eine Weiterempfehlungsfunktion in einem eigenen Onlineshop bzw. auf einer eigenen Webseite sollte dauerhaft entfernt werden.
Die klassische „Tell-a-Friend“-Funktion, bei der der Händler dem Nutzer ein Online-Formular zur Eingabe der Empfänger-Email-Adresse zur Verfügung stellt und bei der die Empfehlungs-Email dann über den Webserver des Händlers bzw. seines Dienstleisters an einen Dritten versendet wird, hat aufgrund der restriktiven BGH-Rechtsprechung (vgl. Urteil vom 12.09.2013 - I ZR 208/12) ausgedient. Diese Funktion führt dazu, dass der Händler in rechtlicher Hinsicht „Spam“ an den Empfehlungsempfänger versendet, was klar abmahnbar ist.
Auch eine sog. „Mail-to“-Funktion (bei dieser „Mail-to“-Funktion wird eine Nachricht nicht über den Server der Plattform bzw. des Online-Shopsystems versendet, da diese „Mail-to“-Funktion das E-Mailprogramm des empfehlenden Nutzers öffnet, die versendete E-Mail wird sodann direkt vom E-Mailprogramm des Empfehlenden aus versendet) ist nach Auffassung des LG Hamburg als unzulässige Werbemaßnahme zu qualifizieren. Wir raten daher bis zur verbindlichen Klärung der Zulässigkeit der „Mail-to“-Funktion von der diesbezüglichen Verwendung ab.
Hinweis: Hinweis zu den Verkaufsplattformen Amazon.de und eBay.de:
In Bezug auf die früher von Amazon auf dem Marketplace bei Amazon.de vorgehaltene Weiterempfehlungsfunktion wurde bereits mehrfach gerichtlich festgestellt, dass deren Gestaltung wettbewerbswidrig und abmahnbar ist. Wohl nicht zuletzt, weil auch die Marketplace-Händler für diese Funktion seitens Amazon haften und vermehrt abgemahnt wurden, hat Amazon diese Funktion zwischenzeitlich „entschärft“. Nunmehr wird auf den Plattformen eBay und Amazon mit der „Mail-to“-Funktion gearbeitet, nach Auffassung des LG Hamburg sei dies allerdings unzulässig. Wir werden Sie über die weitere Entwicklung auf dem Laufenden halten, eine Änderung der Weiterempfehlungs-Funktion auf Amazon und eBay ist für Händler derzeit nicht möglich. Auf die Weiterempfehlungsfunktionen bei Amazon.de und eBay.de wird hier näher eingegangen.
4. Werbung mit Testergebnissen
Abmahnfalle:
Online-Händler folgen bei der Werbung mit Testergebnissen nicht den rechtlichen Anforderungen.
Rechtslage:
Derzeit wird wieder vermehrt im Bereich Werbung mit Testergebnissen abgemahnt - dabei geht es um die fehlerhafte Darstellung von Testergebnissen. In diesem Zusammenhang weisen wir darauf hin, dass bei der Werbung mit Testergebnissen insbesondere folgendes beachtet werden sollte:
Es muss klar ersichtlich sein, wer den Test wann durchgeführt hat - es muss insofern klar die Fundstelle ersichtlich sein und es sollte sich um einen aktuellen Test handeln, d.h. es sollte kein neueres Prüfungsergebnis vorliegen. Zudem muss der Test ganz konkret auf das beworbene Produkt Bezug nehmen und es sind generell die Bedingungen des Testunternehmens einzuhalten. Im Zweifel lassen Sie Ihre Werbung bitte anwaltlich prüfen.
Hier finden Sie umfangreiche Rechtsprechung zum Thema:
- Verpflichtung zur Kenntlichmachung des Rangs des Testergebnisses
- Ein Testsieger muss auch tatsächlich ein Testsieger sein
- Bei Werbung mit "Testsieger" darf die Fundstelle nicht fehlen bzw. muss lesbar sein
- Einzelbewertung ungleich Gesamtbewertung
- Bewertung "gut" ohne Verweis auf Magazinausgabe abmahnbar
- Werbung mit 15 Jahre alten Testergebnis kann wettbewerbswidrig sein
- Testverfahren darf sich zwischenzeitlich nicht geändert haben
- Werbung mit überholtem Testergebnis unzulässig
- Lesbarkeit der Fundstellenangabe bei Werbung mit Testergebnissen - mindestens 6-Punkt-Schrift
- Auf den Inhalt kommt es an, nicht die Verpackung – selbst wenn diese Teil des Tests war
- Unzulässige Werbung mit Testsiegel, sollte sich das Siegel nicht auf ein baugleiches Gerät beziehen.
5. Werbung mit einer Allein- oder Spitzengruppenstellung
Derzeit werden vereinzelt sog. Alleinstellungs- bzw. Spitzengruppenstellungsbehauptungen abgemahnt. Eine Alleinstellungswerbung liegt dann vor, wenn der Werbende allgemein oder in bestimmter Hinsicht für sich allein eine Spitzenstellung auf dem Markt in Anspruch nimmt. Hingegen liegt eine Spitzengruppenwerbung vor, wenn der Werbende nicht für sich allein, sondern mit anderen Erzeugnissen oder Leistungen von Wettbewerbern eine Spitzenstellung in Anspruch nimmt, also die Zugehörigkeit zu einer speziellen Spitzengruppe behauptet.
Eine wettbewerbsrechtliche Irreführung ist im Falle einer Alleinstelungs bzw. Spitzengruppenstellungsbehauptung ist nur dann ausgeschlossen, wenn diese Behauptung (aufgrund objektiv nachprüfbar Kriterien) wahr ist. Allerdings genügt für eine Alleinstellungsbehauptung nicht, dass der Werbende einen nur geringfügigen Vorsprung vor seinen Mitbewerbern hat, vielmehr erwartet der Verbraucher bei einer solchen Werbung eine nach Umfang und Dauer wirtschaftlich erhebliche Sonderstellung. Der Werbende muss einen deutlichen Vorsprung gegenüber seinen Mitbewerbern haben und dieser Vorsprung muss die Aussicht auf eine gewisse Stetigkeit bieten.
So hatte bereits das Landgericht Stuttgart entschieden, dass die Werbung mit einer preisbezogenen Spitzenstellungsbehauptung "Wir haben den tiefsten Preis" nur dann als zulässige Werbeaussage anzusehen ist, wenn tatsächlich der günstigste Preis angeboten wird, und dieser Unterschied auch erheblich und dauerhaft gegenüber der Konkurrenz gegeben sind.
Weitere Informationen erhalten Sie in unserem informativen Beitrag zu diesem Thema!
6. Verlängerung einer zeitlich befristeten Preisrabattaktion ist unzulässig
Nach der aktuellen Rechtsprechung des LG Hamburg ist davon auszugehen, dass eine (nachträgliche) Verlängerung einer zeitlich befristeten Preisrabattaktion unzulässig ist. Begründet wird die Unzulässigkeit dieser nachträglichen Verlängerung damit, dass in solch einem Fall eine Irreführung des Kunden vorliegt, da der Kunde sich aufgerufen fühlt, unter Zeitdruck eine Entscheidung darüber zu treffen, ob er von einem befristeten Angebot Gebrauch machen soll, während dieser Zeitdruck tatsächlich in diesem Umfang tatsächlich nicht besteht (da die Aktion verlängert wird und damit mehr Zeit zur Überlegung zur Verfügung steht).
Der BGH liegt dann eine Irreführung (und damit eine unlautere Handlung) vor, wenn der Online-Händler bereits bei Erscheinen der Werbung die Absicht hat, die Rabattaktion zu verlängern, dies aber in der Werbung nicht hinreichend deutlich zum Ausdruck bringt.
Anders herum gilt allerdings: Wird die Rabattaktion aufgrund von Umständen verlängert, die nach dem Erscheinen der Werbung eingetreten sind, ist danach zu unterscheiden,
- ob diese Umstände für das Unternehmen unter Berücksichtigung fachlicher Sorgfalt voraussehbar waren und
- deshalb bei der Planung der befristeten Aktion und der Gestaltung der ankündigenden Werbung berücksichtigt werden konnten.
Damit kann unter den vorbenannten Voraussetzungen ausnahmsweise einmal eine zulässige Verlängerung einer befristeten Rabattaktion vorliegen, hierbei sollte jedoch ein enger und strenger Maßstab angelegt werden!
Wichtig zu wissen: Der wirtschaftliche Erfolg einer solchen Rabattaktion gehört nicht zu den Gründen, die nach der Verkehrsauffassung eine Verlängerung der Rabattaktion nahelegen können!
7. Finanzierungen
Mit Urteil vom 30.04.2015 (Az.: I-15 U 100/14) hat das OLG Düsseldorf entschieden, dass in Anzeigen, die für Produkte eine Finanzierungsmöglichkeit ausweisen, nach §5a Abs. 3 Nr. 2 UWG zwingend auch der Name und die Anschrift der finanzierenden Bank anzuführend sind.
Jede Werbung, die eine Finanzierungsmöglichkeit mit Ratenzahlungen für bestimmte Produkte vorsieht, muss zwingend auch den Namen und die Anschrift der Bank anführen, die das Darlehen gewährt, und zwar unabhängig von der Entgeltlichkeit des beworbenen Finanzdienstleistungsvertrags.
Händler, die Verbrauchern für bestimmte Produkte die Möglichkeit einer Kaufpreisfinanzierung über ein Kreditinstitut gewähren und darauf in ihrer Werbung hinweisen, müssen damit im gleichen Zuge stets den Namen und die Anschrift des Darlehensgebers angeben.
8. Werbung in "No Reply" Bestätigungsmails
Oftmals versenden Online-Händler automatisierte E-Mails (sog. Auto-Reply-Nachrichten) oder Bestätigungs-E-Mails im Rahmen eines Double-Opt-In-Verfahrens zur Newsletteranmeldung. Hierbei muss dringend darauf geachtet werden, dass in diesen Nachrichten selbst keine Werbung (wie z.B. Artikelangebote des Händlers, Veranstaltungshinweise, Sonderangebote, etc.) enthalten ist. Grund: Auch diese Werbung darf nur dann an den Betroffenen versandt werden, wenn dieser zuvor in die Übersendung von Werbenachrichten eingewilligt hat.
In diesem Zusammenhang werden immer wieder Händler abgemahnt. Näheres zu diesem Thema können Sie in diesem Beitrag erfahren.
9. Werbung mit nicht existierender, veralteter oder falscher UVP
Die Werbung mit einer Preisersparnis gegenüber einer unverbindlichen Preisempfehlung des Herstellers (UVP) ist ein beliebtes Werbemittel. Aufgrund zahlreicher aktueller Fälle weisen wir darauf hin, dass die Online-Werbung mit einer veralteten, falschen oder nicht existenten unverbindlichen Preisempfehlung des Herstellers den Verbraucher in die Irre führt und somit wettbewerbswidrig ist.
Unzulässig ist demnach die Verwendung die Verwendung einer
- falschen oder veralteten UVP sowie
- eine nicht existente UVP.
Die Wettbewerbszentrale weist darauf hin, dass Werbemaßnahmen mit einer Preisersparnis gegenüber einer (falschen, veralteten oder nicht existierenden) UVP nicht nur geeignet sind, Verbraucher in ihrer Kaufentscheidung zu beeinflussen, sondern verschaffen den werbenden Unternehmen auch einen Vorsprung im Wettbewerb gegenüber den gesetzestreuen Wettbewerbern.
Sollten Sie mit einer UVP werben, müssen Sie die Aktualität und Höhe der UVP unbedingt überprüfen und laufend aktuell halten! Ein Hinweis auf eine ehemaligen unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers ist dann nicht irreführend, wenn diese als solche kenntlich gemacht wird (durch Verwendung des aufklärenden Hinweises "ehemalige UVP") und früher auch diese unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers tatsächlich bestanden hat. Weitere Informationen zur Werbung mit einer UVP des Herstellers finden Sie in unserem Beitrag.
10. Achtung bei der Versendung von Bewertungsanfragen (sog. Feedbackanfragen)
Viele Online-Händler versenden elektronische Bewertungsanfragen (Feedbackanfragen), also E-Mails an Kunden, die (gerade) ein Produkt gekauft haben, entweder unmittelbar nach dem Kauf oder einige Tage oder Wochen später mit der Bitte, das gekaufte Produkte und/oder den Webshop zu bewerten.
Das OLG Dresden und jüngst erst das KG Berlin (weitere Informationen zur Entscheidung des KG Berlin können Sie hier abrufen) haben entschieden, dass das Versenden von Kundenzufriedenheitsanfragen (sog. Feedbackanfragen) als unerlaubte E-Mail-Werbung einzustufen und unzulässig ist, wenn der betroffene Empfänger in den Versand dieser Kundenzufriedenheitsanfrage nicht zuvor ausdrücklich eingewilligt hat! Derartige Feedbackanfragen sind als Werbung anzusehen, da diese dazu dienen, künftig weitere Produkte abzusetzen. In der Konsequenz dürfen Kunden nur dann zum Zwecke einer Feedbackanfrage kontaktiert werden, wenn diese im Vorfeld (etwa im Rahmen des Registrierungs- oder Bestellprozesses) die ausdrückliche Einwilligung erteilt hatten.
Tipp: Sie möchten an Ihre Kunden Feedbackanfragen versenden? Sie können Ihre "Datenschutzerklärung mit Einwilligung Deutsche Sprache" für den eigenen Online-Shop so konfigurieren, dass eine entsprechende Datenschutzklausel für die Feedbackanfragenübersendung ermöglicht wird, bitte beachten Sie darüber hinaus die bei der Konfigurationsmöglichkeit mitgeteilten Hinweise für die zwingende Einbindung einer gesonderten Einwilligungseinholung!
Achtung: Das Übersenden von Kundenzufriedenheitsanfragen ist nicht möglich, wenn Sie Waren über Verkaufsplattformen (wie z.B. eBay, Amazon, etc.) vertreiben, da es Ihnen hier nicht möglich ist, eine wirksame Einwilligung in die Übersendung einer Kundenbewertungsanfrage einzuholen.
11. Werbung mit Auszeichnungen
Beachten Sie, dass Sie bei der Bewerbung von Auszeichnungen dieselben Regeln beachten müssen, die auch für die Werbung von Testergebnissen gelten.
Das bedeutet: Das LG Karlsruhe (Urteil vom 08.11.2016, Az.: HK O 2/15) hatte festgehalten, dass das Gebot der fachlichen Sorgfalt erfordere, dass mit Auszeichnungen nur dann geworben werden darf, wenn dem Verbraucher dabei die Fundstelle bzw. nähere Quellhinweise auf die Auszeichnung leicht auffindbar angegeben werden. Eine leichte Auffindbarkeit setzt wiederum voraus, dass der Text für einen normalsichtigen Betrachter ohne besondere Konzentration und Anstrengung lesbar ist.
12. Kundenzufriedenheitsanfrage via Rechnungsmail: nur mit Einwilligung
Gute Kundenbewertungen sind oft das Zünglein an der Waage, wenn es darum geht den Kunden für sich zu gewinnen. Umso mehr begeben sich Händler auf Bewertungsfang. Aber Vorsicht: Wer zur Abgabe einer Kundenzufriedenheitsanfrage beim Kunden proaktiv anfragen will, der muss sich an bestimmte Regeln halten. Denn: Die Kundenzufriedenheitsanfrage per E-Mail stellt Werbung dar, welche nur dann an den betreffenden Kunden übersendet werden darf, wenn diesbezüglich vorab eine ausdrückliche Einwilligung des Kunden eingeholt wurde.
Dies gilt auch für den Fall, dass diese Anfrage in der Rechnungsmail an den Kunden verpackt wird.
13. Werbung in E-Mail-Signatur ist unzulässig
Das AG Bonn entschied, dass Werbung in der E-Mail-Signatur eine unzulässige Werbung (Spam) darstellt, wenn keine Einwilligung des betroffenen Empfängers vorliege. Im konkreten Fall ging es um eine E-Mail, die in der Signaturzeile zur Teilnahme an Kunden-Zufriedenheitsumfragen aufforderte und für aktuelle Handys, Tarife und persönliche Produktempfehlungen warb.
Nach der Rechtsprechung des BGH ist in einer E-Mail alles als Werbung anzusehen, was das Ziel, den Absatz von Waren oder die Erbringung von Dienstleistungen unmittelbar oder mittelbar fördert. Kundenzufriedenheitsanfragen und Hinweise auf das eigene Produkt- bzw. Dienstleistungssortiment sind unstreitig Werbung. Was allerdings noch nicht geklärt ist, ob auch der Hinweis auf die eigene Internetpräsenz (per Domainnennung), die Newsletter-Bestellmöglichkeit oder ein Firmenlogo in der E-Mail-Signatur als unzulässige Werbung anzusehen ist. Zumindest hinsichtlich des zuletzt genannten Logos in der Signatur hatte das AG Frankfurt am Main geurteilt, dass hierin keine Werbung zu sehen soll.
Wir raten unseren Mandanten daher, keine Werbung in die E-Mails an Kunden zu platzieren (sofern keine Werbe-Einwilligung vorliegt), dies gilt auch und vor allem für
- die Signatur der eigenen E-Mail-Nachrichten,
- „auto-reply“-Nachrichten und
- Double-Opt-In-Nachrichten
Weitere Informationen zum Thema "Werbung in E-Mail-Signaturen" können Sie hier nachlesen.
14. Kaufabbruch-E-Mails kein zulässiges Werbemittel
Die werblichen Vorteile von Kaufabbruch-E-Mails wird durch das ihnen immanente Abmahnrisiko erheblich abgewertet.
Mailbenachrichtigungen, die nach erfolgter Erhebung der elektronischen Postadresse im Bestellprozess versendet werden, weil der Verbraucher den Kaufvorgang nicht zu Ende geführt hat, sind nach klarer gesetzlicher Wertung immer dann unzulässiger Spam, wenn keine vorherige ausdrückliche Einwilligung eingeholt worden ist. Zwar kommt nach § 7 Abs. 3 UWG auf den ersten Blick eine die Einwilligung entbehrlich machende Freistellung in Betracht. Diese muss aber daran scheitern, dass bei vorzeitigem Abbruch der Bestellung der erforderliche Zusammenhang mit dem Kauf von Waren- oder Dienstleistungen fehlt.
Weitere Informationen s. hierzu diesen Beitrag.
Widerrufsbelehrung
1. Nicht korrekt formatierte Widerrufsbelehrung bzw. Muster-Widerrufsformular
Stellen Sie sicher, dass Sie die Widerrufsbelehrung und das Muster-Widerrufsformular mit der korrekten Formatierung (vor allem die Absätze) auf Ihre Onlinepräsenzen übernehmen, so wie Ihnen diese Dokumente im Mandantenportal angezeigt werden.
Uns liegen mehrere Abmahnungen vor, die gerade die fehlende Formatierung der Widerrufsbelehrung bzw. des Widerrufsformulars zum Gegenstand haben, da diese Texte lediglich als Fließtext dargestellt worden waren ohne die vorgesehenen Absätze.
Leider kommt es bei Nutzung bestimmter Texteditoren bzw. Zeichensätze hier immer wieder dazu, dass Überschriften und Leerzeilen bei der Übernahme der Texte entfallen.
Insbesondere bei der Überprüfung von Angeboten bei eBay.de stellen wir häufig fest, dass dort die Widerrufsbelehrung ohne jede Formatierung hinterlegt wurde, also ohne (Zwischen)Überschriften und Leerzeilen als bloßer Fließtext ohne Absätze. Ebenso wird dort das Muster-Widerrufsformular teilweise als bloßer Fließtext unformatiert und ohne die auszufüllenden Zeilen dargestellt.
Werden diese zwingenden Verbraucherinformationen ohne Formatierung als bloßer Fließtext dargestellt, besteht vor allem aktuell Abmahngefahr. Der Unternehmer muss diese Informationen nämlich in klarer und verständlicher Weise zur Verfügung stellen, was bei einem langen Fließtext nicht mehr der Fall sein könnte (so etwa LG Ellwangen, Beschluss vom 07.04.2015, Az.: 10 O 22/15).
Wenn Sie hier unsicher sein sollten, gehen Sie bitte wie folgt vor:
Loggen Sie sich bitte in Ihr Mandantenportal ein, wählen dort unter der Rubrik der jeweils geschützten Präsenz das Dokument „Widerrufsbelehrung" (zu finden in der rechten Navigationsleiste unter dem Punkt "Widerrufsbelehrung“) aus und lassen sich dieses im PDF-Format oder als txt.-Datei anzeigen.
Prüfen Sie anschließend, ob sich die Formatierung von Widerrufsbelehrung und Muster-Widerrufsformular auf Ihrer Onlinepräsenz mit derjenigen im PDF-Dokument bzw. Textdokument deckt und übernehmen die Texte ggf. erneut in der korrekten Formatierung bzw. stellen die Formatierung manuell her.
Hinweis: Auf vielen Plattformen lassen sich die Überschriften nicht gefettet darstellen, was jedoch unkritisch ist.
2. Fehlende Telefonnummer in Widerrufsbelehrung
Aktuell werden Händler abgemahnt, die in ihrer Widerrufsbelehrung keine Telefonnummer hinterlegt haben. Bitte beachten: Es handelt sich bei der Angabe der Telefonnummer in der Widerrufsbelehrung tatsächlich nicht um eine freiwillige Information, sondern um eine rechtliche verpflichtende.
3. In das Muster-Widerrufsformular gehört keine Telefonnummer
In letzter Zeit häufen sich Abmahnungen wegen der Nennung einer Telefonnummer des Händlers im Rahmen des Muster-Widerrufsformulars.
Hintergrund ist, dass die gesetzliche Vorlage für das Muster-Widerrufsformular keine Angabe einer Telefonnummer des Händlers im Formular vorsieht (da das Formular ja nicht per Telefon an den Händler übermittelt werden kann).
Von daher rät die IT-Recht Kanzlei dringend davon ab, im Rahmen des Muster-Widerrufsformulars eine Telefonnummer anzugeben.
Selbstverständlich ist das Muster-Widerrufsformular, welches Ihnen von der IT-Recht Kanzlei zur Verfügung gestellt wird, von dieser Problematik nicht betroffen. Im eigenen Interesse sollten Sie aber in jedem Fall prüfen, ob Sie ggf. an anderer Stelle ein Widerrufsformular im Einsatz haben, welches eine Telefonnummer beinhaltet und diese dann entfernen.
Weitere Details finden Sie in diesem Beitrag.
Achtung:
- (Firmen)Name und Anschrift sowie Email-Adresse sind dagegen zwingend im Muster-Widerrufsformular anzugeben, ebenso eine Telefaxnummer, wenn Fax vorhanden.
- In der Widerrufsbelehrung selbst (das Muster-Widerrufsformular ist ein weiteres Dokument, welches bei der von der IT-Recht Kanzlei zur Verfügung gestellten Widerrufsbelehrung unterhalb dieser angehängt ist) muss dagegen zwingend auch eine Telefonnummer genannt werden (dort neben (Firmen)Name und Anschrift sowie Email-Adresse und Telefaxnummer, wenn Fax vorhanden)!
4. Bei eBay: Widersprüchliche Angaben zu Widerrufsfrist
Es geht um widersprüchlichen Angaben zur Widerrufsfrist auf eBay. Das wird immer wieder falsch gemacht: In der Widerrufsbelehrung des Händlers steht eine bestimmte Frist und in dem von eBay vorgegebenen Feld zur Widerrufsfrist steht eine andere Frist. Am Ende weiß der Verbraucher natürlich nicht welche Frist gilt - und das führt dann aus Irreführungsgründen zu entsprechenden Abmahnungen.
Zahlung / Zahlungsarten
1. Seit dem 13. Januar 2018 gilt: Aufschläge für Überweisungen, Lastschriften, Visa und Mastercard verboten
Händler dürfen in Zukunft keine gesonderten Gebühren mehr für Kartenzahlungen, Überweisungen und Lastschriften verlangen. Auch kostendeckende Aufschläge dürfen nicht mehr erhoben werden.
Welche praktischen Konsequenzen dies für Händler hat und welche Zahlungsmittel konkret betroffen sind, erfahren Sie in diesem Beitrag.
Uns liegen bereits Abmahnungen vor, die sich auf dieses Thema beziehen - erste gerichtliche Entscheidungen zu den Streitpunkten der neuen Regelung, wie etwa der Nachnahmegebühr, werden aber noch eine Weile dauern.
2. Betrifft Online-Shops: Zumindest ein zumutbares unentgeltliches Zahlungsmittel ist anzubieten
Das LG Frankfurt hat kürzlich entschieden, dass Verbraucher zumindest eine zumutbare Möglichkeit haben müssen, ohne Zusatzkosten zu bezahlen.
Beispiele für gängige und zumutbare Zahlungsmöglichkeiten sind
- Barzahlung oder
- Zahlung mit EC-Karte oder
- Überweisung auf ein Bankkonto oder auch
- Einziehung vom Bankkonto des Verbrauchers.
(Kreditkarten sind nur dann zumutbare Zahlungsmöglichkeiten, wenn ihr Einsatz in der Situation weithin üblich ist und mehrere am Markt verbreitete Kredit- und Zahlungskarten unentgeltlich eingesetzt werden können.)
Zumindest eine der vorgenannten Zahlungsarten haben Sie - ohne Zahlungsaufschlag - in Ihrem Online-Shop anzubieten.
Wichtig:
Als einziges unentgeltliches Zahlungsmittel dürfen nicht angeboten werden:
Ungeläufige Kreditkarten, wie etwa Visa Electron und Mastercard Gold. (OLG Dresen: Urteil vom 03.02.2015, Az. 14 U 1489/14)
Fragen zum Beitrag? Diskutieren Sie hierzu gerne mit uns in der Unternehmergruppe der IT-Recht Kanzlei auf Facebook.
Link kopieren
Als PDF exportieren
Per E-Mail verschicken
Zum Facebook-Account der Kanzlei
Zum Instagram-Account der Kanzlei






0 Kommentare