Textilkennzeichnung 2026: Der Leitfaden für Online-Händler

Die Textilkennzeichnung richtig umsetzen: Beim Verkauf von Kleidung und Textilien reicht ein schönes Produktfoto nicht aus – auch die Materialangaben müssen stimmen. Unser Leitfaden bietet kompakte Infos, viele Beispiele und Tipps für die Praxis.
Inhaltsverzeichnis
- Einstieg und Grundlagen
- 1. Rechtstexte für abmahnsicheren Textilverkauf
- 2. Zweck und Ziel der EU-Textilkennzeichnung
- Geltungsbereich: Was muss gekennzeichnet werden?
- 1. Welche Textilerzeugnisse unterliegen der Textilkennzeichnungspflicht?
- 2. Was sind echte Textilerzeugnisse?
- 3. Was sind gleichgestellte Erzeugnisse?
- 4. Welche Textilerzeugnisse und Bestandteile müssen nicht gekennzeichnet werden?
- Verantwortlichkeiten und Pflichten der Marktakteure
- 1. Textilkennzeichnung: Verantwortung und Kontrollpflicht der Händler
- 2. Verantwortlichkeit und zusätzliche Herstellerkennzeichnung
- Grundregeln der Faserbezeichnungen und Kennzeichnung
- 1. Welche Regeln sind bei der Textilkennzeichnung zwingend?
- 2. Welche Bezeichnungen von Textilfasern sind erlaubt?
- 3. Wie sind die Faserbezeichnungen korrekt zu verwenden?
- 4. Dürfen Abkürzungen (z. B. CO, PES) verwendet werden?
- Spezielle Regeln für Fasertypen und Toleranzen
- 1. Wie müssen Wolle, Seide und Tierhaare gekennzeichnet werden?
- 2. Textilkennzeichnung: Reine Erzeugnisse & die Toleranzgrenzen
- 3. Sonderbezeichnungen (Seide, Schurwolle, Halbleinen)
- Textilkennzeichnung: Regeln für Mischungen (Multifaser/Mehrkomponenten)
- 1. Unterschied zwischen Multifaser- und Mehrkomponenten-Erzeugnissen
- 2. Kennzeichnung von Multifaser-Textilerzeugnissen
- 3. Kennzeichnung von Mehrkomponenten-Textilerzeugnissen
- Ergänzende Regeln & Spezifische Produkte
- 1. Kennzeichnung komplexer Textil-Strukturen
- 2. Deklaration von Fremdmaterialien
- 4. Sonderkennzeichnung für Formaldehyd-behandelte Textilien
- 5. Kennzeichnung von PVC-Fasern (Polyvinylchlorid)
- 6. Regeln für Lederimitate und Kunstleder
- 7. Vereinfachte Kennzeichnung im Verkauf
- Textilkennzeichnung: Anbringung der Faserzusammensetzung am Textilerzeugnis
- 1. Pflicht und Art der Kennzeichnung
- 2. Zwingende Anforderungen an die Form der Kennzeichnung
- 3. Zulässige Formen der Anbringung der Textilkennzeichnung
- 4. Platzierung der Kennzeichnung
- 5. Unzulässige Formen
- 6. Ausnahmefälle: Kennzeichnung auf der Verpackung
- Zusätzliche Hersteller-Kennzeichnung (Produktsicherheitsverordnung)
- Online-Kennzeichnung und Sprachvorgaben
- 1. Ist die Textilkennzeichnung online und in Katalogen Pflicht?
- 2. Online-Platzierung: Wo müssen die Pflichtangaben im Webshop stehen?
- 3. Gelten die Kennzeichnungspflichten auch für "upgecycelte Textilien"?
- 4. In welcher Amtssprache muss online gekennzeichnet werden?
- 5. Ist ein mehrsprachiges Etikett zulässig?
- Preisangabenverordnung und Grundpreise im Textilhandel
- 1. Grundsatz: Pflicht zur Angabe des Grundpreises
- 2. Ausnahme: Identität von Gesamt- und Grundpreis
- 3. Maß- und Mengeneinheit
- 3. Grundpreise bei Produkt-Sets und Kombinationen
- 4. Grundpreisangabe im Online-Handel
- Abmahngründe und Stolperfallen der Textilkennzeichnung
- 1. Sind Verstöße gegen die Textilkennzeichnungsverordnung abmahnfähig?
- 2. Häufigste Abmahngründe
- 3. Grauzonen und Zusätze
Einstieg und Grundlagen
1. Rechtstexte für abmahnsicheren Textilverkauf
Grundvoraussetzung für den abmahnsicheren Verkauf von Textilien über das Internet ist zunächst einmal die Verwendung geeigneter Rechtstexte, wie:
- Impressum
- AGB & Kundeninformationen
- Widerrufsbelehrung
- Datenschutzerklärung
Die IT-Recht Kanzlei bietet Ihnen professionelle Unterstützung zur Absicherung Ihrer Verkaufspräsenz/en an – und zwar zu günstigen wie auch monatlich kündbaren Pauschalpreisen.
Einen Überblick über unsere Schutzpakete finden Sie gerne hier.
2. Zweck und Ziel der EU-Textilkennzeichnung
Sinn und Zweck der Textilkennzeichnungspflicht ist, dass sich der Verbraucher anhand der gemachten Angaben zu der Faserzusammensetzung (z. B. „100 % Filz“) ein Bild über die Qualität und Verwendbarkeit der jeweils angebotenen Textilerzeugnisse machen kann.
Jeder Verbraucher soll EU-weit auf den ersten Blick erkennen und verstehen können, aus welchen Fasern sich T-Shirt, Hose oder Kleid zusammensetzt.
Um dieses Ziel zu erreichen, vereinheitlicht die EU-Textilkennzeichnungsverordnung die Bezeichnungen von Textilfasern sowie die Angaben auf Etiketten und Begleitunterlagen entlang der gesamten Herstellungskette und Vermarktung von Textilerzeugnissen.
Geltungsbereich: Was muss gekennzeichnet werden?
1. Welche Textilerzeugnisse unterliegen der Textilkennzeichnungspflicht?
Die Kennzeichnungspflicht gilt für Textilerzeugnisse, die auf dem Unionsmarkt bereitgestellt werden. Sie umfasst folgende zwei Hauptkategorien:
- Echte Textilerzeugnisse" - Artikel 3 I a EU-Textilkennzeichnungsverordnung
- Gleichgestellte Erzeugnisse - Art. 2 Abs. 2 EU-Textilkennzeichnungsverordnung
2. Was sind echte Textilerzeugnisse?
Dies sind Erzeugnisse, die
- im rohen,
- halbbearbeiteten,
- bearbeiteten,
- halbverarbeiteten,
- verarbeiteten,
- halbkonfektionierten oder
- konfektionierten Zustand
ausschließlich Textilfasern enthalten, unabhängig vom Herstellungsverfahren.
| Verarbeitungszustand | Beschreibung | Konkretes Beispiel |
| Roh | Faser direkt nach der Gewinnung oder Reinigung. | Ein Ballen Rohwolle oder Rohbaumwolle. |
| Halbbearbeitet | Faser, die zu einem Zwischenprodukt aufbereitet wurde. | Vorgarn oder Kammzug (lose, aufbereitete Faserstränge). |
| Bearbeitet | Faser, die zu einem spinnfertigen Produkt verarbeitet wurde. | Ein Garnknäuel oder Nähgarn (fertig gesponnen). |
| Halbverarbeitet | Fasern sind zu einer Fläche verbunden, aber noch nicht fertiggestellt. | Ungewebter Stoff ("Vlies") oder Filzmaterial (vor dem Zuschnitt). |
| Verarbeitet | Fertiger Stoff in Bahnware. | Meterware (Stoff von der Rolle, z.B. 100% Baumwoll-Popeline). |
| Halbkonfektioniert | Textiler Zuschnitt oder Teilstück für ein Endprodukt. | Zugeschnittene Stoffteile für ein Hemd oder eine Hose. |
| Konfektioniert | Fertiges Endprodukt. | T-Shirt (100% Baumwolle), Schal (100% Seide) oder eine fertige Decke (100% Wolle). |
3. Was sind gleichgestellte Erzeugnisse?
Nicht nur klassische Textilerzeugnisse im engeren Sinne unterliegen der Textilkennzeichnungspflicht.
Auch die folgenden Produkte, die nicht vollständig aus Textilfasern bestehen, werden von der EU-Textilkennzeichnungsverordnung gleichgestellt, sofern ihr Textilfaseranteil mindestens 80 % beträgt:
a. Erzeugnisse mit mindestens 80 % Textilfaseranteil
Es geht hier um Erzeugnisse mit einem Gewichtsanteil an Textilfasern von mindestens 80 %.
Kennzeichnungspflichtig sind alle Erzeugnissemit einem Gewichtsanteil an Textilfasern von mindestens 80 %.
Ein Rucksack wiegt insgesamt 600 g. Das gesamte textile Material (Außenstoff, Futter, textile Gurte) macht 510 g aus – das entspricht 85 % Textilanteil am Gesamtgewicht.
Ergebnis: Der Rucksack ist damit kennzeichnungspflichtig, da er die 80%-Schwelle überschreitet.
Die Kennzeichnung muss nun die Zusammensetzung des 510 g Textilanteils widerspiegeln. Angenommen, dieser Anteil besteht aus 80% Polyester und 20% Polyamid, dann wäre die richtige Angabe: 80% Polyester/ 20% Polyamid
b. Bezugsmaterialien für Möbel, Regen- und Sonnenschirme
Ebenfalls kennzeichnungspflichtig sind Bezugsmaterialien für Möbel, Regen- und Sonnenschirme (Art. 2 Abs. 2 Buchst. b EU-Textilkennzeichnungsverordnung), wenn der textile Anteil mindestens 80% der Textilkomponenten ausmacht. Dabei kommt es nicht auf das Gesamtprodukt, sondern nur auf den textilen Bezugsstoff an.
Bei einem Sonnenschirm zählt also allein der Bezug. Besteht dieser zu mindestens 80 % aus textilen Fasern (z. B. Polyacryl), greift die Kennzeichnungspflicht – auch wenn Gestell und Schirmstock aus Metall sind.
Zur Klarstellung: "Möbel" sind Einrichtungsgegenstände, die in Privathaushalten / Büros oder Geschäften verwendet werden.
c. Textile Komponenten bestimmter Erzeugnisse
Auch Textilkomponenten einzelner Produktbestandteile sind kennzeichnungspflichtig, wenn sie zu mindestens 80 % aus Textilfasern bestehen.
Dazu zählen
- die obere Schicht (Nutzschicht) mehrschichtiger Fußbodenbeläge.
- Matratzenbezüge,
- Bezügen von Campingartikeln.
- Bei einem Teppich ohne erkennbare Nutz- und Grundschicht liegt kein mehrschichtiger Fußbodenbelag im Sinne der Verordnung vor.
- Bei Matratzen genügt die Angabe der Textilkomponenten des Bezugs, nicht der gesamten Matratze.
- Gleiches gilt für Campingartikel – nur die Bezüge sind kennzeichnungspflichtig, nicht sämtliche Bestandteile des Produkts.
d. Textilien, die in andere Waren eingearbeitet sind
Schließlich gilt die Kennzeichnungspflicht auch dann, wenn Textilien Bestandteil anderer Produkte werden und deren Zusammensetzung freiwillig angegeben wird. In diesem Fall müssen die gemachten Angaben den Anforderungen der Verordnung entsprechen.
Eine Lederhose ist nicht kennzeichnungspflichtig, da Leder keine Textilfaser ist.
Gibt der Hersteller jedoch freiwillig an, dass das Innenfutter aus „100 % Baumwolle“ besteht, muss diese Angabe den Regeln der Textilkennzeichnungsverordnung entsprechen (amtlicher Fasernamen + Prozentangabe).
4. Welche Textilerzeugnisse und Bestandteile müssen nicht gekennzeichnet werden?
Nicht kennzeichnungspflichtige Textilerzeugnisse
Bei den folgenden Textilerzeugnissen - und den zu ihrer Herstellung bestimmten Vorerzeugnissen - muss die Faserart oder -zusammensetzung nicht angegeben werden, Artikel 17 Abs.2 Textilkennzeichnungsverordnung.
| Nr. | Textilerzeugnisse | Anmerkungen der IT-Recht-Kanzlei |
| 1 | Hemdsärmelhalter | - |
| 2 | Armbänder für Uhren, aus Spinnstoffen | Spinnstoffe sind textile Fasern |
| 3 | Etiketten und Abzeichen | - |
| 4 | Polstergriffe, aus Spinnstoffen | Spinnstoffe sind textile Fasern |
| 5 | Kaffeewärmer | - |
| 6 | Teewärmer | - |
| 7 | Schutzärmel | - |
| 8 | Muffe, nicht aus Plüsch | Unter "Muffe" versteht man eine warmgefütterte Rühre, in welche von beiden Seiten die Hände zum Wärmen gesteckt werden können |
| 9 | Künstliche Blumen | - |
| 10 | Nadelkissen | - |
| 11 | Bemalte Leinwand | - |
| 12 | Textilerzeugnisse für Verstärkungen und Versteifungen | Verstärkungen sind Fäden oder Stoffe, die an bestimmten eng begrenzten Stellen das Textilerzeugnis verstärken, versteifen oder verdicken |
| 13 | Gebrauchte, konfektionierte Textilerzeugnisse, sofern sie ausdrücklich als solche bezeichnet sind | Achtung: Hiervon ist nicht die "B-Ware" umfasst, also neue ungebrauchte Ware mit kleineren Mängeln, die mit einem Nachlass verkauft wird |
| 14 | Gamaschen | - |
| 15 | Verpackungsmaterial, nicht neu und als solches verkauft | - |
| 16 | Täschnerwaren aus textilen Fasern („Spinnstoffe“) sowie Sattlerwaren aus textilen Fasern | Sattlerwaren sind Gegenstände aus textilen Fasern, die zur Verwendung im Umgang mit Tieren hergestellt werden. Umfasst werden aber auch die textilen Erzeugnisse einer Autosattlerei bei der Herstellung von Autositzen. / Quelle: Kommentar zum Textilkennzeichnungsgesetz, 4. Auflage, Lange/Quednau) |
| 17 | Reiseartikel, aus Spinnstoffen | - |
| 18 | Fertige oder noch fertigzustellende handgestickte Tapisserien (also Wandteppische) und Material zu ihrer Herstellung, einschliesslich Handstickgarne, die getrennt vom Grundmaterial zum Verkauf angeboten werden und speziell zur Verwendung für solche Tapisserien aufgemacht sind | - |
| 19 | Reißverschlüsse | - |
| 20 | Mit Textilien überzogene Knöpfe und Schnallen | - |
| 21 | Buchhüllen aus Spinnstoffen | - |
| 22 | Spielzeug | Der Begriff "Spielzeug" ist hier definiert. Das LG Frankfurt hat mit Urteil vom 14.06.2012, Az. 2 - 03 0 183/12 klargestellt, dass nicht die bloße Bewerbung eines Textilerzeugnisses als Spielzeug, sondern nur "echtes Spielzeug" die Pflicht zur Nennung der Textilfasern und Faserzusammensetzung entfallen läßt. |
| 23 | Textile Teile von Schuhwaren | - |
| 24 | Deckchen aus mehreren Bestandteilen mit einer Oberfläche von weniger als 500 cm2 | - |
| 25 | Topflappen und Topfhandschuhe | - |
| 26 | Eierwärmer | - |
| 27 | Kosmetiktäschchen | - |
| 28 | Tabakbeutel aus Gewebe | - |
| 29 | Futterale bzw. Etuis für Brillen, Zigaretten und Zigarren, Feuerzeuge und Kämme, aus Gewebe | - |
| 30 | Hüllen für Mobiltelefone und tragbare Medienabspielgeräte mit einer Oberfläche von höchstens 160 cm2 | - |
| 31 | Schutzartikel für den Sport, ausgenommen Handschuhe. | Beispiele: Schutzkleidung von Eishockeyspielern oder Schutzjacken für Reiter |
| 32 | Toilettenbeutel | - |
| 33 | Schuhputzbeutel | - |
| 34 | Bestattungsartikel | - |
| 35 | Einwegerzeugnisse, ausgenommen Watte | Als Einwegartikel gelten Textilerzeugnisse, die einmal oder kurzfristig verwendet werden und deren normale Verwendung eine Wiederinstandsetzung für den gleichen Verwendungszweck oder für einen späteren ähnlichen Verwendungszweck ausschließt. |
| 36 | Den Vorschriften des Europäischen Arzneibuchs unterliegende Textilerzeugnisse, für die ein entsprechender Vermerk aufgenommen wurde, wieder verwendbare medizinische und orthopädische Binden und allgemeines orthopädisches Textilmaterial | - |
| 37 | Textilerzeugnisse, einschließlich Seile, Taue und Bindfäden (vorbehaltlich Anhang VI Nummer 12), die normalerweise bestimmt sind: a) zur Verwendung als Werkzeug bei der Herstellung und der Verarbeitung von Gütern / b) zum Einbau in Maschinen, Anlagen (für Heizung, Klimatisierung, Beleuchtung usw.), Haushaltsgeräte und andere Geräte, Fahrzeuge und andere Transportmittel oder zum Betrieb, zur Wartung oder zur Ausrüstung dieser Geräte, mit Ausnahme von Planen und Textilzubehör für Kraftfahrzeuge, das getrennt von den Fahrzeugen verkauft wird | - |
| 38 | Textilerzeugnisse für den Schutz und die Sicherheit, wie z. B. Sicherheitsgurte, Fallschirme, Schwimmwesten, Notrutschen, Brandschutzvorrichtungen, kugelsichere Westen, besondere Schutzanzüge (z. B. Feuerschutz, Schutz vor Chemikalien oder anderen Sicherheitsrisiken | - |
| 39 | Ballonhallen (Sport-, Ausstellungs-, Lagerhallen usw.), sofern Angaben über die Leistungen und technischen Einzelheiten dieser Erzeugnisse mitgeliefert werden | - |
| 40 | Segel | - |
| 41 | Textilwaren für Tiere | - |
| 42 | Fahnen und Banner | - |
Die sich aus dem Produktsicherheitsgesetz ergebenden Kennzeichnungsvorgaben bei Verbraucherprodukten sind hiervon unberührt bzw. weiterhin zu beachten.
Bestandteile, die bei der Faseranalyse ignoriert werden
Bei der Ermittlung der Faserzusammensetzung nach der EU-Textilkennzeichnungsverordnung werden nicht alle Bestandteile eines Textilerzeugnisses in die Analyse einbezogen.
Artikel 19 Absatz 2 der Textilkennzeichnungsverordnung legt vielmehr fest, dass sich die Faserbestimmung ausschließlich auf die eigentliche textile Hauptstruktur eines Erzeugnisses bezieht. Zubehörteile, Verzierungen oder technische Hilfsstoffe werden nicht mitgezählt, da sie nicht den textilen Charakter des Produkts prägen und die Faserzusammensetzung verfälschen würden.
Die Regelung soll sicherstellen, dass die auf Etiketten angegebene Zusammensetzung – etwa „80 % Baumwolle, 20 % Polyester“ – ein realistisches Bild der Hauptfasern des Textils vermittelt. Nicht berücksichtigt werden dagegen Fremdmaterialien oder Zusatzstoffe, die lediglich der Verarbeitung, Stabilität oder Optik dienen.
Welche Bestandteile konkret von der Faseranalyse ausgenommen sind, zeigt die folgende Übersicht:
| Nr. | Erzeugnisse | Ausgenommene Artikel |
| 1 | Alle Textilerzeugnisse | nicht textile Teile, Webkanten, Etiketten und Abzeichen, Bordüren und Besatz, die nicht Bestandteil des Erzeugnisses sind, mit Textilien überzogene Knöpfe und Schnallen, Zubehör, Schmuckbesatz, nichtelastische Bänder, an bestimmten, eng begrenzten Stellen eingearbeitete elastische Fäden und Bänder sowie, unter den in Artikel 10 genannten Bedingungen, sichtbare und isolierbare Fasern rein dekorativer Funktion und Fasern mit antistatischer Wirkung. |
| 2 | Alle Textilerzeugnisse | Fettstoffe, Bindemittel, Beschwerungen, Appreturen, Imprägniermittel, zusätzliche Färbe- und Druckhilfsmittel sowie sonstige Textilbearbeitungserzeugnisse |
| 3 | Fußbodenbeläge und Teppiche | sämtliche Teile außer der Nutzschicht |
| 4 | Polstergewebe | Binde- und Füllketten sowie Binde- und Füllschüsse, die nicht Teil der Nutzschicht sind |
| 5 | Vorhänge, Gardinen und Übergardinen | Binde- und Füllketten sowie Binde- und Füllschüsse, die nicht Teil der Vorderseite des Stoffes sind |
| 6 | Socken | Zusätzliches Elastikgarn im Bündchen sowie Verstärkungsgarn an Zehen und Ferse |
| 7 | Strumpfhosen | Zusätzliches Elastikgarn im Bündchen sowie Verstärkungsgarn an Zehen und Ferse |
| 8 | Andere als die unter den Buchstaben 1 bis 7 genannten Textilerzeugnisse | Grundschichten, Versteifungen, Verstärkungen, Einlagestoffe und Bespannungen, Näh- und Verbindungsfäden, sofern sie nicht die Kette und/oder den Schuss des Gewebes ersetzen, Polsterungen, die anderen Zwecken als denen der Wärmehaltung dienen, sowie — vorbehaltlich Artikel 11 Absatz 2 — Futterstoffe |
Anmerkung zu Nr. 8:
Nr. 8 regelt den Auffangtatbestand für alle Textilerzeugnisse, die nicht ausdrücklich unter die vorherigen Nummern 1 bis 7 fallen. Sie legt fest, welche Bestandteile bei diesen „sonstigen Textilerzeugnissen“ bei der Faseranalyse außen vor bleiben dürfen, weil sie nicht Teil der eigentlichen Nutzschicht oder Hauptstruktur sind.
- Nicht als auszusondernde Bestandteile gelten jene Grundschichten, die bei Textilerzeugnissen als Träger der Nutzschicht dienen – insbesondere die Grundgewebe von Decken oder Doppelgeweben sowie die Grundschichten von Samt-, Plüsch- und ähnlichen Stoffen. Diese Teile sind Bestandteil der Hauptstruktur und daher in die Faseranalyse einzubeziehen.
- Als Verstärkungen gelten dagegen Fäden oder Stoffe, die nur an bestimmten, eng begrenzten Stellen des Erzeugnisses angebracht sind, um dieses zu verstärken, zu versteifen oder zu verdicken. Solche Materialien sind nicht Teil der Hauptfaserzusammensetzung und werden bei der Analyse nicht berücksichtigt.
Weitere Ausnahmen (Heimarbeit, Maßanfertigung)
Neben den in der Verordnung ausdrücklich genannten Produktgruppen sind bestimmte Sonderfälle von der Kennzeichnungspflicht ausgenommen. Die EU-Textilkennzeichnungsverordnung sieht hierfür zwei zusätzliche Ausnahmen vor:
Textilerzeugnisse aus Heimarbeit (Art. 2 Abs. 3)
Nicht kennzeichnungspflichtig sind Textilerzeugnisse, die ohne Eigentumsübertragung an Heimarbeiter oder selbständige Unternehmen zur Weiterverarbeitung übergeben werden.
Heimarbeiter sind gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 HAG Personen, die in ihrer Wohnung oder selbst gewählten Arbeitsstätte im Auftrag von Gewerbetreibenden Textilprodukte bearbeiten oder herstellen, ohne sie selbst zu vertreiben.
Heimarbeiter ist gemäß § 2 Abs. 1 S. 1 HAG, wer in selbstgewählter Arbeitsstätte (eigener Wohnung oder selbstgewählter Betriebsstätte) allein oder mit seinen Familienangehörigen im Auftrag von Gewerbetreibenden oder Zwischenmeistern erwerbsmäßig arbeitet, jedoch die Verwertung der Arbeitsergebnisse dem unmittelbar oder mittelbar auftraggebenden Gewerbetreibenden überläßt. Beschafft der Heimarbeiter die Roh- und Hilfsstoffe selbst, so wird hierdurch seine Eigenschaft als Heimarbeiter nicht beeinträchtigt.
Keine Kennzeichnungspflicht:
Fall 1: Eine Bekleidungsfirma liefert zugeschnittene Stoffteile an Heimarbeiterinnen, die diese zu fertigen Blusen zusammennähen. Hier gilt:
- Die Blusen bleiben Eigentum des auftraggebenden Unternehmens, das sie später unter seinem Namen verkauft.
- Kein „Inverkehrbringen“ durch die Heimarbeiterin – sie gilt nicht als Herstellerin im Sinne der Verordnung.
- Die Kennzeichnungspflicht verbleibt beim Unternehmen, das die Ware letztlich auf den Markt bringt.
Fall 2: Eine Manufaktur beauftragt ein selbständiges Nähatelier, bereits etikettierte Textilien mit Knöpfen zu versehen. Hier gilt:
- Das Atelier arbeitet im Auftrag und bringt das Produkt nicht selbst in den Handel.
- Damit liegt kein kennzeichnungspflichtiger Inverkehrbringerwechsel vor; die rechtliche Verantwortung bleibt beim ursprünglichen Hersteller.
Kennzeichnungspflichtig:
Eine Heimarbeiterin fertigt eigene Taschen aus selbst beschafften Stoffen und verkauft sie über Etsy oder auf Märkten.
Hier erfolgt das Inverkehrbringen im eigenen Namen. Sie wird rechtlich zur Herstellerin und muss das Produkt ordnungsgemäß kennzeichnen.
Erklärung
Die EU-Textilkennzeichnungsverordnung knüpft die Kennzeichnungspflicht an das „Inverkehrbringen“ eines Textilerzeugnisses, also an dessen erstmalige Abgabe an den Handel oder Verbraucher. Heimarbeiter, die im Auftrag eines Unternehmens tätig sind, bringen die Ware nicht selbst in den Verkehr, sondern führen lediglich Zwischenbearbeitungsschritte aus.
Die Kennzeichnungspflicht greift daher erst beim Auftraggeber, der das fertige Erzeugnis unter seinem Namen verkauft.
Maßgeschneiderte Textilerzeugnisse (Art. 2 Abs. 4)
Ebenfalls ausgenommen sind maßgeschneiderte Textilerzeugnisse, die von selbständigen Schneidern individuell für Verbraucher angefertigt werden. Die Ausnahme gilt nur für echte Einzelanfertigungen. Unter diese Regelung fällt demnach nicht die industrielle Fertigung von Textilerzeugnissen nach individuellen Maßvorgaben von Verbrauchern.
Keine Kennzeichnungspflicht:
Eine Schneiderin fertigt auf Wunsch eines Kunden einen maßgeschneiderten Anzug oder ein Hochzeitskleid. Da es sich um ein Unikat für einen bestimmten Verbraucher handelt, entfällt die Pflicht zur Faserkennzeichnung.
- Ein Herrenschneider schneidert individuell ein Hemd aus einem Stoff, den der Kunde selbst mitbringt. Hier besteht ebenfalls keine Kennzeichnungspflicht.
Kennzeichnungspflichtig:
- Ein Online-Shop bietet Hemden „nach Maß“ an, die industriell aus einer standardisierten Stoffserie gefertigt werden. Diese gelten nicht als Maßanfertigung, sondern als industriell hergestellte Textilerzeugnisse – Kennzeichnungspflicht besteht.
- Eine Änderungsschneiderei fertigt Kinderkleider in kleiner Serie und verkauft sie im Laden. Keine geht es nicht um Einzelanfertigung für einen konkreten Kunden – daher besteht eine Kennzeichnungspflicht.
Verantwortlichkeiten und Pflichten der Marktakteure
1. Textilkennzeichnung: Verantwortung und Kontrollpflicht der Händler
Die Pflicht zur ordnungsgemäßen Kennzeichnung obliegt primär dem Hersteller (Art. 15 Abs. 1 EU-Textilkennzeichnungsverordnung) und, sofern dieser außerhalb der EU ansässig ist, dem Einführer (Art. 15 Abs. 1 Unterabs. 2 EU-Textilkennzeichnungsverordnung).
Händler (Distributoren) tragen zwar keine originäre, doch aber eine umfassende Mitverantwortung für die Einhaltung der Vorgaben der EU-Textilkennzeichnungsverordnung.
Diese stützt sich auf folgende drei zentrale Säulen:
a. Sicherstellungs- und Prüfpflicht (Art. 15 Abs. 3)
Die wichtigste Pflicht des Händlers ist die Sicherstellungspflicht beim Bereitstellen auf dem Markt. Er muss gewährleisten, dass das in den Verkauf gebrachte Textilerzeugnis die ordnungsgemäße Etikettierung oder Kennzeichnung gemäß den Vorgaben der Verordnung trägt.
Dies beinhaltet eine implizite Kontrollpflicht, d. h. eine aktive Prüfpflicht der vom Lieferanten bereitgestellten Kennzeichnung. Ein Händler darf sich nicht blind darauf verlassen, dass die Angaben zur Faserzusammensetzung korrekt sind. Bestehen Zweifel (z. B. wegen offensichtlicher Fehler, fehlender Angaben oder bekannter Probleme beim Lieferanten), muss der Händler einschreiten.
Im Falle einer fehlerhaften oder fehlenden Kennzeichnung haftet der Händler gegenüber Abmahnern oder Marktüberwachungsbehörden, auch wenn er den Fehler nicht selbst verursacht hat.
b. Haftung als Hersteller (Art. 15 Abs. 2)
Der Händler übernimmt die volle juristische Verantwortung des Herstellers, sobald er seine reine Vertriebsrolle überschreitet. Dies hat eine Haftung als sogenannter Quasi-Hersteller zur Folge (Artikel 15 Abs.2 EU-Textilkennzeichnungsverordnung).
Die volle Herstellerhaftung greift, wenn der Händler:
- das Erzeugnis unter seinem eigenen Namen oder seiner Handelsmarke in Verkehr bringt (z. B. Private Labeling),
- das Etikett selbst anbringt oder den Inhalt des Etiketts ändert (z. B. Hinzufügen einer falschen Faserbezeichnung oder nachträgliches Ändern der Prozentsätze).
In diesen Fällen muss der Händler nicht nur die Richtigkeit überprüfen, sondern er muss auch die Einhaltung aller Vorgaben (Art. 14 und Art. 15 Abs. 1 EU-Textilkennzeichnungsverordnung) von Grund auf sicherstellen, als hätte er das Produkt selbst hergestellt.
Private Labeling (Handelsmarke)
Ein Händler entfernt das Etikett des asiatischen Herstellers und ersetzt es durch ein eigenes mit dem Aufdruck „Design by [Händler-Markenname]”.
Dieser Händler gilt nun juristisch als Hersteller (Quasi-Hersteller). Er haftet ab diesem Zeitpunkt vollumfänglich für die Richtigkeit der Faserzusammensetzung, die korrekte Anbringung des Etiketts und alle anderen Pflichten gemäß der Textilkennzeichnungsverordnung.
c. Pflicht zur Information (Art. 14 Abs. 1)
Diese Händlerpflicht ergibt sich aus dem Grundsatz, dass das Textilerzeugnis zur Angabe seiner Faserzusammensetzung etikettiert oder gekennzeichnet sein muss, wenn es auf dem Markt bereitgestellt wird (Artikel 14 Abs. 1 EU-Textilkennzeichnungsverordnung).
Der Händler ist somit der letzte Akteur, der die Einhaltung dieser Grundvoraussetzung für den Vertrieb gewährleisten muss.
2. Verantwortlichkeit und zusätzliche Herstellerkennzeichnung
Die Textilkennzeichnungsverordnung (EU) Nr. 1007/2011 regelt in Art. 15, wer für die ordnungsgemäße Kennzeichnung und Etikettierung von Textilerzeugnissen verantwortlich ist. Ziel ist es, eine klare Zuständigkeitsverteilung entlang der Lieferkette sicherzustellen – vom Hersteller über den Importeur bis hin zum Händler.
Herstellerpflichten
Die primäre Verantwortung liegt beim Hersteller, sofern dieser das Textilerzeugnis innerhalb der Europäischen Union in Verkehr bringt, Art. 15 Abs. 1 EU-Textilkennzeichnungsverordnung.
Der Hersteller muss insbesondere gewährleisten, dass:
- die Faserzusammensetzung korrekt ermittelt wurde,
- das Erzeugnis ordnungsgemäß etikettiert oder gekennzeichnet ist, und
- die Angaben den Anforderungen der Verordnung entsprechen, insbesondere hinsichtlich Sprache, Dauerhaftigkeit und Sichtbarkeit.
Zudem hat der Hersteller sicherzustellen, dass die Kennzeichnung während der gesamten Vermarktung unverändert bleibt und bei Weitergabe an nachgelagerte Wirtschaftsbeteiligte nicht entfernt oder verdeckt wird.
Importeurpflichten
Ist der Hersteller außerhalb der Europäischen Union ansässig, geht die Verantwortung auf den Einführer (Importeur) über, Art. 15 Abs. 1 Satz 2 EU-Textilkennzeichnungsverordnung.
Der Importeur gilt in diesem Fall als Hersteller und hat dieselben Pflichten.
Er muss daher gewährleisten, dass die eingeführten Textilerzeugnisse:
- mit einer ordnungsgemäßen Kennzeichnung versehen sind,
- die Kennzeichnung vollständig und wahrheitsgemäß ist, und
- alle Angaben in der Amtssprache des Bestimmungslandes (in Deutschland: Deutsch) erfolgen.
Die bloße Übernahme der Herstellerangaben genügt nicht, wenn deren Richtigkeit zweifelhaft ist. Der Importeur muss die Angaben im Zweifel eigenständig prüfen oder verifizieren.
Pflichten des Händlers (Distributors)
Auch der Händler hat eine gesetzlich verankerte Prüfpflicht (Art. 15 Abs. 3).
Er darf Textilerzeugnisse nur dann auf dem Markt bereitstellen, wenn sie ordnungsgemäß gekennzeichnet sind.
Praktisch bedeutet das:
- Der Händler muss stichprobenartig kontrollieren, ob Etiketten vorhanden und plausibel sind.
- Fehlt die Kennzeichnung oder bestehen Zweifel an ihrer Richtigkeit, darf das Produkt nicht verkauft werden.
- Der Händler muss die Kennzeichnung sichtbar lassen und darf sie nicht entfernen oder verdecken.
Darüber hinaus wird der Händler selbst zum Hersteller im Sinne der Verordnung, wenn er
- das Etikett verändert oder ersetzt, oder
- das Erzeugnis unter eigenem Namen oder eigener Marke vertreibt (Art. 15 Abs. 2).
Damit trägt er in diesen Fällen die volle rechtliche Verantwortung für die Kennzeichnung.
Grundregeln der Faserbezeichnungen und Kennzeichnung
1. Welche Regeln sind bei der Textilkennzeichnung zwingend?
a. Amtliche Textilfaserbezeichnungen
Für die Beschreibung der Faserzusammensetzungen dürfen nur die amtlichen Textilfaserbezeichnungen nach Anhang I der EU-Textilkennzeichnungsverordnung verwendet werden.
Richtig:
100 % Baumwolle
60 % Polyester, 40 % Viskose
Nicht richtig:
100 % Cotton
60 % Microfaser, 40 % Viskosemischung
(„Cotton“ und „Microfaser“ sind keine zulässigen Bezeichnungen nach Anhang I.)
b. Keine Irreführung
Die Bezeichnungen nach Anhang I der EU-Textilkennzeichnungsverordnung dürfen nicht irreführend - weder alleinstehend noch in Wortverbindungen oder als Eigenschaftswort - für andere Fasern verwendet werden.
Richtig:
90 % Polyester, 10 % Elastan
Nicht richtig:
90 % Seiden-Polyester, 10 % Elastan
(„Seiden-Polyester“ ist irreführend, da keine echte Seide enthalten ist.)
c. Marken- und Firmennamen keine zulässigen Faserangaben
Marken- oder Firmenbezeichnungen (z. B. „Lycra“, „Tencel“ oder „Coolmax“) sind keine zulässigen Angaben zur Textilfaserzusammensetzung. Sie dürfen nicht anstelle der vorgeschriebenen Bezeichnung (z. B. „Elastan“, „Lyocell“ oder „Polyester“) verwendet werden.
Durch das Verbot der Verwendung von Markennamen als Rohstoffstoffgehaltsangabe soll verhindert werden, dass Verbraucher unrichtige Vorstellungen über die Beschaffenheit des Textilerzeugnisses haben könnten.
Zulässig ist lediglich eine ergänzende Nennung, etwa:
„80 % Baumwolle, 20 % Elastan (Lycra®)“
Wichtig: Der Markenname muss klar von der Faserbezeichnung abgesetzt sein (z. B. durch Klammern oder andere Schriftgestaltung), damit keine Verwechslungsgefahr besteht.
Richtig:
Richtig:
80 % Baumwolle, 20 % Elastan (Lycra®)
70 % Lyocell (Tencel™), 30 % Baumwolle
Nicht richtig:
80 % Baumwolle, 20 % Lycra
70 % Tencel, 30 % Baumwolle
(Die Marken „Lycra“ und „Tencel“ dürfen nicht anstelle der amtlichen Faserbezeichnung genannt werden.)
d. Reihenfolge und Mengenangabe
Die Faserzusammensetzungen müssen mit den Gewichtshundertsätzen in absteigender Reihenfolge aufgeführt werden.
Richtig:
60 % Baumwolle, 30 % Polyester, 10 % Elastan
Nicht richtig:
10 % Elastan, 30 % Polyester, 60 % Baumwolle
(Die Reihenfolge muss der Mengenverteilung entsprechen.)
e. Art der Kennzeichnung
Die Kennzeichnung muss dauerhaft, leicht lesbar, sichtbar und zugänglich sein
Richtig
Im Online-Shop wird die Faserzusammensetzung gut sichtbar direkt in der Artikelbeschreibung angegeben, z. B. im oberen Produktdatenbereich oder in einem klar bezeichneten Abschnitt „Material“.
Zusätzlich trägt das physische Produkt ein eingenähtes, dauerhaftes Etikett mit der gleichen Faserangabe.
Falsch
Die Faserzusammensetzung ist nur in einem herunterklappbaren (näher nicht bezeichnetem) Menü, am Seitenende oder erst auf der Rechnung angegeben.
(Im Online-Handel muss die Textilkennzeichnung bereits vor dem Kaufabschluss gut erkennbar sein – etwa auf der Produktseite.)
2. Welche Bezeichnungen von Textilfasern sind erlaubt?
Laut Artikel 5 der EU-Textilkennzeichnungsverordnung sind bei der Faserkennzeichnung ausschließlich die offiziellen Bezeichnungen aus Anhang I der Verordnung erlaubt.
Liste der amtlichen Faserbezeichnungen
Nachfolgend die Liste der exakten Fasernamen und deren Definitionen (z. B. "Wolle", "Baumwolle", "Polyamid oder Nylon") - entsprechend Anhang 1 EU-Textilkennzeichnungsverordnung:
| Nr. | Bezeichnung | Beschreibung der Faser |
| 1 | Wolle | Faser vom Fell des Schafes (Ovis aries) oder ein Gemisch aus Fasern von der Schafschur und aus Haaren der unter Nummer 2 genannten Tiere |
| 2 | Alpaka, Lama, Kamel, Kaschmir, Mohair, Angora (-kanin), Vikunja,Yak, Guanako, Kaschgora, Biber, Fischotter, mit oder ohne zusätzliche Bezeichnung „Wolle“ oder „Tierhaar“ | Haare nachstehender Tiere: Alpaka, Lama, Kamel, Kaschmirziege, Angoraziege, Angorakanin, Vikunja, Yak, Guanako, Kaschgoraziege, Biber, Fischotter |
| 3 | Tierhaar, mit oder ohne Angabe der Tiergattung (z. B. Rinderhaar, Hausziegenhaar, Rosshaar) | Haare von verschiedenen Tieren, soweit diese nicht unter den Nummern 1 und 2 genannt sind |
| 4 | Seide | Faser, die ausschließlich aus Kokons seidenspinnender Insekten gewonnen wird |
| 5 | Baumwolle | Faser aus den Samen der Baumwollpflanze (Gossypium) |
| 6 | Kapok | Faser aus dem Fruchtinneren des Kapok (Ceiba pentandra) |
| 7 | Flachs bzw. Leinen | Bastfaser aus den Stängeln des Flachses (Linum usitatissimum) |
| 8 | Hanf | Bastfaser aus den Stängeln des Hanfes (Cannabis sativa) |
| 9 | Jute | Bastfaser aus den Stängeln des Corchorus olitorius und Corchorus capsulatis. Im Sinne dieser Verordnung sind der Jute gleichgestellt: Fasern aus Hibiscus cannabinus, Hibiscus sabdariffa, Abutilon avicennae, Urena lobata, Urena sinuata |
| 10 | Manila | Faser aus den Blattscheiden der Musa textilis |
| 11 | Alfa | Faser aus den Blättern der Stipa tenacissima |
| 12 | Kokos | Faser aus der Frucht der Cocos nucifera |
| 13 | Ginster | Bastfaser aus den Stängeln des Cytisus scoparius und/oder des Spartium junceum |
| 14 | Ramie | Faser aus dem Bast der Boehmeria nivea und der Boehmeria tenacissima |
| 15 | Sisal | Faser aus den Blättern der Agave sisalana |
| 16 | Sunn | Faser aus dem Bast der Crotalaria juncea |
| 17 | Henequen | Faser aus dem Bast der Agave fourcroydes |
| 18 | Maguey | Faser aus dem Bast der Agave cantala |
| 19 | Acetat | Faser aus Zellulose-Acetat mit weniger als 92 %, jedoch mindestens 74 % acetylierter Hydroxyl- gruppen |
| 20 | Alginat | Faser aus den Metallsalzen der Alginsäure |
| 21 | Cupro | Regenerierte Zellulosefaser nach dem Kupfer-Ammoniak-Verfahren |
| 22 | Modal | Nach einem geänderten Viskoseverfahren her- gestellte regenerierte Zellulosefaser mit hoher Reißkraft und hohem Modul in feuchtem Zustand. Die Reißkraft (BC) in aufgemachtem Zustand und die Kraft (BM), die erforderlich ist, um in feuchtem Zustand eine Dehnung von 5 % zu erzielen, sind Folgende: BC (Zentinewton) ≥ 1,3 √ T + 2 T // BM (Zentinewton) ≥ 0,5 √ T wobei T die mittlere längenbezogene Masse in Dezitex ist. |
| 23 | Regenerierte Proteinfaser | Faser aus regeneriertem und durch chemische Agenzien stabilisiertem Eiweiß |
| 24 | Triacetat | Aus Zellulose-Acetat hergestellte Faser, bei der mindestens 92 % der Hydroxylgruppen acetyliert sind |
| 25 | Viskose | Bei Endlosfasern und Spinnfasern nach dem Viskoseverfahren hergestellte regenerierte Zellulosefaser |
| 26 | Polyacryl | Faser aus linearen Makromolekülen, deren Kette aus mindestens 85 Gewichtsprozent Acrylnitril aufgebaut wird |
| 27 | Polychlorid | Faser aus linearen Makromolekülen, deren Kette aus mehr als 50 Gewichtsprozent chloriertem Olefin (z. B. Vinylchlorid, Vinylidenchlorid) aufgebaut wird |
| 28 | Fluorfaser | Faser aus linearen Makromolekülen, die aus aliphatischen Fluor-Kohlenstoff- Monomeren gewonnen werden |
| 29 | Modacryl | Faser aus linearen Makromolekülen, deren Kette aus mehr als 50 und weniger als 85 Gewichts- prozent Acrylnitril aufgebaut wird |
| 30 | Polyamid oder Nylon | Faser aus synthetischen linearen Makromolekülen, deren Kette sich wiederholende Amidbindungen aufweist, von denen mindestens 85 % an lineare aliphatische oder zykloaliphatische Einheiten gebunden sind |
| 31 | Aramid | Fasern aus linearen synthetischen Makro- molekülen mit aromatischen Gruppen, deren Kette aus Amid- oder Imidbindungen besteht, von denen mindestens 85 % direkt an zwei aromatische Kerne gebunden sind und deren Imidbindungen, wenn vorhanden, die Anzahl der Amidbindungen nicht übersteigen darf |
| 32 | Polyimid | Faser aus synthetischen linearen Makromolekülen, deren Kette sich wiederholende Imideinheiten aufweist |
| 33 | Lyocell | Durch Auflösungs- und Spinnverfahren in organischem Lösungsmittel (Gemisch aus organischen Chemikalien und Wasser) hergestellte regenerierte Zellulosefaser ohne Bildung von Derivaten |
| 34 | Polylactid | Faser aus linearen Makromolekülen, deren Kette zu mindestens 85 Masseprozent aus Milch- säureestereinheiten besteht, die aus natürlich vorkommenden Zuckern gewonnen werden, und deren Schmelzpunkt bei mindestens 135 °C liegt |
| 35 | Polyester | Faser aus linearen Makromolekülen, deren Kette zu mindestens 85 Gewichtsprozent aus dem Ester eines Diols mit Terephtalsäure besteht |
| 36 | Polyethylen | Faser aus gesättigten linearen Makromolekülen nicht substituierter aliphatischer Kohlenwasserstoffe |
| 37 | Polypropylen | Faser aus linearen gesättigten aliphatischen Kohlenwasserstoffen, in denen jeder zweite Kohlenstoff eine Methylgruppe in isotaktischer Anordnung trägt, ohne weitere Substitution |
| 38 | Polyharnstoff | Faser aus linearen Makromolekülen, deren Kette eine Wiederkehr der funktionellen Harnstoffgruppe (NH-CO-NH) aufweist |
| 39 | Polyurethan | Faser aus linearen Makromolekülen, deren Kette eine Wiederkehr der funktionellen Urethangruppen aufweist |
| 40 | Vinylal | Faser aus linearen Makromolekülen, deren Kette aus Polyvinylalkohol mit variablem Acetalisierungsgrad aufgebaut wird |
| 41 | Trivinyl | Faser aus drei verschiedenen Vinylmonomeren, die sich aus Acrylnitril, aus einem chlorierten Vinylmonomer und aus einem dritten Vinylmonomer zusammensetzt, von denen keines 50 % der Gewichtsanteile aufweist |
| 42 | Elastodien | Elastische Faser, die aus natürlichem oder synthetischem Polyisopren besteht, entweder aus einem oder mehreren polymerisierten Dienen, mit oder ohne einem oder mehreren Vinylmonomeren, und die, unter Einwirkung einer Zugkraft um die dreifache ursprüngliche Länge gedehnt, nach Entlastung sofort wieder nahezu in ihre Ausgangslage zurückkehrt |
| 43 | Elasthan | Elastische Faser, die aus mindestens 85 Gewichtsprozent von segmentiertem Polyurethan besteht, und die, unter Einwirkung einer Zugkraft um die dreifache ursprüngliche Länge gedehnt, nach Entlastung sofort wieder nahezu in ihre Ausgangslage zurückkehrt |
| 44 | Glasfaser | Faser aus Glas |
| 45 | Elastomultiester | Faser, die durch die Interaktion von zwei oder mehr chemisch verschiedenen linearen Makro- molekülen in zwei oder mehr verschiedenen Phasen entsteht (von denen keine 85 % Gewichtsprozent übersteigt), die als wichtigste funktionale Einheit Estergruppen enthält (zumindestens 85 %) und die nach geeigneter Behandlung um die anderthalbfache ursprüngliche Länge gedehnt, nach Entlastung sofort wieder nahezu in ihre Ausgangslage zurückkehrt |
| 46 | Elastolefin | Für Fasern aus mindestens 95 Gewichtsprozent Makromolekülen, zum Teil quervernetzt, zusammengesetzt aus Ethylen und wenigstens einem anderen Olefin, und die, unter Einwirkung einer Zugkraft um die anderthalbfache ursprüngliche Länge gedehnt, nach Entlastung sofort wieder nahezu in ihre Ausgangslage zurückkehren |
| 47 | Melamin | Faser, die zu mindestens 85 Gewichtsprozent aus quervernetzten, aus Melaminderivaten bestehenden Makromolekülen aufgebaut ist |
| 48 | Bezeichnung entsprechend dem Stoff, aus dem sich die Fasern zusammensetzen, z. B. Metall (metallisch, metallisiert), Asbest, Papier, mit oder ohne Zusatz „Faser“ oder „Garn“ | Fasern aus verschiedenen oder neuartigen Stoffen, die vorstehend nicht aufgeführt sind |
| 49 | Polypropylen/Polyamid-Bikomponentenfaser | Bikomponentenfaser, die zu 10 bis 25 Gewichtsprozent aus in eine Polypropylenmatrix eingebetteten Polyamidfibrillen besteht“ (vgl. EU-Verordnung 286/2012) |
| 50 | Polyacrylat | Faser aus quervernetzten Makromolekülen, die aus mehr als 35 Gewichtsprozent Acrylatgruppen (Säure, Leichtmetallsalze oder Ester) und weniger als 10 Gewichtsprozent Acrylnitrilgruppen in der Kette und bis zu 15 Gewichtsprozent Stickstoff in der Quervernetzung aufgebaut wird“ (vgl. EU-Verordnung 2018/122) |
Zulässige Sammel- und Qualitätszusätze
Zusätzlich zu den Standard-Fasernamen aus der obigen Liste sind nach der Verordnung bei Vorliegen bestimmter, genau geregelter Voraussetzungen auch folgende speziellen Bezeichnungen zulässig:
| 100 %,„rein“ oder „ganz“ | Erlaubt nur für Textilerzeugnisse, die ausschließlich aus einer Faser bestehen. Toleranz für technisch unvermeidbare Fremdfasern beträgt maximal 2% (allgemein) bzw. 5% (Streichverfahren).. | Art. 7 |
| Schurwolle | Erlaubt nur für Wolle, die niemals in einem Fertigerzeugnis enthalten war und nicht faserschädigend behandelt wurde. Es gilt eine strenge Toleranz von ≤0,3% Fremdfasern. | Art. 8 |
| Halbleinen | Spezialbezeichnung für Gewebe mit Kette aus reiner Baumwolle und Schuss aus reinem Leinen, wenn der Leinenanteil ≥40% des Gewichts des entschlichteten Gewebes ausmacht.. | Art. 9 |
| Sonstige Fasern | Sammelbezeichnung für Fasern, deren Anteil am Gesamtgewicht ≤5% (einzeln) oder ≤15% (zusammen) beträgt, und die schwierig zu bestimmen sind. | Art. 9 |
| Erzeugnis unbestimmter Zusammensetzung | Erlaubt als Bezeichnung, wenn die Zusammensetzung zum Zeitpunkt der Herstellung schwierig zu bestimmen ist. | Art. 9 |
| Diverse Faserarten | Erlaubt als Bezeichnung, wenn die Zusammensetzung zum Zeitpunkt der Herstellung schwierig zu bestimmen ist | Art. 9 |
3. Wie sind die Faserbezeichnungen korrekt zu verwenden?
Die in Anhang I der EU-Textilkennzeichnungsverordnung aufgeführten Fasernamen dürfen nur unter den dort festgelegten Voraussetzungen gemäß Artikel 5 verwendet werden. Damit wird gewährleistet, dass Verbraucher einheitliche und verlässliche Informationen über die Zusammensetzung von Textilerzeugnissen erhalten.
Im Wesentlichen gelten dabei folgende Grundsätze:
a.Nur amtlich zugelassene Faserbezeichnungen dürfen verwendet werden
Für die Angabe der Faserzusammensetzung dürfen ausschließlich die in Anhang I genannten Bezeichnungen verwendet werden. Nicht amtliche oder frei erfundene Namen – etwa „Microfaser“ oder „Softtouch“ – sind nicht erlaubt, da sie keine offizielle Faserbezeichnung darstellen.
b.Faserbezeichnungen dürfen nicht mit anderen Wörtern kombiniert werden
Die amtlichen Bezeichnungen dürfen nicht in Wortverbindungen oder zur Beschreibung anderer Fasern genutzt werden. Unzulässig wären etwa Bezeichnungen wie „Seiden-Polyester“ oder „Kaschmir-Optik“.
c. Die verwendete Bezeichnung muss den tatsächlichen Fasereigenschaften entsprechen
Eine Faserbezeichnung darf nur dann verwendet werden, wenn die Faser tatsächlich den im Anhang I beschriebenen Eigenschaften entspricht. So darf beispielsweise nur eine Faser aus Kokons seidenspinnender Insekten als „Seide“ bezeichnet werden – nicht jedoch eine synthetische Faser, die lediglich den Glanz oder die Haptik von Seide nachahmt.
4. Dürfen Abkürzungen (z. B. CO, PES) verwendet werden?
Nein, die Verwendung von Abkürzungen für Faserbezeichnungen (wie z.B. CO für Baumwolle oder PES für Polyester) ist grundsätzlich nicht zulässig, Artikel 14 Abs. 3 EU-Textilkennzeichnungsverordnung.
Dieses Verbot soll die Klarheit und die Verständlichkeit der Produktinformationen für Verbraucher sicherstellen.
Spezielle Regeln für Fasertypen und Toleranzen
1. Wie müssen Wolle, Seide und Tierhaare gekennzeichnet werden?
Die oben allgemeinen Grundsätze der Faserbezeichnung führen zu konkreten Vorgaben für bestimmte Tier- und Naturfasern.
Nachfolgend die wichtigsten Regeln im Überblick:
Regeln für Wolle
Die Bezeichnung „Wolle“ bezieht sich ausschließlich auf die Faser vom Fell des Schafes. Der Name muss genau in dieser Form verwendet werden.
Bei der Wolle eines Schafes darf die Rasse nicht als Zusatz des Fasernamens genannt werden. Zulässig wäre es dagegen, die Rasse des Schafes getrennt von der Bezeichnung der Faser anzugeben, wie beispielsweise:"100 % Wolle (Merinowolle)"
Richtig:
„100 % Wolle (Merino)“
(Die amtliche Faserbezeichnung „Wolle“ wird korrekt verwendet. Der Zusatz „(Merino)“ nennt nur die Schafrasse und ist deutlich abgesetzt – dadurch entsteht keine Vermischung von amtlicher Bezeichnung und beschreibendem Zusatz.)
Falsch:
„100 % Merinowolle“
(Der Begriff vermischt die Tier- bzw. Rassenbezeichnung („Merino“) mit der amtlichen Faserbezeichnung („Wolle“) und verstößt damit gegen Art. 5 Abs. 1, die Pflicht zur Verwendung der genauen amtlichen Bezeichnung.)
Spezialregeln für Edelhaare (Kaschmir, Alpaka, Yak)
Zu dieser Gruppe gehören Haare bestimmter Tierarten, wie Alpaka, Lama, Kamel, Kaschmirziege, Angoraziege, Angorakaninchen, Vikunja, Yak, Guanako, Kaschgoraziege, Biber und Fischotter.
Der Vorteil dieser Fasern ist ihre Kennzeichnungsflexibilität: Sie dürfen den Tiernamen sowohl alleinstehend verwenden (z. B. "100 % Kaschmir") als auch den Namen mit dem Zusatz „Haar“ oder „Wolle“ kombinieren (z. B. "Yakwolle" oder "Kamelhaar").
Die Verordnung erlaubt diese Wahl, da die Tierart selbst die Faser bereits eindeutig identifiziert.
Richtig:
- "100 % Kaschmir"
- "80 % Kamelhaar, 20 % Schurwolle"
- "100 % Yakwolle"
(Die Tierart wird eindeutig genannt; alle Bezeichnungen sind in Anhang I Nr. 2 der EU-Textilkennzeichnungsverordnung ausdrücklich zugelassen.)
Falsch:
- "100 % Tierhaar"
(Tierhaar“ ist eine Sammelbezeichnung für verschiedene Tierhaare, die nach der Textilkennzeichnungsverordnung nur für sonstige Tierhaare (Anhang I Nr. 3) verwendet werden darf – also z. B. für Rinder-, Hausziegen- oder Rosshaare.
Edelhaare wie Kaschmir, Yak oder Kamel sind hingegen eigenständig in Nr. 2 aufgelistet und müssen mit der konkreten Tierart bezeichnet werden. Die Angabe „Tierhaar“ wäre daher zu unbestimmt und verstößt gegen Art. 5 Abs. 1, der eine eindeutige Faserbezeichnung verlangt.)
- "80 % Edelwolle, 20 % Schurwolle"
(„Edelwolle“ ist keine amtlich zugelassene Textilfaserbezeichnung nach Anhang I. Der Begriff ist rein werblich und nicht eindeutig, da er keine konkrete Tierart nennt. Er verstößt damit gegen Art. 5 Abs. 1 (Pflicht zur Verwendung amtlicher Bezeichnungen) und kann zusätzlich irreführend im Sinne von Art. 5 Abs. 2 sein, weil unklar bleibt, ob es sich um Kaschmir, Alpaka oder eine andere Edelhaar-Faser handelt.)
Regeln für sonstige Tierhaare
Für Tierhaare, die nicht zu den Edelhaaren zählen (also nicht z. B. Kaschmir, Alpaka oder Yak), gelten eigene Bezeichnungsregeln.
Die Bezeichnung "Tierhaar" oder "Haar" darf mit aber auch ohne Angabe der Tiergattung genutzt werden (z. B. "Rinderhaar", "Hausziegenhaar", "Rosshaar" oder eben nur "Tierhaar").
Aber Achtung: Das gilt nur für die Haare von verschiedenen Tieren, soweit diese nicht unter den Nummern 1 und 2 der in Anhang I dargestellten Liste genannt sind.
Richtig:
- "100 % Tierhaar"
- "80 % Rosshaar, 20 % Polyester"
- "60 % Hausziegenhaar, 40 % Baumwolle"
(Diese Tierarten fallen nicht unter die speziellen Kategorien „Wolle“ oder „Edelhaar“. Die Bezeichnungen „Rosshaar“, „Hausziegenhaar“ oder „Tierhaar“ sind daher zulässig.)
Falsch:
- "100 % Kaschmirhaar"
(Kaschmir“ ist in Nr. 2 des Anhangs I ausdrücklich als Edelhaar aufgeführt. Edelhaare dürfen nach der Verordnung den Tiernamen alleinstehend oder in Verbindung mit „Wolle“/„Haar“ führen (z. B. „100 % Kaschmir“ oder „100 % Kamelhaar“). Die allgemeine Kategorie „Tierhaar“ ist dafür nicht zulässig.)
- "90 % Schafhaar, 10 % Polyester"
(Haare des Schafs sind in Nr. 1 des Anhangs I geregelt und müssen als „Wolle“ oder – wenn vom lebenden Tier gewonnen – als „Schurwolle“ bezeichnet werden. Die Angabe „Schafhaar“ ist keine zulässige Textilfaserbezeichnung.)
Das Verbot von Seiden-Zusätzen ("Wildseide")
Die Bezeichnung „Seide“ ist in der EU-Textilkennzeichnungsverordnung besonders streng geregelt. Sie darf nur für Fasern verwendet werden, die ausschließlich aus den Kokons seidenspinnender Insekten gewonnen werden.
In der Faserkennzeichnung ist daher ausschließlich der Begriff „Seide“ zulässig – und zwar genau in dieser Form.
Die Verordnung enthält hierzu folgende zentrale Vorgaben:
Ausschließlichkeit der Bezeichnung „Seide“
Zur Angabe des Fasergehalts darf nur exakt die Bezeichnung „Seide“ verwendet werden. Andere Begriffe, Zusätze oder Abwandlungen sind nicht erlaubt.
Unzulässige Zusätze und Wortverbindungen
Zusätze, die die Faser näher beschreiben sollen – etwa „Tussahseide“, „Wildseide“, „Naturseide“ oder „echte Seide“ – sind nicht zulässig.
Solche Bezeichnungen verstoßen gegen das in Artikel 5 Absatz 2 geregelte Verbot von Wortverbindungen, weil sie die amtliche Bezeichnung verändern oder erweitern. Dadurch könnte beim Verbraucher der falsche Eindruck verschiedener Seidenarten entstehen, obwohl die Verordnung nur eine einheitliche Bezeichnung vorsieht.
Keine Verwendung des Begriffs „Seide“ für Endlosfasern anderer Art
Der Begriff „Seide“ darf nicht zur Beschreibung der Form oder besonderen Aufmachung von Textilfasern als Endlosfasern verwendet werden.
Damit soll verhindert werden, dass chemisch hergestellte Fasern (z. B. Polyester oder Viskose), die typische Merkmale von Seidenfäden (wie Glanz, Glätte oder große Länge) aufweisen, fälschlich als seidenähnlich beworben werden.
Daher sind Bezeichnungen wie „Seiden-Polyester-Endlosfaser“ oder „künstliche Seide“ unzulässig, wenn sie die Form oder Beschaffenheit eines nicht-seidenen Filaments beschreiben.
Richtig:
Das Etikett verwendet die korrekte Faserbezeichnung: "100 % Polyester (Endlosfaser)".
(Der Begriff „Seide“ wird korrekt verwendet – ausschließlich für echte Seidenfasern. Polyester darf als Endlosfaser beschrieben werden, aber nicht mit dem Begriff „Seide“ kombiniert werden.)
Falsch:
Ein Etikett wirbt für ein Garn als: "Seiden-Polyester-Endlosfaser" oder "Synthetische Seide"
(Hier wird „Seide“ nicht als Faserbezeichnung, sondern als beschreibendes Wort für eine synthetische Endlosfaser verwendet. Das ist nach Art. 5 Abs. 2 unzulässig, weil der Begriff „Seide“ synthetische Fasern nicht kennzeichnen darf, selbst wenn sie seidenähnlich aussehen.)
2. Textilkennzeichnung: Reine Erzeugnisse & die Toleranzgrenzen
Wie sind reine Textilerzeugnisse zu kennzeichnen?
Reine Textilerzeugnisse sind Erzeugnisse, die ausschließlich aus einer Faser bestehen.
Die Kennzeichnung muss daher genau diese Faser enthalten - etwa: „Baumwolle 100 %“ oder „100 % Baumwolle“
Gemäß Artikel 7 I der EU-Textilkennzeichnungsverordnung dürfen bei reinen Textilerzeugnissen ergänzend folgende freiwillige Zusätze verwendet werden:
- „100 %“
- „rein“
- „ganz“
Diese dürfen auch kombiniert werden, etwa als „100 % reine Baumwolle“ oder „ganz aus Baumwolle“.
Für Mischgewebe (also Textilerzeugnisse mit mehreren Faserarten) sind solche Zusätze nicht zulässig, da sie eine irreführende Vorstellung von Reinheit vermitteln würden.
Richtig:
- „100 % Baumwolle“
- „Reine Wolle“
- „Ganz aus Seide“
- „100 % reine Baumwolle“
(Die Angaben beziehen sich jeweils auf ein Erzeugnis aus nur einer Faserart. Die Zusätze „rein“ oder „100 %“ sind erlaubt, aber nicht verpflichtend.)
Falsch:
- „100 % Baumwolle und Polyester“
(Widerspruch in sich – kein reines Erzeugnis, da mehrere Fasern enthalten sind.)
- „Reine Baumwollmischung“
(Irreführend, da „rein“ nur für 100 %-Erzeugnisse zulässig ist.)
- „Ganz Baumwolle mit Elastananteil“
(Ebenfalls unzulässig – Mischgewebe darf nicht als „ganz“ bezeichnet werden.)
Die Verwendung der Zusätze „100 %“, „rein“ oder „ganz“ ist nicht vorgeschrieben, auch wenn das Produkt die Kriterien erfüllt. Sie dienen lediglich der freiwilligen werblichen Verstärkung der Angabe. Dies hat der Europäische Gerichtshof (EuGH) ausdrücklich bestätigt.
Welche 2%- und 5%-Grenzen gelten für Fremdfasern?
Die EU-Textilkennzeichnungsverordnung trägt den technischen Gegebenheiten bei der Produktion Rechnung, indem sie geringfügige, technisch unvermeidbare Fremdfasern toleriert, ohne dass das Erzeugnis seinen Status als "rein" verliert.
Allgemeine Toleranz (Regelfall)
Ein Textilerzeugnis darf als ausschließlich aus einer Faser bestehend behandelt werden, wenn es einen Gewichtsanteil an Fremdfasern von nicht mehr als 2% enthält.
Die 2 %-Toleranz gilt nur für unbeabsichtigte, technisch unvermeidbare Fremdfasern – nicht für absichtlich zugesetzte Materialien, selbst wenn deren Anteil gering ist, Art. 7 Abs. 2 EU-Textilkennzeichnungsverordnung.
Richtig:
Ein Wollpullover besteht aus 98 % Wolle und 2 % Polyesterfasern, die durch den maschinellen Herstellungsprozess unbeabsichtigt in das Garn gelangt sind. Der Pullover darf als „100 % Wolle“ gekennzeichnet werden, da der Fremdfaseranteil technisch bedingt und innerhalb der zulässigen 2 %-Toleranz liegt.
Falsch:
Ein T-Shirt besteht aus 98 % Wolle und 2 % Elasthan (um es dehnbarer zu machen). Hier liegt keine technisch unvermeidbare Verunreinigung vor, sondern eine gezielte Beimischung. Das Produkt darf daher nicht als „100 % Baumwolle“ bezeichnet werden.
Sonder-Toleranz (Streichverfahren)
Für Textilerzeugnisse, die im Streichverfahren hergestellt werden (z. B. bestimmte Wollgarne, Filze oder Kammzugprodukte), gilt eine erweiterte Toleranzgrenze:
Das Erzeugnis darf als aus einer einzigen Faser bestehend behandelt werden, wenn der Fremdfaseranteil höchstens 5 % beträgt - vorausgesetzt, dieser Anteil ist technisch unvermeidbar und nicht das Ergebnis einer gezielten Beimischung, Art. 7 Abs. 2 EU-Textilkennzeichnungsverordnung.
Richtig:
Ein Wollfilz wird im Streichverfahren hergestellt. Trotz sorgfältiger Verarbeitung enthält das Material 4 % synthetische Fasern, die durch Produktionsrückstände in der Anlage unbeabsichtigt eingemischt wurden.
Da die Fremdfasern technisch unvermeidbar sind und der Anteil unter 5 % liegt, darf der Filz als „100 % Wolle“ gekennzeichnet werden.
Falsch:
Ein Garn enthält 4 % Polyamidfasern, die bewusst zugesetzt werden, um die Reißfestigkeit zu erhöhen. Obwohl der Anteil die 5 %-Grenze nicht überschreitet, ist dies keine technisch unvermeidbare Verunreinigung, sondern eine gezielte Beimischung.
Das Garn darf daher nicht als „100 % Wolle“ bezeichnet werden.
Die 5 %-Toleranz gilt ausschließlich für Produkte aus Streichgarnen oder vergleichbaren Verfahren, bei denen sich geringe Faserverunreinigungen technisch nicht vermeiden lassen. Für alle anderen Textilerzeugnisse bleibt es bei der allgemeinen 2 %-Grenze (s.o.).
Der Sonderfall Schurwolle (strenge 0,3%-Grenze)
Für die Qualitätsbezeichnung „Schurwolle“ gilt nach Artikel 8 III EU-Textilkennzeichnungsverordnung eine wesentlich strengere Vorgabe als für andere Fasern.
Die Bezeichnung „Schurwolle“ darf ausschließlich für neue, ungebrauchte Wolle verwendet werden,
die nicht recycelt und nicht aus Alttextilien zurückgewonnen wurde. Sie steht damit für Erstverwendung und höchste Materialreinheit – weshalb der Gesetzgeber die zulässige Fremdfasergrenze besonders niedrig angesetzt hat.
Der Fremdfaseranteil darf hier höchstens 0,3 % betragen - selbst dann, wenn dieser Anteil bei guter Herstellungspraxis technisch unvermeidbar ist.
Diese enge Toleranzgrenze gilt für alle Erzeugnisse, die als „Schurwolle“ bezeichnet werden, einschließlich solcher, die im Streichverfahren hergestellt werden.
Richtig:
Ein Wollmantel besteht aus 99,8 % Schurwolle und 0,2 % Fremdfasern, die beim Spinnen technisch nicht vermeidbar waren. Die Kennzeichnung „100 % Schurwolle“ ist zulässig, da der Fremdfaseranteil die Grenze von 0,3 % nicht überschreitet.
Falsch:
Ein im Streichverfahren hergestellter Wollstoff enthält 4 % Fremdfasern.
Das Produkt darf als „100 % Wolle“ bezeichnet werden, aber nicht als „Schurwolle“, da die 0,3 %-Grenze für diese Qualitätsbezeichnung deutlich überschritten ist.
3. Sonderbezeichnungen (Seide, Schurwolle, Halbleinen)
Bezeichnung „Seide“ – streng reglementiert und nur für echte Naturseide zulässig
Die Bezeichnung „Seide“ ist nur für Fasern zulässig, die aus den Kokons seidenspinnender Insekten gewonnen werden.
Dazu gehören insbesondere Fasern der Seidenspinnerraupe (Bombyx mori) oder verwandter Arten.
Damit soll sichergestellt werden, dass Verbraucher den Begriff „Seide“ nur mit echter Naturseide in Verbindung bringen und nicht mit künstlich hergestellten, seidenähnlichen Stoffen.
Aus diesem Grundsatz ergeben sich zwei zentrale Verbote:
Keine Zusätze oder Wortverbindungen in der Rohstoffangabe
In der Faserkennzeichnung darf nur die exakte Bezeichnung „Seide“ verwendet werden.
Zusätze oder Wortkombinationen wie „Tussahseide“, „Wildseide“, „Naturseide“ oder „echte Seide“ sind unzulässig, wenn sie Teil der Pflichtangabe zur Faserzusammensetzung sind.
Für Marketing oder Produktbeschreibungen darf ergänzend auf besondere Seidenarten (z. B. „Tussah“) hingewiesen werden – aber eben nicht innerhalb der Faserzusammensetzung. In der Pflichtkennzeichnung darf ausschließlich „Seide“ stehen.
Kein Gebrauch des Begriffs „Seide“ für künstliche oder seidenähnliche Fasern
Der Begriff „Seide“ darf nicht genutzt werden, um die Form, Struktur oder Beschaffenheit anderer (nicht-seidener) Fasern zu beschreiben – etwa von Polyester- oder Viskose-Endlosfasern, die lediglich etwa glänzend, glatt oder weich sind.
Ziel dieser Regel ist es, zu verhindern, dass Verbraucher synthetische oder regenerierte Fasern fälschlich für echte Seide halten.
Richtig:
„100 % Seide“
(Sollte die Faser tatsächlich aus den Kokons seidenspinnender Insekten stammen.)
Falsch:
„100 % Tussahseide“ oder „100 % Wildseide“
(Verstoß gegen das Verbot von Wortverbindungen – die Angabe verändert die amtliche Bezeichnung „Seide“.)
„100 % Polyester-Seide“ oder „Synthetische Seide“
(Unzulässig, da der Begriff „Seide“ hier fälschlich zur Beschreibung einer nicht-seidenen Endlosfaser verwendet wird.)
Die strengen Kriterien für "Schurwolle"
Für die Qualitätsbezeichnung „Schurwolle“ gilt nach Artikel 8 III EU-Textilkennzeichnungsverordnung eine wesentlich strengere Vorgabe als für andere Fasern.
Die Bezeichnung „Schurwolle“ darf ausschließlich für neue, ungebrauchte Wolle verwendet werden,
die nicht recycelt und nicht aus Alttextilien zurückgewonnen wurde. Sie steht damit für Erstverwendung und höchste Materialreinheit – weshalb der Gesetzgeber die zulässige Fremdfasergrenze besonders niedrig angesetzt hat.
Der Fremdfaseranteil darf hier höchstens 0,3 % betragen - selbst dann, wenn dieser Anteil bei guter Herstellungspraxis technisch unvermeidbar ist.
Diese enge Toleranzgrenze gilt für alle Erzeugnisse, die als „Schurwolle“ bezeichnet werden, einschließlich solcher, die im Streichverfahren hergestellt werden.
Richtig:
Ein Wollmantel besteht aus 99,8 % Schurwolle und 0,2 % Fremdfasern, die beim Spinnen technisch nicht vermeidbar waren. Die Kennzeichnung „100 % Schurwolle“ ist zulässig, da der Fremdfaseranteil die Grenze von 0,3 % nicht überschreitet.
Falsch:
Ein im Streichverfahren hergestellter Wollstoff enthält 4 % Fremdfasern.
Das Produkt darf als „100 % Wolle“ bezeichnet werden, aber nicht als „Schurwolle“, da die 0,3 %-Grenze für diese Qualitätsbezeichnung deutlich überschritten ist.
Wann ein Produkt als „Halbleinen“ bezeichnet werden darf
Die Bezeichnung „Halbleinen“ ist eine spezifische Zusammensetzungsbezeichnung für Gewebe mit einer klaren Mischstruktur.
Diese Bezeichnung ist nur zulässig, wenn das Erzeugnis die folgenden zwei Faseranordnungen aufweist:
- Die Kette muss aus reiner Baumwolle bestehen.
- Der Schuss muss aus reinem Leinen (Flachs) bestehen.
- Zusätzlich muss der Anteil des Leinens (Flachs) mindestens 40% des Gesamtgewichts des entschlichteten Gewebes ausmachen (≥40%).
Um diese Zusammensetzung für Verbraucher transparent zu machen, ist neben der Kurzbezeichnung „Halbleinen“ auch eine präzise Beschreibung von Kette und Schuss anzugeben.
Ein Tischtuch hat eine Kette aus Baumwolle und einen Schuss aus Leinen, der 45 % des Gesamtgewichts ausmacht – (also über der vorgeschriebenen 40 %-Grenze liegt).
Richtig:
Qualitätsbezeichnung: "Halbleinen"
Zusammensetzungsangabe: "Kette reine Baumwolle – Schuss reiner Flachs (Leinen)"
Die Bezeichnung „Halbleinen“ ist hier zulässig, weil
- die Kette ausschließlich aus Baumwolle,
- der Schuss ausschließlich aus Leinen (Flachs) besteht und
- der Leinenanteil mindestens 40 % beträgt.
Der Begriff „Flachs“ ist die amtliche Faserbezeichnung nach Anhang I Nr. 7 der Verordnung. In der Praxis darf zur besseren Verständlichkeit auch „Flachs (Leinen)“ verwendet werden – dies entspricht dem Verbraucherwortlaut, ohne gegen die Verordnung zu verstoßen.
Falsch:
Kennzeichnung: "Halbleinen"
Tatsächliche Zusammensetzung: "Kette Baumwolle – Schuss Viskose"
Diese Kennzeichnung ist nicht zulässig, weil der Schuss nicht aus Leinen (Flachs) besteht und damit die Mindestanforderungen für die Bezeichnung „Halbleinen“ nicht erfüllt werden.
Die Zusammensetzungsangabe („Kette … / Schuss …“) ist eine ergänzende Pflichtangabe. Sie ersetzt nicht, sondern begleitet die Kurzbezeichnung „Halbleinen“. So soll der Verbraucher nachvollziehen können, wie das Gewebe technisch aufgebaut ist und welche Faser in welcher Struktur verwendet wurde.
Textilkennzeichnung: Regeln für Mischungen (Multifaser/Mehrkomponenten)
1. Unterschied zwischen Multifaser- und Mehrkomponenten-Erzeugnissen
Multifaser-Textilerzeugnis
Ein Multifaser-Textilerzeugnis besteht aus einem einzigen Material, in dem mehrere verschiedene Fasern miteinander vermischt sind. Die Kennzeichnung bezieht sich also auf die Faserzusammensetzung innerhalb des Materials selbst.
Ein Garn oder Stoff aus 80 % Baumwolle und 20 % Polyester ist ein Multifaser-Textilerzeugnis, da die unterschiedlichen Fasern gleichmäßig im Gewebe oder Garn vermischt sind.
Die Faserkennzeichnung würde entsprechend lauten: „80 % Baumwolle, 20 % Polyester“.
Mehrkomponenten-Textilerzeugnis
Ein Mehrkomponenten-Textilerzeugnis besteht dagegen aus mehreren deutlich unterscheidbaren Teilen (Komponenten), die jeweils aus unterschiedlichen Materialien oder Faserzusammensetzungen bestehen. Die Kennzeichnung bezieht sich hier also auf den Aufbau des gesamten Produkts.
Eine Jacke mit einem Oberstoff aus Wolle und einem Futter aus Acetat ist ein Mehrkomponenten-Textilerzeugnis,
da die einzelnen Bestandteile - Oberstoff, Futter, ggf. Ärmel oder Besatz - unterschiedliche Fasergehalte aufweisen und nicht miteinander vermischt sind.
Die Kennzeichnung müsste für jede Hauptkomponente getrennt erfolgen, etwa: „Oberstoff: 100 % Wolle / Futter: 100 % Acetat“.
2. Kennzeichnung von Multifaser-Textilerzeugnissen
Die Faserzusammensetzung muss stets klar und wahrheitsgemäß angegeben werden.
Grundregel: Absteigende Reihenfolge und exakte Gewichtsprozente
Gemäß Artikel 9 der EU-Textilkennzeichnungsverordnung muss die Bezeichnung und der Gewichtsanteil aller im Erzeugnis enthaltenen Fasern
- in absteigender Reihenfolge (beginnend mit dem höchsten Anteil) und
- in exakten Gewichtsprozenten
angegeben werden.
Richtig:
"80 % Baumwolle
20 % Polyester"
Falsch:
"20 % Polyester
80 % Baumwolle"
(Die Reihenfolge ist verkehrt, weil die Faser mit dem höheren Anteil (Baumwolle) nicht zuerst genannt wird. Eine solche Darstellung könnte Verbraucher über den tatsächlichen Materialschwerpunkt des Textils täuschen.)
Vereinfachung: Die ≤5% und ≤15% Sammelbezeichnung „sonstige Fasern“
Für Textilerzeugnisse, deren genaue Zusammensetzung zum Zeitpunkt der Herstellung schwierig zu bestimmen ist, sind folgende Vereinfachungen für geringe Anteile zulässig (Art. 9 Abs. 2):
- Fasern mit einem Einzelanteil von bis zu 5% dürfen als „sonstige Fasern“ bezeichnet werden.
- Mehrere Fasern, deren Gesamtanteil bis zu 15% beträgt, dürfen ebenfalls als „sonstige Fasern“ bezeichnet werden.
Hinweis: Der Gewichtsanteil muss in beiden Fällen zusätzlich angegeben werden.
Richtig:
„80 % Baumwolle, 15 % Polyester, 5 % sonstige Fasern“
(Die Bezeichnung „sonstige Fasern“ deckt den geringen Anteil verschiedener Restfasern korrekt ab. Der Gewichtsanteil wird angegeben.)
Falsch:
„80 % Baumwolle, 20 % sonstige Fasern“
(Unzulässig, da der Gesamtanteil der unter „sonstige Fasern“ zusammengefassten Fasern den Grenzwert von 15 % überschreitet.)
Notlösung: „Diverse Faserarten“ bei Unsicherheit
Ist die Zusammensetzung zum Zeitpunkt der Herstellung grundsätzlich schwierig zu bestimmen, dürfen die Bezeichnungen „diverse Faserarten“ oder „Erzeugnis unbestimmter Zusammensetzung“ verwendet werden (Art. 9 Abs. 4 EU-Textilkennzeichnungsverordnung).
Richtig:
„Erzeugnis unbestimmter Zusammensetzung – hergestellt aus Recyclingfasern“
(Zulässig, da die genaue Faserstruktur der verwendeten Recyclingmaterialien objektiv nicht bestimmbar ist.)
Falsch:
„100 % diverse Faserarten“ bei Neuware aus Mischgarnen
(Unzulässig, wenn die Faserzusammensetzung grundsätzlich bestimmbar wäre – etwa bei einem Mischgewebe aus Baumwolle und Polyester.)
Umgang mit nicht-gelisteten Fasern
Multifaser-Textilerzeugnisse, die Fasern enthalten, die nicht in Anhang I der EU-Textilkennzeichnungsverordnung aufgeführt werden, können gemäß gem. Artikel 9 Abs. 5 der Verordnung als "sonstige Fasern" bezeichnet werden, wobei ihr Gewichtsanteil unmittelbar davor oder dahinter anzugeben ist.
Diese Regelung gilt insbesondere für neue oder innovative Faserarten, die noch nicht offiziell in Anhang I erfasst sind (z. B. aus biologisch abbaubaren, recycelten oder experimentellen Materialien).
Richtig:
„90 % Baumwolle, 10 % sonstige Fasern“
(Die 10 % bestehen aus einer neu entwickelten, noch nicht gelisteten Biopolymerfaser.)
Falsch:
„90 % Baumwolle, 10 % Biopolymerfaser“
(Unzulässig, da „Biopolymerfaser“ keine amtlich zugelassene Bezeichnung nach Anhang I ist. Der Anteil muss stattdessen als „sonstige Fasern“ angegeben werden.)
3. Kennzeichnung von Mehrkomponenten-Textilerzeugnissen
Besteht ein Textilerzeugnis aus mehreren unterschiedlichen Textilteilen, gelten besondere Kennzeichnungspflichten. Entscheidend ist, dass der Verbraucher für jede wesentliche Komponente die zutreffende Faserzusammensetzung erkennen kann.
Regel der separaten Kennzeichnung
Jede Textilkomponente, die sich im Fasergehalt von anderen unterscheidet, muss separat mit ihrem Fasergehalt gekennzeichnet werden (Art. 11 Abs. 1 EU-Textilkennzeichnungsverordnung).
Ein Mantel besteht aus einem Oberstoff aus Wolle, einem Futter aus Acetat und einem Besatz aus Polyester.
Richtig:
"Oberstoff: 100 % Wolle
Futter: 100 % Acetat
Besatz: 100 % Polyester"
Falsch:
"100 % Wolle"
(Unzulässig, weil die abweichenden Materialien von Futter und Besatz nicht angegeben werden. Die Kennzeichnung muss alle Hauptbestandteile getrennt ausweisen:)
Erleichterung bei Kleinteilen
Kleinere Bestandteile, die nicht zu den Hauptfutterstoffen gehören und weniger als 30 % des Gesamtgewichts des Textilerzeugnisses ausmachen, müssen nicht separat gekennzeichnet werden, Art. 11 Abs. 2 EU-Textilkennzeichnungsverordnung.
Ein Wollmantel hat dekorative Taschenklappen aus Polyester, die nur 5 % des Gesamtgewichts ausmachen. Diese Kleinteile dürfen unberücksichtigt bleiben, eine separate Faserangabe ist nicht erforderlich.
Sets und Garnituren
Textilerzeugnisse, die nach Handelsbrauch eine Einheit bilden und denselben Fasergehalt aufweisen, benötigen nur eine einzige Kennzeichnung, Art. 11 Abs. 3 EU-Textilkennzeichnungsverordnung.
Ein Hosenanzug aus demselben Wollstoff (Jacke und Hose) gilt als einheitliches Set.
Richtig:
"100 % Wolle"
(Eine gemeinsame Kennzeichnung genügt, da beide Teile identisch zusammengesetzt sind.)
Zwar auch korrekt, aber doppelt und damit unnötig
Jacke: 100 % Wolle / Hose: 100 % Wolle
(Die Textilkennzeichnungsverordnung erlaubt hier eine gemeinsame Kennzeichnung.)
Ergänzende Regeln & Spezifische Produkte
1. Kennzeichnung komplexer Textil-Strukturen
Für bestimmte Textilerzeugnisse gelten nach der Verordnung besondere Kennzeichnungsregeln. Diese sind in Artikel 13 in Verbindung mit Anhang IV der EU-Textilkennzeichnungsverordnung im Detail festgelegt:
| Erzeugnisse | Etikettierungs- und Kennzeichnungsvorschriften | |
| Büstenhalter | Die Faserzusammensetzung ist auf dem Etikett und der Kennzeichnung entweder durch Angabe der Zusammensetzung des gesamten Erzeugnisses oder gobal oder getrennt durch Angabe der Zusammensetzung der einzelnen Teile dieser Artikel anzugeben: äußeres und inneres Gewebe der Oberfläche der Schalen und des Rückenteils. | 1 |
| Korsetts und Hüfthalter | Die Faserzusammensetzung ist auf dem Etikett und der Kennzeichnung entweder durch Angabe der Zusammensetzung des gesamten Erzeugnisses oder global oder getrennt durch Angabe der Zusammensetzung der einzelnen Teile dieser Artikel anzugeben: Vorderteil, Rückenteil und Seitenteile. | 2 |
| Korseletts | Die Faserzusammensetzung ist auf dem Etikett und der Kennzeichnung entweder durch Angabe der Zusammensetzung des gesamten Erzeugnisses oder global oder getrennt durch Angabe der Zusammensetzung der einzelnen Teile dieser Artikel anzugeben: äußeres und inneres Gewebe der Oberfläche der Schalen, der verstärkten Vorderteile, der verstärkten Rückenteile und der Seitenteile. | 3 |
| Andere, oben nicht aufgeführte Miederwaren | Die Faserzusammensetzung ist entweder durch Angabe der Zusammensetzung des gesamten Erzeugnisses oder global oder getrennt durch Angabe der Zusammensetzung der verschiedenen Teile dieser Artikel anzugeben. Diese Etikettierung ist für Teile, die weniger als 10 % des Gesamtgewichts des Erzeugnisses ausmachen, nicht vorgeschrieben. | 4 |
| Alle Miederwaren | Die getrennte Etikettierung und Kennzeichnung der verschiedenen Teile der Miederwaren hat so zu erfolgen, dass für den Verbraucher ohne Schwierigkeiten erkennbar ist, auf welchen Teil des Erzeugnisses sich die auf dem Etikett oder der Kennzeichnung angegebenen Hinweise beziehen. | 5 |
| Ausgebrannte Textilerzeugnisse | Die Faserzusammensetzung ist für das Gesamterzeugnis anzugeben - sie kann durch getrennte Nennung der Zusammensetzung des Grundmaterials und der der Ausbrennung unterworfenen Teile angegeben werden. Diese beiden Bestandteile sind ausdrücklich zu nennen. | 6 |
| Stickerei-Textilerzeugnisse | Die Faserzusammensetzung ist für das Gesamterzeugnis anzugeben - sie kann durch getrennte Nennung der Zusammensetzung des Grundmaterials und der Stickereifäden angegeben werden. Diese beiden Bestandteile sind ausdrücklich zu nennen. Diese Etikettierung oder Kennzeichnung ist nur für bestickte Teile vorgeschrieben, die mindestens 10 % der Oberfläche des Erzeugnisses ausmachen. | 7 |
| Garn mit einem Kern und einer Umspinnung aus verschiedenen Faserarten, das als solches dem Verbraucher auf dem Markt bereitgestellt wird | Die Zusammensetzung ist für das Gesamterzeugnis anzugeben - sie kann durch getrennte Nennung der Zusammensetzung des Kerns und der Umspinnung angegeben werden. Diese beiden Bestandteile sind ausdrücklich zu nennen. | 8 |
| Textilerzeugnisse aus Samt oder Plüsch oder ähnlichen Stoffen | Hier ist die Faserzusammensetzung für das Gesamterzeugnis anzugeben - sie kann, wenn diese Erzeugnisse aus einer Grundschicht und einer unterschiedlichen Nutzschicht bestehen und aus verschiedenen Fasern zusammengesetzt sind, getrennt für diese Bestandteile angegeben werden. Diese beiden Bestandteile sind ausdrücklich zu nennen. | 9 |
| Bodenbeläge und Teppiche, bei denen die Grundschicht und die Nutzschicht aus verschiedenen Fasern bestehen | Die Faserzusammensetzung braucht nur für die Nutzschicht angegeben zu werden. Die Nutzschicht ist ausdrücklich zu nennen. | 10 |
2. Deklaration von Fremdmaterialien
Ignorierte Anteile: Toleranzen für dekorative und antistatische Fasern
Bestimmte Fasern mit rein dekorativer oder technischer Funktion müssen nicht in die prozentuale Faserzusammensetzung aufgenommen werden. Diese Ausnahme soll verhindern, dass rein optische oder funktionale Zusätze die Materialkennzeichnung unnötig verkomplizieren.
Dekorationsfasern
Sichtbare, isolierbare Fasern mit rein dekorativer Wirkung dürfen unberücksichtigt bleiben, wenn sie nicht mehr als 7 % des Gewichts des Fertigerzeugnisses ausmachen.
Beispiele sind Zierfäden, Glanzgarne, Lurex- oder Effektfasern.
Antistatische Fasern
Metallfasern oder andere Funktionsfasern, die ausschließlich zur antistatischen Wirkung eingesetzt werden,
müssen ebenfalls nicht mitgerechnet werden, sofern ihr Anteil höchstens 2 % des Gewichts des Textilerzeugnisses beträgt.
Ignorierte Anteile: Toleranzen für dekorative und antistatische Fasern
Bestimmte Fasern mit rein dekorativer oder technischer Funktion müssen nicht in die prozentuale Faserzusammensetzung aufgenommen werden.
Diese Ausnahme soll verhindern, dass rein optische oder funktionale Zusätze die Materialkennzeichnung unnötig verkomplizieren.
a) Dekorationsfasern
Sichtbare, isolierbare Fasern mit rein dekorativer Wirkung dürfen unberücksichtigt bleiben,
wenn sie nicht mehr als 7 % des Gewichts des Fertigerzeugnisses ausmachen.
Beispiele sind Zierfäden, Glanzgarne, Lurex- oder Effektfasern.
b) Antistatische Fasern
Metallfasern oder andere Funktionsfasern, die ausschließlich zur antistatischen Wirkung eingesetzt werden,
müssen ebenfalls nicht mitgerechnet werden, sofern ihr Anteil höchstens 2 % des Gewichts des Textilerzeugnisses beträgt.
Richtig:
Ein Pullover besteht aus 95 % Baumwolle und 5 % Lurex-Fäden, die nur zur optischen Zierde dienen. Der Lurex-Anteil liegt unter 7 % und erfüllt eine rein dekorative Funktion.
Die Angabe „100 % Baumwolle“ ist zulässig, da der Glanzfaden nicht in die Faserzusammensetzung einfließen muss.
Falsch:
Ein Pullover besteht aus 90 % Baumwolle, 5 % Polyester und 5 % Lurex-Fäden, die fest ins Gewebe eingearbeitet sind und nicht nur dekorativ, sondern strukturbildend wirken.
In diesem Fall handelt es sich nicht mehr um rein dekorative Fasern. Der Lurex-Anteil muss in die Faserkennzeichnung einbezogen werden, z. B. „90 % Baumwolle, 5 % Polyester, 5 % Metallfaser (Lurex)“.
Kennzeichung von Teilen tierischen Ursprungs
Die EU-Textilkennzeichnungsverordnung verpflichtet Hersteller und Händler, Verbraucher transparent darüber zu informieren, wenn ein Textilerzeugnis Bestandteile tierischen Ursprungs enthält – etwa Leder, Fell, Horn, Bein, Daunen, Federn oder Perlen.
Ziel ist es, Käufer eindeutig darauf hinzuweisen, dass das Produkt nicht ausschließlich aus Textilfasern besteht, sondern tierische Materialien enthält.
Pflichtkennzeichnung: Wortlaut und zulässige Ergänzungen
Jedes Textilerzeugnis, das Teile tierischen Ursprungs enthält, muss beim Bereitstellen auf dem Markt den folgenden Hinweis tragen:
„Enthält nichttextile Teile tierischen Ursprungs“
Dieser Wortlaut ist verbindlich vorgeschrieben und darf nicht verändert oder ersetzt werden. Er darf jedoch ergänzt werden, wenn die Ergänzung klar, sachlich und wahrheitsgemäß ist und das Material näher beschreibt.
Richtig:
- „Enthält nichttextile Teile tierischen Ursprungs (Leder)“
- „Enthält nichttextile Teile tierischen Ursprungs (Hornknöpfe)“
Falsch:
„Mit echten Lederapplikationen“ oder „Mit tierischen Bestandteilen“
(Diese Formulierungen weichen vom vorgeschriebenen Wortlaut ab und sind daher nicht zulässig.)
Wann die Kennzeichnungspflicht greift
Die Kennzeichnungspflicht gilt auch für kleinste oder rein dekorative Bestandteile, die nicht Teil der eigentlichen Faserstruktur sind – etwa:
- ein Hornknopf an einem Hemd,
- ein Lederetikett an einer Jeans oder
- Daunen oder Federn als Füllmaterial einer Jacke.
Ausnahme: Keine Pflicht bei nichttextilen Hauptprodukten
Die Vorschrift gilt nur für Textilerzeugnisse im Sinne der Verordnung, also für Produkte, die vollständig oder zu mindestens 80 % aus Textilfasern bestehen.
Produkte mit einem geringeren Textilanteil – etwa eine reine Lederjacke oder ein Pelzmantel – fallen nicht unter die Kennzeichnungspflicht des Artikels 12 EU-Textilkennzeichnungsverordnung, auch wenn sie Materialien tierischen Ursprungs enthalten.
4. Sonderkennzeichnung für Formaldehyd-behandelte Textilien
Die EU-Textilkennzeichnungsverordnung selbst enthält keine Vorgaben zur Kennzeichnung von chemischen Stoffen. In Deutschland gelten hierfür jedoch ergänzende nationale Regelungen.
Nach § 10 Abs. 3 in Verbindung mit Anlage 9 der Bedarfsgegenständeverordnung (BedGgstV) müssen Textilien, die mit der Haut in Berührung kommen und mehr als 0,15 % freien Formaldehyd enthalten, besonders gekennzeichnet werden.
Der vorgeschriebene Hinweis lautet:
„Enthält Formaldehyd. Es wird empfohlen, das Kleidungsstück zur besseren Hautverträglichkeit vor dem ersten Tragen zu waschen.“
Richtig:
Ein Hemd enthält aufgrund der Veredelung zur Knitterfestigkeit 0,2 % freies Formaldehyd. Die Kennzeichnung mit dem obigen Hinweis ist verpflichtend, da der Grenzwert von 0,15 % überschritten ist und das Kleidungsstück direkten Hautkontakt hat.
Falsch:
Eine Tischdecke enthält 0,1 % Formaldehyd. Hier besteht keine Kennzeichnungspflicht, da der Grenzwert nicht überschritten ist und der Artikel nicht unmittelbar mit der Haut in Berührung kommt.
5. Kennzeichnung von PVC-Fasern (Polyvinylchlorid)
Textilien können auch aus synthetischen Fasern bestehen, die auf Kunststoffbasis hergestellt werden. Eine dieser Fasern ist Polyvinylchlorid (PVC) – ein Material, das vor allem bei technischen Textilien, Regenbekleidung, Planen, Taschenstoffen oder Dekorstoffen verwendet wird.
Da PVC keine Naturfaser ist, sondern ein chemisch hergestellter Polymerkunststoff, gelten für seine Kennzeichnung die gleichen strengen Anforderungen wie für alle anderen synthetischen Fasern: Es darf nur die amtlich zugelassene Faserbezeichnung aus Anhang I der EU-Textilkennzeichnungsverordnung verwendet werden – nicht jedoch chemische Kürzel oder Handelsnamen.
Nach Anhang I Nr. 27 der EU-Textilkennzeichnungsverordnung lautet die zulässige Bezeichnung:
„Polychlorid“
Diese Bezeichnung ist verbindlich in der Kennzeichnung zu verwenden. Abkürzungen oder Fantasiebezeichnungen wie „PVC“, „Vinyl“ oder „Vinylon“ sind nicht erlaubt.
Richtig:
- „100 % Polychlorid“
(offizielle Faserbezeichnung nach Anhang I Nr. 27 EU-Textilkennzeichnungsverordnung)
Falsch:
- „100 % PVC“
(Abkürzung – nach Art. 14 Abs. 3 EU-Textilkennzeichnungsverordnung unzulässig)
- „100 % Vinylfaser“
(kein anerkannter Fasernamen nach der Verordnung)
- „100 % Kunststoff“
(zu unspezifisch – keine eindeutige Faserkennzeichnung)
Die Textilkennzeichnung bezieht sich nur auf die tatsächlichen Fasern des Gewebes. PVC-Beschichtungen oder Folienanteile, die nicht Teil der Faserstruktur, sondern auf der Oberfläche aufgebracht sind (z. B. bei Regenjacken oder Tischdecken), gehören nicht zur Faserzusammensetzung.
In solchen Fällen sollte der Händler zusätzlich – etwa in der Produktbeschreibung – klarstellen, dass das Produkt beschichtet oder laminiert ist, z. B. wie folgt: „Grundgewebe: 100% Polyester, Oberfläche: PVC-beschichtet“.
6. Regeln für Lederimitate und Kunstleder
Die EU-Textilkennzeichnungsverordnung gilt nur für Erzeugnisse aus Textilfasern. Materialien wie Leder, Kunstleder oder Lederimitate fallen nicht unter ihren Anwendungsbereich, weil sie keine Textilfasern im Sinne der Verordnung enthalten.
Trotzdem unterliegen Händler bei der Bewerbung solcher Produkte rechtlichen Anforderungen – insbesondere den Vorschriften des § 5 UWG (Irreführung durch Täuschung). Entscheidend ist, dass der Verbraucher nicht über die tatsächliche Materialbeschaffenheit getäuscht wird.
Ausführliche Informationen zu diesem Thema finden Sie hier: „Leder-Imitat:Welche Vermarktungsbezeichnungen sind juristisch erlaubt?“
7. Vereinfachte Kennzeichnung im Verkauf
Stoffe, die als Meterware verkauft werden, Art. 17 Abs. 4
Bei Textilerzeugnissen, die als Meterware verkauft werden – also etwa Stoffe, die von einer Rolle zugeschnitten werden – gilt eine vereinfachte Kennzeichnungspflicht.
Die Faserzusammensetzung muss nicht an jedem einzelnen abgeschnittenen Stück angegeben werden. Es genügt, wenn die Kennzeichnung deutlich sichtbar auf der Rolle oder dem Stück angebracht ist, das als Ausgangseinheit im Handel bereitgestellt wird.
Ein Stoffladen verkauft Baumwollstoff von einer Rolle. Auf der Rollenverpackung steht: „100 % Baumwolle“. Diese Angabe reicht auch aus – es muss nicht jedes abgeschnittene Teilstück zusätzlich etikettiert werden.
Sets und Verkaufseinheiten mit identischer Zusammensetzung, Art. 11 Abs. 3
Auch bei Produkten, die handelsüblich als Einheit verkauft werden – etwa Sockenpaare, Handschuhe oder Unterwäsche-Sets – sieht die Verordnung eine Erleichterung vor.
Sofern alle Teile der Einheit denselben Fasergehalt aufweisen, ist es ausreichend, wenn nur ein einziges Exemplar der Einheit gekennzeichnet wird.
Bei einem Paar Handschuhe muss nur der rechte oder der linke Handschuh ein Etikett tragen.
Diese Vereinfachungen sollen den Kennzeichnungsaufwand im Handel reduzieren, ohne dass Verbraucher auf wesentliche Materialinformationen verzichten müssen. Wichtig ist, dass die Angabe leicht auffindbar und eindeutig zuzuordnen bleibt.
Textilkennzeichnung: Anbringung der Faserzusammensetzung am Textilerzeugnis
Hier wird die Art und Weise beschrieben, wie die Kennzeichnung der Faserzusammensetzung direkt am Produkt erfolgen muss.
1. Pflicht und Art der Kennzeichnung
Textilerzeugnisse dürfen nur auf dem Markt bereitgestellt werden, wenn sie zur Angabe ihrer Faserzusammensetzung etikettiert oder gekennzeichnet sind, Artikel 14 EU-Textilkennzeichnungsverordnung.
| Begriff | Definition | Form der Anbindung |
| Etikettierung | Angabe der Informationen durch Anbringung eines Etiketts (z. B. ein Schild) | Muss zwingend fest angebracht sein. |
| Kennzeichnung | Unmittelbare Angabe der Informationen auf dem Textilerzeugnis | Erlaubt sind Aufnähen, Aufsticken, Drucken, Prägen oder jede andere Technik des Anbringens. |
Welche Variante gewählt wird, bleibt dem Hersteller bzw. Händler überlassen – entscheidend ist, dass die Angabe dauerhaft, leicht lesbar, sichtbar und zugänglich bleibt.
2. Zwingende Anforderungen an die Form der Kennzeichnung
Unabhängig davon, ob die Faserzusammensetzung auf einem Etikett oder direkt am Produkt angegeben wird, muss die Kennzeichnung nach Art. 14 Abs. 1 EU-Textilkennzeichnungsverordnung stets folgende Anforderungen erfüllen:
- dauerhaft
- leicht lesbar
- deutlich sichtbar
- für den Verbraucher zugänglich
(Bei der Etikettierung muss das Etikett zwingend auch fest angebracht sein (Art. 14 Abs. 1 Satz 2 EU-Textilkennzeichnungsverordnung).
3. Zulässige Formen der Anbringung der Textilkennzeichnung
Die Anforderungen können u. a. erfüllt werden durch:
- Aufnähen
- Aufsticken
- Aufdrucken
- Prägen oder
- andere gleichwertige dauerhafte Verfahren
Typische zulässige Varianten sind etwa:
- Eingenähtes Etikett (z. B. in der linken inneren Seitennaht eines T-Shirts oder Pullovers)
- Eingeklebtes Etikett (z. B. dauerhaft verklebtes Materiallabel auf der Innenseite einer Softshell-Jacke)
- Eindruck direkt auf das Produkt (z. B. Aufdruck der Faserangabe im Kragenbereich oder am Bund)
Entscheidend ist, dass die Kennzeichnung dauerhaft am Textil verbleibt und nicht durch Waschen, Tragen oder Pflege entfernt werden kann.
4. Platzierung der Kennzeichnung
Die EU-Textilkennzeichnungsverordnung schreibt keinen festen Ort der Kennzeichnung vor.
Wichtig ist lediglich, dass die Angabe leicht auffindbar und beim Kauf erkennbar ist, Art. 14 Abs. 1 EU-Textilkennzeichnungsverordnung.
Bewährte Anbringungsorte in der Praxis, die diese juristischen Anforderungen erfüllen, sind:
- T-Shirts, Pullover, Kleider: linke innere Seitennaht oder Nackenbereich
- Hosen: Innenseite des Hosenbundes oder Außenseite des Taschenfutters
- Jacken, Mäntel: Innenseite des Kragens oder Innentasche
- Röcke, Kleider, Pullover: Hinterer oberer mittiger Bereich oder linke Seitennaht
- Sakkos: In der linken Brusttasche des linken Vorderteils
- Oberhemden: Innenseite des Kragens (mittig) oder linke innere Seitennaht über dem Saum
Zu diesen bewährten Orten lassen sich weitere ergänzen, die die Anforderungen der Dauerhaftigkeit, Sichtbarkeit und Zugänglichkeit ebenfalls erfüllen:
| Produktkategorie | Ergänzende/Alternative Anbringungsorte | Juristische Begründung |
| Unterwäsche / Bademode | Rückseite des Bündchens oder Innen im Zwickel (bei Slips/Badeanzügen). | Hier wird oft gedruckt oder ein kleines Etikett verwendet, da die Seitennaht die Haut reizen könnte (Zugänglichkeit und Dauerhaftigkeit gegeben). |
| Socken / Strümpfe | Eingedruckt in der Fußsohle oder an der Spitze/im Bündchen. | Da Socken oft als Set verkauft werden, muss nur ein Teil gekennzeichnet sein (Art. 11 Abs. 3), und der Ort muss sichtbar/lesbar sein. |
| Mützen / Hüte | Innen an der Krempe oder am inneren Bündchen. | Muss beim Anprobieren leicht zugänglich sein. |
| Gürtel / Taschen | Innenseite des Gürtelendes oder in der Innentasche (bei Taschen, die unter die 80%-Regel fallen). | Hier ist die Kennzeichnung oft gedruckt oder auf einem separaten Label in der Tasche befestigt. |
5. Unzulässige Formen
Nicht alle Formen der Anbringung erfüllen die gesetzlichen Anforderungen. Unzulässig sind insbesondere Kennzeichnungen, die nicht dauerhaft mit dem Textilerzeugnis verbunden sind oder nach dem Kauf leicht entfernt werden können.
Dazu gehören etwa:
- das bloße Beilegen eines losen Einlegezettels.
- das Anhängen eines Schildes z.B. mittels einer Schlaufe an dem Produkt.
- die Befestigung eines Schildes mit Faden und Sicherheitsnadel.
Ziel der Regelung ist, sicherzustellen, dass die Verbraucherinformationen während der gesamten Lebensdauer des Produkts sichtbar und beständig bleiben – unabhängig von der Art der Nutzung oder Reinigung.
Das OLG Hamburg entschied (Urteil vom 25. 11. 1999 – 3 U 76/99), dass es an der deutlichen Erkennbarkeit fehlt, wenn Oberhemden verpackt angeboten werden und die Rohstoffgehaltsangabe erst nach dem Auspacken sichtbar ist.
In diesem Fall sei die Angabe nicht ohne erhebliche Mühe erkennbar – die Kennzeichnungspflicht somit nicht erfüllt.
6. Ausnahmefälle: Kennzeichnung auf der Verpackung
Gemäß Art. 14 Abs. 1 der EU-Textilkennzeichnungsverordnung muss die Faserzusammensetzung grundsätzlich direkt am Textilerzeugnis selbst (durch Etikett, Kennzeichnung oder Aufdruck) angebracht werden.
Eine Kennzeichnung nur auf der Verpackung ist in der Regel nicht ausreichend. Die Anbringung am Produkt gewährleistet die zwingend vorgeschriebene leichte Einsehbarkeit und Zugänglichkeit der Information durch den Verbraucher.
Zulässige Ausnahmen und Vereinfachungen
In folgenden, eng definierten Fällen kann die Anbringung der Kennzeichnung am Produkt entfallen und die ausschließliche Kennzeichnung der Verpackung genügen:
Gefahr der Zerstörung oder Beschädigung:
Wenn die unmittelbare und feste Anbringung des Etiketts das Erzeugnis unweigerlich zerstören oder beschädigenwürde, kann die ausschließliche Etikettierung der Verpackung ausnahmsweise genügen.
In diesem Fall ist die Struktur der Verpackung (transparent oder undurchsichtig) unerheblich, da die Kennzeichnung am Produkt aufgrund des Schutzes des Erzeugnisses unmöglich ist.
####Globale Kennzeichnung und Meterware (Art. 17 Abs. 3 und 4)####:
Für bestimmte, in Anhang VI abschließend aufgeführte Textilerzeugnisse (z. B. Putztücher, Taschentücher) genügt eine globale Etikettierung (ein Etikett für mehrere Einheiten) oder die Angabe der Zusammensetzung nur auf der Verpackung (Art. 17 Abs. 3).
Gleiches gilt für Textilien, die in abgemessenen, geschnittenen Längen (Meterware, Art. 17 Abs. 4) verkauft werden.
Achtung: In diesen Fällen ist die alleinige Kennzeichnung auf der Verpackung nur praktikabel und zulässig, wenn die Verpackung die Informationen sichtbar lässt (z. B. wenn sie durchsichtig ist).
Zwingende Voraussetzungen für die Anwendung der Ausnahmen
Die Anwendung der Ausnahmen ist an strikte Auflagen gebunden, die stets erfüllt sein müssen:
Sichtbarkeit: Die Kennzeichnung auf der Verpackung muss zwingend so angebracht sein, dass der Verbraucher sie beim Kauf ohne Mühe sieht.
Bestandsschutz: Die Verpackung darf bei Abgabe des Produkts an den Verbraucher nicht entfernt werden, da die Information bis zum Endkunden erhalten bleiben muss.
Keine Entbindung vom Grundsatz: Ist die Verpackung undurchsichtig und greift keine der oben genannten Ausnahmen, ist stets eine Kennzeichnung am Erzeugnis selbst erforderlich.
Zusätzliche Hersteller-Kennzeichnung (Produktsicherheitsverordnung)
Unabhängig von der Faserzusammensetzung muss jedes Textilerzeugnis (als Verbraucherprodukt) nach der Produktsicherheitsverordnung (GPSR) zusätzlich gekennzeichnet werden mit:
- Name, eingetragener Handelsname oder Handelsmarke des Herstellers.
- Postanschrift und eine elektronische Adresse (E-Mail/URL) des Herstellers.
Hinweis: Dies gilt auch im Online-Handel (z.B. via Online-Shops, Marktplatz-Stores oder auch beim Vertrieb per E-Mail).
Mit diesem Thema beschäftigt sich dieser ausführliche Beitrag zur Produktsicherheitsverordnung.
Online-Kennzeichnung und Sprachvorgaben
1. Ist die Textilkennzeichnung online und in Katalogen Pflicht?
Ja, die Textilfaserzusammensetzung muss in Katalogen, Prospekten und online angegeben werden, sobald dort eine direkte Kaufmöglichkeit besteht.
Nach Art. 16 Abs. 1 EU-Textilkennzeichnungsverordnung sind die Angaben zur Faserzusammensetzung so darzustellen, dass sie
- leicht lesbar,
- sichtbar und deutlich erkennbar sowie
- in einem Schriftbild lesbar sind, das in Bezug auf Schriftgröße, Stil und Schriftart einheitlich ist.
Die gesamte Pflicht zur Kennzeichnung ist an die "Bereitstellung auf dem Markt" gekoppelt.
Bereitstellung auf dem Markt (Art. 2 Abs. 2 i. V. m. Art. 2 Nr. 1 VO (EG) 765/2008): Dies ist definiert als jede entgeltliche oder unentgeltliche Abgabe eines Produkts zum Vertrieb, Verbrauch oder zur Verwendung auf dem Unionsmarkt im Rahmen einer Geschäftstätigkeit.
Die Pflicht zur Angabe der Zusammensetzung in den Medien (Katalog/Internet) ist somit immer dann gegeben, wenn diese Medien direkt zum Kaufabschluss führen und damit das Textilerzeugnis dem Verbraucher zur "Bereitstellung auf dem Markt" angeboten wird.
Bei reinen Werbekatalogen oder Prospekten ohne jegliche direkte Möglichkeit zur Bestellung (z. B. keine Hotline, kein Bestellschein, kein Online-Link zum Kauf) bestehen keine Kennzeichnungspflichten für die Faserzusammensetzung nach Artikel 16 Absatz 1 EU-Textilkennzeichnungsverordnung.
2. Online-Platzierung: Wo müssen die Pflichtangaben im Webshop stehen?
Eine pauschale Regel gibt es – wie so oft im Online-Handel – nicht. Zumal die praktische Umsetzung immer auch von den technischen Gegebenheiten der jeweiligen Internetplattform abhängt.
Um das Risiko einer unzureichenden oder verspäteten Information zu vermeiden, kann sich der Händler aber an der Rechtsprechung des BGH zur Angabe von Versandkosten im Internet orientieren.
Der BGH verlangt, dass alle wesentlichen Pflichtinformationen leicht erkennbar, klar verständlich und gut wahrnehmbar bereitgestellt werden – und zwar bevor der Verbraucher seine Bestellung einleitet.
Nach diesem Maßstab können die Pflichtangaben zur Textilkennzeichnung in der Praxis auf verschiedene Weise rechtssicher eingebunden werden:
Direkt am Angebot
Die Pflichtangaben zur Textilkennzeichnung stehen unmittelbar neben oder unter dem Preis auf der Produktseite – also dort, wo der Artikel in den Warenkorb gelegt werden kann.
„T-Shirt, 100 % Baumwolle“
(Angabe direkt unter Preis und Größenwahl)
Auf derselben Seite – über Sternchenhinweis verknüpft
Die Pflichtangaben befinden sich etwas weiter unten auf derselben Produktseite, sind aber über einen klaren Sternchenhinweis mit dem Angebot verknüpft.
„Material: siehe Fußnote *“
(Am Seitenende: „100 % Polyester, enthält nichttextile Bestandteile tierischen Ursprungs“)
Über klaren, sprechenden Link erreichbar
Die Pflichtinformationen stehen auf einer separaten Unterseite, die über einen gut sichtbaren und eindeutig bezeichneten Link erreichbar ist.
„Informationen zur Materialzusammensetzung finden Sie [hier]“
(Dies sollte zulässig sein, sofern der Link direkt zur entsprechenden Information führt und nicht in allgemeinen Hinweisen oder Fußnoten versteckt ist.)
Auf einer vorgeschalteten Informationsseite
Die Angaben werden auf einer Zwischenseite angezeigt, die der Verbraucher zwingend aufrufen muss, bevor er den Artikel in den Warenkorb legen kann (z. B. bei Konfiguratoren oder personalisierten Produkten).
Vor dem „In-den-Warenkorb“-Button öffnet sich ein Fenster mit dem Hinweis:
„Materialzusammensetzung: 80 % Baumwolle, 20 % Polyester“
(Ebenfalls zulässig, sofern die Information vor dem Abschluss des Bestellvorgangs angezeigt wird.)
Bei all diesen Varianten ist sichergestellt, dass die Angaben zur Textilkennzeichnung leicht zugänglich und unübersehbar sind. Der Verbraucher muss die Angaben zur Faserzusammensetzung stets vor dem Klick auf „In den Warenkorb“ klar erkennen können.
3. Gelten die Kennzeichnungspflichten auch für "upgecycelte Textilien"?
Ja, die Kennzeichnungspflichten der Verordnung (EU) Nr. 1007/2011 gelten grundsätzlich auch für "upgecycelte Textilien". Es gibt keine spezifische Ausnahme für Upcycling-Produkte.
Ausführliche Informationen zu den Kennzeichnungspflichten beim Upcycling finden Sie in diesem Beitrag: Upcycling von Textilien:wirklich kennzeichnungspflichtig?
4. In welcher Amtssprache muss online gekennzeichnet werden?
Grundsätzlich muss sie Online-Kennzeichnung von Textilerzeugnissen in der Amtssprache oder den Amtssprachen des Mitgliedstaats erfolgen, in dessen Hoheitsgebiet die Produkte dem Verbraucher bereitgestellt werden.
Ausführliche Informationen zu den sprachlichen Anforderungen bei der Online-Kennzeichnung finden Sie in diesem Beitrag: Pflicht zur mehrsprachigen Online-Kennzeichnung von Textilien?
5. Ist ein mehrsprachiges Etikett zulässig?
Solange die vorgeschriebene Angabe der Faserzusammensetzung in der korrekten Landessprache des Zielmarktes vorhanden ist, ist eine zusätzliche mehrsprachige Kennzeichnung (z. B. auf Englisch oder Französisch) auf demselben Etikett oder in den Begleitdokumenten erlaubt und gängige Praxis im internationalen Handel.
Solange die vorgeschriebene Faserangabe in der jeweiligen Amtssprache des Zielmarktes vorhanden ist, darf die Kennzeichnung zusätzlich in weiteren Sprachen (z. B. Englisch oder Französisch) erfolgen.
Dies ist zulässig und im internationalen Handel gängige Praxis.
Preisangabenverordnung und Grundpreise im Textilhandel
1. Grundsatz: Pflicht zur Angabe des Grundpreises
Nach § 4 Abs. 1 Preisangabenverordnung (PAngV) müssen Unternehmer, die Waren nach Gewicht, Volumen, Länge oder Fläche an Verbraucher anbieten oder bewerben, neben dem Gesamtpreis auch den Grundpreis (Preis je Maßeinheit) angeben.
Diese Pflicht gilt insbesondere für Textilien, die meterweise oder flächenweise verkauft werden, also etwa für:
- Stoffe und Gardinen,
- Teppiche und Bodenbeläge,
- Wolle, Garne und Bänder.
Ein Händler bietet Stoffabschnitte von 0,5 m Länge zum Preis von 6,99 € an.
- Gesamtpreis: 6,99 €
- Grundpreis: 13,98 €/m
Der Grundpreis (Preis pro Meter) muss angegeben werden, damit der Verbraucher den Preis mit anderen Stoffen vergleichen kann.
2. Ausnahme: Identität von Gesamt- und Grundpreis
Ein Grundpreis muss nicht gesondert angegeben werden, wenn er mit dem Gesamtpreis identisch ist (§ 4 Abs. 1 Satz 2 PAngV) . Dies betrifft z. B. Textilien, die nur in einer festen Maßeinheit (etwa „1 m“) verkauft werden.
Ein Stoff wird ausschließlich in Stücken zu je 1 m Länge angeboten und kostet 9,90 €.
Da 1 m auch die Bezugseinheit ist, entspricht der Gesamtpreis dem Grundpreis – eine zusätzliche Angabe ist entbehrlich.
3. Maß- und Mengeneinheit
Die Maßeinheit für den Grundpreis muss der Handelsform entsprechen, in der das Produkt angeboten wird:
Wer also Textilstoffe nach Metern verkauft, muss zwingend den Preis pro Meter angeben. Es ist unzulässig, stattdessen den Kilopreis anzugeben, selbst wenn der Verkäufer die Ware selbst nach Kilopreisen eingekauft hat (BGH, GRUR 1981, 289).
3. Grundpreise bei Produkt-Sets und Kombinationen
Bei der Kombination unterschiedlicher Produkte zu einem Set oder Bundle ist der Grundpreis erforderlich, wenn die Produkte nicht annähernd gleichwertig sind.
Die Grundpreisangabe entfällt nur dann, wenn der Wert der zusätzlich gelieferten Ware vom Verbraucher als unerhebliche Zugabe angesehen wird (z. B. wenn das Wertverhältnis von Hauptware zu Zugabe 90%:10% oder mehr beträgt).
Drei Meter edles Tuch (Wert 200,- Euro) wird im Set mit einer kleinen Sektflasche (Wert 1,50 Euro) angeboten. In diesem Fall ist neben dem Gesamtpreis ein Grundpreis für das edle Tuch (als Hauptware) anzugeben!
4. Grundpreisangabe im Online-Handel
Auch bei Angeboten im Internet muss der Grundpreis unmittelbar neben dem Gesamtpreis angegeben werden (§ 4 Abs. 1 Satz 1 PAngV) .
Der Verbraucher muss auf einen Blick beide Preise erfassen können – ein Verweis über einen Link oder Tooltip genügt nicht.
Abmahngründe und Stolperfallen der Textilkennzeichnung
1. Sind Verstöße gegen die Textilkennzeichnungsverordnung abmahnfähig?
Ja. Die Vorschriften der Textilkennzeichnungsverordnung dienen dem Verbraucherschutz und sind als Marktverhaltensregeln im Sinne des Wettbewerbsrechts (UWG) anzusehen. Verstöße sind daher abmahnfähig.
2. Häufigste Abmahngründe
Die meisten Abmahnungen entstehen durch die Missachtung der Ausschließlichkeitsregel in Artikel 5 (nur die Namen aus Anhang I sind erlaubt) und der Sprachpflicht (Art. 16 Abs. 3 EU-Textilkennzeichnungsverordnung):
| Verstoß | Juristische Begründung und Falle für Praktiker |
| Falsche Wortwahl (z.B. "Acryl" statt "Polyacryl") | Die Bezeichnung muss 1:1 dem offiziellen Namen in Anhang I entsprechen (z. B. Nr. 26 ist "Polyacryl"). Begriffe wie "Acryl" sind irreführend, da der Verbraucher nicht zwischen "Polyacryl" und "Modacryl" unterscheiden kann (OLG München). |
| Abkürzungen (z.B. CO, PES) | Artikel 14 Absatz 3 verbietet Abkürzungen grundsätzlich, da sie die Klarheit verletzen. Es muss der vollständige Name (z.B. "Baumwolle", "Polyester") verwendet werden. |
| Markennamen und inoffizielle Bezeichnungen | Namen wie "Lycra", "Meryl" oder "Spandex" sind Markennamen und keine offiziellen Faserbezeichnungen nach Anhang I. Sie dürfen nicht als alleinige Rohstoffangabe verwendet werden. |
| Strukturmerkmale als Fasername | Der Begriff "Microfaser" beschreibt lediglich die Feinheit (Struktur) der Faser und ist kein Name einer Faserart nach Anhang I. Die Angabe ist unzulässig. |
3. Grauzonen und Zusätze
| Grauzone | Erlaubt vs. Verboten | Konsequenz für Händler |
| Rassen- und Qualitätszusätze (z.B. "Merino") | Die Rasse (z.B. Merino) ist nicht Teil des Fasernamens "Wolle" (Anhang I Nr. 1 EU-Textilkennzeichnungsverordnung). Unzulässig: "100 % Merinowolle". Zulässig: "100 % Wolle (Merinowolle)". | Die Zusatzinformation muss getrennt vom Fasernamen platziert werden. |
| Sprachpflicht ("Cotton") | Artikel 16 Absatz 3 verlangt die Amtssprache (z. B. Deutsch). Der BGH hat zwar die Verwendung von "Cotton" in Deutschland ausnahmsweise als nicht spürbar irreführend gewertet, die Grundpflicht zur Verwendung der deutschen Amtssprache bleibt jedoch die Regel und der sicherste Weg. | Bei grenzüberschreitendem Verkauf muss die Kennzeichnung in der jeweiligen Amtssprache des Zielmarktes verfügbar sein. |
| Fasern aus natürlicher Quelle (z.B. Bambus) | Bambus ist nur als Name erlaubt, wenn es sich um die Bambus-Naturfaser handelt. Wird Bambus nur als Rohstoff für Zellulose genutzt (Viskoseverfahren), muss das Endprodukt „Viskose“ genannt werden. | Es zählt die chemische Zusammensetzung der Endfaser, nicht die Quelle des Rohstoffs. |
Fragen zum Beitrag? Diskutieren Sie hierzu gerne mit uns in der Unternehmergruppe der IT-Recht Kanzlei auf Facebook.
Link kopieren
Als PDF exportieren
Per E-Mail verschicken
Zum Facebook-Account der Kanzlei
Zum Instagram-Account der Kanzlei



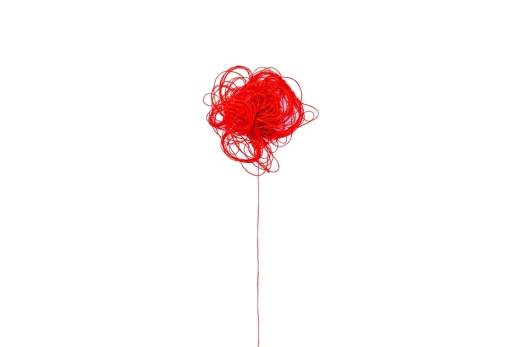

16 Kommentare
Gibt es einen Unterschied beim Einzelverkauf des Beutelchens oder wenn ich Produkt und Verpackung schon als fertiges Set verkaufe?
Muss das Kennzeichen fest eingenäht sein, oder kann ich auch einen separaten Einleger aus Papier in die Beutelchen legen?
Ihre Produkte fallen unter die "Gleichgestellten Erzeugnisse" (Art. 2 Abs. 2 Textilkennzeichnungsverordnung).
Sie müssen nur dann gekennzeichnet werden, wenn der Textilfaser-Anteil 80% oder mehr des Gesamtgewichts ausmacht.
Bei komplexen Artikeln wie Matratzenbezügen oder Sonnenschirmen reicht es aus, wenn der Bezugsstoff (die Textilkomponente) 80% ausmacht; der nicht-textile Kern (Gestell, Schaumstoff) muss nicht in die Berechnung einbezogen werden.
„Bastelfilz“ ist kein zulässiger Fasername. Entscheidend ist, aus welchen Fasern der Filz besteht – z. B. Polyester, Wolle oder Viskose. Diese müssen mit ihrem Gewichtsanteil in % angegeben werden (z. B. „100 % Polyester“).
Fragen Sie beim Lieferanten nach der genauen Faserzusammensetzung und verwenden Sie nur die offiziellen Fasernamen aus Anhang I der Verordnung.
Leider finde ich diesbezüglich nichts vergleichbares in der Textilverordnung, vorallem welchen Begriff ich verwenden muss für den Begriff Bastelfilz. Was kann ich denn nun tun, um meine Produkte noch rechtssicher verkaufen zu können?
Danke im vorraus für ihre Antwort.
ich werde ein Produkt vertrieben dass du 30% aus Kunststoff/Polyester und 70% aus Echtleder besteht. Es ist eine Mischung. Das Leder wird klein gehäckselt und neu verbunden mit Klebstoff und abschließend mit einer Schutzschicht aus Kunststoff überzogen.
Das ist das selbe Prozedere wie bei manchen Schuhen. Die Frage ist, wie darf ich Produkt dann nennen? Ist das noch ein Echtleder? Verbundleder? Echtleder-Mix?
Danke für die Antwort schon mal!
ich werde Kleidung vertreiben, bei der ein Kleidungsstück aus unterschiedlichen Stoffen besteht (es gibt keine Futter, nur unterschiedliche Stoffe vorne und hinten).
Als Beispiel eine Hose:
FRONT PART: 50% cotton (recycled), 50% polyester (recycled)
BACK PART: 76% polyester (recycled), 20% cotton (recycled), 4% elastane
INSIDE LEGS: 50% cotton (recycled), 50% polyester (recycled)
In meinen Carelabels sind die Materialangaben in 24 Sprachen angegeben, da ich in alle Länder der EU verkaufe.
Meine Frage bezieht sich nun auf die Bezeichnungen front part, back part, inside legs: muss ich diese Bezeichnungen ebenso wie die Materialangaben, in alle entsprechenden Sprachen übersetzen?
Und außerdem welche Bezeichnungen sind zugelassen, darf ich "front part" überhaupt schreiben?
Danke!!
ist es ausreichend, die Textilkennzeichnung auf einen Papieraufkleber zu drucken und diesen auf das Produkt zu kleben, mit dem Hinweis: "Diesen Aufkleber bitte vor der ersten Wäsche entfernen"? Oder ist mit "dauerhaft" gemeint, dass das Etikett über mehrere Wäschen und Tragen hinweg am Kleidungsstück angebracht bleiben soll? Für eine kurze Info wäre ich Ihnen sehr dankbar, leider finde ich hierzu nirgendwo konkrete Hinweise.
Ist in der EU ein Made in verpflichtend?
Ich importiere meine Textilien aus China und verkaufe in Österreich und Deutschland. Meine Marke ist im Firmenbuch eingetragen. Dann ist es möglich als Kontaktangabe auf dem Etikett meinen Markenname und nicht mein persönlicher Name zu kennzeichnen oder?
darf die Rasse des Schafes nicht als Zusatz des Fasernamens genannt werden.
(Unzulässiges) Beispiel: "100 % Merinowolle"
Zulässig wäre es dagegen, die Rasse des Schafes getrennt von der Bezeichnung der Faser anzugeben, wie beispielsweise:"100 % Wolle (Merinowolle)"...
Meine Frage lautet nun: Wie sehen Sie das im Hinblick auf das jetzt ergangene Urteil zum Fall "Merinowolle". Darf die von Ihnen beschriebene Darstellung tatsächlich so genutzt werden? Und wenn ja, wo darf das so angegeben werden. Vielen Dank im Voraus.
Textilerzeugnisse, die ohne Übereignung an Heimarbeiter oder selbständige Unternehmen zur Weiterverarbeitung übergeben werden - vgl. Artikel 2 Absatz 3 der EU-Textilkennzeichnungsverordnung. Heimarbeiter ist gemäß § 2 Abs. 1 S. 1 HAG, wer in selbstgewählter Arbeitsstätte (eigener Wohnung oder selbstgewählter Betriebsstätte) allein oder mit seinen Familienangehörigen (Absatz 5 HAG) im Auftrag von Gewerbetreibenden oder Zwischenmeistern erwerbsmäßig arbeitet, jedoch die Verwertung der Arbeitsergebnisse dem unmittelbar oder mittelbar auftraggebenden Gewerbetreibenden überläßt. Beschafft der Heimarbeiter die Roh- und Hilfsstoffe selbst, so wird hierdurch seine Eigenschaft als Heimarbeiter nicht beeinträchtigt.
Wie ist es bspw im Onlineshop: Müssen bei Artikeln, die von der Textilkennezichnungspflicht ausgenommen sind, dennoch die Zusammensetzungen angegeben werden?
Es grüßt
S.Wilde
Was ist mit Gebrauchtwaren wie z.B.
M65 Field Jacket Medium Short, 6970th CSC, Dated: 1989
Unterliegt so etwas auch der Kennzeichnungspflicht.