Marke vs. Domain: Wer sticht wen?

In Zeiten des Internets ist die effektive Verteidigung von Markenrechten dringender denn je. Immer wieder neuartigen Angriffen sehen sich die geschützten Worte und Bilder im virtuellen Raum ausgesetzt. Häufig taucht seit einigen Jahren das Problem auf, dass sich eine Internetdomain auf der einen und eine gleichlautende Wortmarke oder ein gleichlautendes Unternehmenskennzeichen auf der anderen Seite gegenüberstehen.
Kann der Zeicheninhaber in einer solchen Situation die Löschung der Webadresse bewirken, obwohl diese domainrechtlich korrekt angemeldet wurde?, ist die Frage, mit der sich die Gerichte konfrontiert sahen und sehen. Im Folgenden sollen hierzu die gesetzliche Ausgangslage und die von der Rechsprechung vorgenommenen Konkretisierungen dargestellt werden.
Beurteilung auf Grundlage des Markengesetzes
Grundsätzlich gilt: Wird ein rechtlich geschütztes Zeichen durch einen Dritten – in einer Domain oder anderswo – in unbefugter Weise benutzt, so ergeben sich hiergegen Unterlassungsansprüche aus dem Markengesetz. Abgesichert werden:
-Marken ab deren Eintragung (§§ 14, 4 MarkenG)
-nicht registrierbare geschäftliche Bezeichnungen ab deren Benutzung. Hierunter fallen Unternehmenskennzeichen und Werktitel (§§ 15, 5 MarkenG) .
Diese markenrechtlichen Schutznormen, darüber herrscht Einigkeit in Rechtsprechung und Literatur, überlagern gleichsam das Domainrecht. Das bedeutet, dass sie auch dann Anwendung finden, wenn die Vergabe der Webadresse durch die zentrale Registrierungsstelle in Deutschland (DENIC) ordnungsgemäß erfolgt war. Dort ist nach dem Prioritätsprinzip einzig erforderlich, dass eine gleichlautende Domain noch nicht existiert.
Prinzipiell heißt es also: Sobald eine Marke oder ein geschütztes Unternehmenszeichen existieren, liegt die maßgebliche Voraussetzung der Unterlassungsansprüche nach §§ 14, 15 MarkenG vor. Der Zeichenberechtigte kann dann die Nutzungsunterlassung der geschäftlich genutzten, identischen Internetadresse verlangen; das Zeichen gewährt das gegenüber der Domain „bessere Recht“.
Im Grundsatz kommt es dabei nicht darauf an, was zuerst da war: Website oder Zeichen. Eine Marke schlägt die markenrechtlich ungeschützte Domain ab ihrer Eintragung. Für den Beginn des Schutzes eines Unternehmenskennzeichens ist – schwieriger zu ermitteln – die „geschäftliche Nutzung als Name, als Firma oder als besondere Bezeichnung eines Geschäftsbetriebs oder eines Unternehmens“ notwendig (§ 5 Abs. 2 MarkenG) .
Ausgangsfall: Jüngere Domain gegen ältere Marke
Bei dem einfach gelagerten Sachverhalt, dass das Zeichenrecht schon bestand, als die gleich lautende Domain an einen Dritten vergeben wurde, ist die Situation eindeutig. Der Löschungsanspruch nach § 14 bzw. nach § 15 MarkenG ist gegeben, sobald der geschützte Begriff in der Domain „geschäftlich genutzt“ wird. Das wiederum ist der Fall, wenn die Webpage nicht nur von einer Privatperson zu privaten Zwecken verwendet, sondern mit Einkunftserzielungsabsicht in Betrieb genommen, d. h. mit Inhalten hinterlegt, wird.
Die neuralgische Frage, die der BGH in dieser Konstellation zu beantworten hatte, war, ob auch das „Horten“ von Domains, ohne Konnektierung (sogenanntes Domain-Grabbing), bereits eine „geschäftliche Nutzung“ des Zeichens darstellt. In diesem Fall hätte der Zeicheninhaber auch hiergegen die markenrechtlichen Unterlassungsansprüche nach §§ 14, 15 MarkenG und wäre nicht darauf angewiesen, dem Domaingrabber die Adresse abzukaufen, wollte er sie für eigene Zwecke verwenden.
Die Gerichte entschieden allerdings, dass der Begriff der geschäftsmäßigen Nutzung nicht derart weit verstanden werden könne. „Wird mit einer Internet-Domain, die eine geschützte Marke enthält, keine Website adressiert, liegt darin weder marken- noch wettbewerbsrechtlich ein Fehlverhalten“, heißt es etwa im sogenannten „bigben.de-Urteil“ des LG Düsseldorf (7.2.2003, Az. 38 O 144/02). Darüber hinausgehend entschied der BGH 2007, dass ein markenrechtlicher Anspruch selbst dann nicht vorliege, wenn die Domain von einer juristischen Person des Handelsrecht gehamstert werde, die selbst stets als im geschäftlichen Verkehr agierend anzusehen sei. (BGH, 1. Zivilsenat, Urteil vom 19.7.2007, Az.: I ZR 137/04). Unter Umständen können sich Ansprüche jedoch aus Namens-, Firmen- oder Deliktsrecht ergeben.
In dem Fall, dass eine geschäftsmäßige Benutzung bejaht wird, kommt es schließlich darauf an, ob die Domain in verwechslungsfähiger Weise genutzt wird, ob also Kennzeichen und angebotene Waren oder Dienstleistungen ähnlich sind (LG Düssseldorf, Urteil vom 7.2.2003, Az. 38 O 144/02, „bigben“). Für die Beantwortung dieser Frage ist eine individuelle, detaillierte Gegenüberstellung nötig. Es existiert eine umfassende Einzelfallrechtsprechung.
Problemfall: Jüngere Marke gegen ältere Domain
Was aber gilt in dem Fall, in dem zunächst eine Internetadresse vergeben wird und erst danach zugunsten eines Dritten eine gleich lautende Marke eingetragen werden soll? Solche Konstellationen kommen insbesondere dann vor, wenn Domaininhaber ihre Webadressen aus Kostengründen oder auch aus Nachlässigkeit nicht sofort als Marke eintragen lassen. Muss die – unter Umständen wirtschaftlich sehr wertvolle – Webpage nun gelöscht, bzw. „herausgegeben“ werden?
„Es kommt darauf an“, stellten die Richter des LG Frankfurt im „warez.de“-Urteil bereits 1998 klar (Entscheidung vom 26.8.1998, Az. 26 O 438/98). Der Grundsatz „Kennzeichen schlägt Domain“ gelte weiterhin prinzipiell, werde aber dann durchbrochen, wenn die Webadresse selbst als so genanntes Unternehmenskennzeichen nach Art. 5 Abs. 2 MarkenG markenrechtlich gesichert sei.
Für die Begründung des Schutzes nach dieser Vorschrift sei eine Registrierung im Markenregister nicht erforderlich, vielmehr genüge bereits der Nachweis der geschäftsmäßigen Benutzung. Im konkreten Fall sah das Gericht eine Auskunft der DENIC sowie eidesstattliche Versicherungen darüber als ausreichend an, dass unter der Adresse in zwei Zeiträumen Computerprogramme angeboten wurden.
Stehen sich dann zwei kennzeichenrechtlich geschützte Begriffe gegenüber, kann sich „der Inhaber der Domain gegenüber dem Inhaber der später eingetragenen Marke erfolgreich auf Priorität berufen“.
Verfassungsrechtliche Konkretisierung
Was die grundrechtliche Einordnung der Problematik anbelangt, so äußerte sich das Bundesverfassungsgericht hierzu im Jahr 2004. In der sogenannten „ad-acta.de-Entscheidung“ stellte es grundlegend klar, dass die Stellung eines Domaininhabers ähnlich der eines Eigentümers ist und er daher verfassungsrechtlich durch Art. 14 GG geschützt ist. Eine Umkehrung des Grundprinzips „Marke schlägt Domain“ erfolge dennoch nicht, führten die Richter weiter aus. Der Eigentumsschutz beanspruche Geltung nur im Rahmen der allgemeinen Gesetze, also dann nicht, wenn die Normen des Markenrechts einen Unterlassungsanspruch gegen den Domaininhaber begründen (BVerfG vom 24.11.2004, Az. 1 BvR 1306/02).
Fragen zum Beitrag? Diskutieren Sie hierzu gerne mit uns in der Unternehmergruppe der IT-Recht Kanzlei auf Facebook.
Link kopieren
Als PDF exportieren
Per E-Mail verschicken
Zum Facebook-Account der Kanzlei
Zum Instagram-Account der Kanzlei

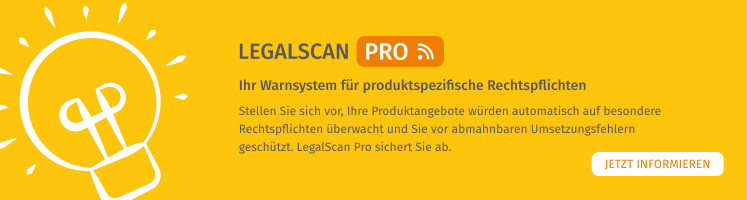




16 Kommentare
Bei uns besteht aktuell das Problem, dass wir eine Marke eingetragen haben, die entsprechende .de-Domain allerdings bereits von einem Domain-Trader belegt ist, der hierfür horrende Summen verlangt.
Besteht hier die Möglichkeit über die eingetragene Marke eine Herausgabe der Domain zu erwirken?
Wie verhält es sich bei Namen eines Nebengewerbes. Eine Person hat ein Nebengewerbe, das er u nter der Domain XY.at betreibt. Darf ich dann ein Nebengewerbe mit der domain XY.de betreiben? Der Name XY musste bei der Gewerbeanmeldung nicht angegeben werden. Die andere Person sitzt in Österreich, ich in Deutschland.
Ist damit auch ein Online-Shop, der mit einer Domain betrieben wird geschützt oder muss hier erst ein Mindestumsatz vorliegen?
Danke.
Unter Domain XY24.com betreibe ich seit 2007 eine Homepage/Shop.
Die Domain ohne den zusatz "24" wurde von einem anderen Mitbewerber genutzt.
Nun habe ich 12/2016 die Marke "XY" markenrechtlich geschützt.
Die Domain "XY" wurde nun wieder frei und von einer anderen Privatperson aus Polen gekauft bzw. und im Internet zum Verkauf angebote .
Ich möchte nun, als markenrechtsinhaber, diese Domain bekommen und frage mich, welche Möglichkeiten ich habe die derzeitige Eigentümerin dazu zu bewegen, diese Domain an mich heraus zu geben.
Vielen Dank für eine Antwort.
Also mal angenommen, ich habe vor ein Produkt auf den Markt zu bringen, mir schweben ein paar Vorstellungen zu Wort und Bild im Kopf, aber da es eh noch eine Menge Baustellen gibt, registriere ich zunächst die Domain mit dem Namen, den die Marke später erhalten soll. Dann beginne ich mit dem Aufbau der Webseite, knüpfe erste Kontakte etc. pp. Es vergehen 2-3 Monate damit und in der Zeit hat sich auch konkretisiert, wie die Wort-/Bildmarke ausschauen soll. Beim DPMA sehe ich, dass es keinen Mitbewerber gibt und registriere die Wort-/Bildmarke nachträglich ein paar Monate nach der Registrierung der Domain. Soweit so gut, die Registrierung wird angenommen und ein paar Wochen später steht eine weitere gleichlautende Wortmarke dort im Register, die in einem anderen Nachbarstaat registriert wurde. Jetzt kommt der Clou, die Marke lautet nicht nur gleich, es sind auch ähnliche Klassen gewählt und bei der Überprüfung stellst Du fest, da verkauft jemand genau das gleiche wie Du unter dem gleichen Namen.
Bei weiterer Überprüfung stellt sich heraus, dass die Marke des anderen mit Prioritätsdatum gesetzt wurde, welches vor dem Datum der eigenen Registrierung liegt, die tatsächliche Eintragung der Marke aber erst danach geschah. Es gibt auch dort eine gleichlautende Domain, natürlich mit anderer Top-Level Endung, aber ansonsten identisch.
Jetzt fordert diese Firma Dich auf, Deine Domain und Deine Marke nicht mehr zu nutzen.
Wer bekommt da Recht?
wie sieht es bei folgender Situation aus:
Anfang 2011 wurde mehrere Domains im Zusammenhang mit einem Markennamen registriert. Der Markenname wurde dann etwa ein halbes Jahr später auf uns angemeldet. Aktiv genutzt wurde nur 1 Domain, die anderen wurden lediglich aus Wettbewerbsgründen blockiert. 2014 wurde die Marke zusammen mit der aktiven Domain (die den Markennamen am besten trifft) verkauft und auch die Rechte übertragen. Der Käufer hat nie nach weiteren Domains gefragt und im Kaufvertrag steht auch ausdrücklich nur diese eine Domain.
Nun erhebt der Käufer Anspruch auf die weiteren Domains, die ja schon lange vor seinem Markenrecht und sogar vor unserem ursprünglichen Markenrecht bestanden. Wir sind gerne bereit, die ihm weitere Domains zu überlassen, aber nur gegen Bezahlung.
Für eine Info wäre ich sehr dankbar.
Mit bestem Gruß
Karola Lutz
Unter diesem Wort wurde eine bestimmte Dienstleistung von einer bestimmten Person bekannt) 7 Jahre später wurde dieses Wort dann erst Markengschützt.
4 Monate vor Markenschutz wurde der Name bei einem Fremdanbieter ebenfalls in der Domain mit einem Zusatz genutzt,es wird eine sehr ähnliche Dienstleistung angeboten.
Darf man auf Unterlassung pochen?
Ich registriere nun eine Domain: USA-Marke-kaufen.de
Geht da ein Risiko einher oder ist durch den Zusatz kaufen/test/vergleich die Problematik ausgehebelt?
Ich denke das ist ein sehr interessantes Thema, über das man konkret sprechen sollte.
habe ich den Richterspruch vom OLG Frankfurt 2004 richtig verstanden, bedeutet dieser ja, dass eine Domain die z.B 2010 angemeldet wurde ( aktuell keine Nutzung ) und in privater Hand nicht einfach von einer neu gegründeten Firma eingeklagt werden kann. Wenn der Domain Inhaber glaubhaft nachweisen kann, dass die Domain nicht zum Zweck des Verkaufs registriert wurde.
MfG
DI