Transportrisiken im Online-Handel: Wer haftet wann?

Beschädigte oder verlorene Pakete werfen sofort die Frage nach der Haftung auf. Der Beitrag fasst die wichtigsten Regeln zum Transportrisiko im Online-Handel zusammen und zeigt, wann Händler oder Käufer für Schäden einstehen müssen.
Inhaltsverzeichnis
- Was bedeutet Transportrisiko?
- Wer trägt im Online-Handel das Transportrisiko?
- 1. Risikoübergang beim Verbrauchergüterkauf
- 2. Risikoübergang bei B2B-Geschäften
- 3. Was gilt als „Zustellung“ beim Verbraucher?
- 4. Ablage ohne Zustimmung
- 5. Abstell- bzw. Garagengenehmigung des Verbrauchers
- 6. Nachbarschaftliche Zustellung
- 7. Tracking zeigt „zugestellt“, Kunde widerspricht
- 8. Käufer behauptet Monate später den Nichtzugang
- 9. Falsche oder unvollständige Lieferadresse
- Indiziert eine Firmenadresse automatisch ein B2B-Geschäft?
- Welche Pflichten treffen den Händler bei Transportschäden?
- Muss der Käufer Transportschäden sofort melden?
- Wer trägt das Risiko bei einer Rücksendung im Widerruf?
- Kann der Händler Regress beim Transportunternehmen nehmen?
- Warum wird oft nur der Einkaufspreis erstattet – ist das zulässig?
- Kann die Transportgefahr per AGB auf Verbraucher übertragen werden?
- Dürfen Händler mit „versichertem Versand“ werben?
Was bedeutet Transportrisiko?
Das Transportrisiko bezeichnet die finanzielle Gefahr, dass bestellte Ware auf dem Transportweg zufällig beschädigt wird oder verloren geht. Im Schadensfall stellt sich die Frage, ob der Händler erneut liefern muss oder der Kunde nochmals bestellen und bezahlen muss.
Wer trägt im Online-Handel das Transportrisiko?
1. Risikoübergang beim Verbrauchergüterkauf
Wird die Ware an einen Verbraucher geliefert, gilt § 475 Abs. 2 BGB.
Danach trägt der Händler das Risiko bis zur tatsächlichen Übergabe der Ware an den Verbraucher.
Es genügt also nicht, dass die Ware lediglich in den Versand gegeben oder beim Transportdienstleister als „zugestellt“ vermerkt wurde. Entscheidend ist der tatsächliche Besitz des Verbrauchers.
2. Risikoübergang bei B2B-Geschäften
Im Geschäftsverkehr zwischen Unternehmern gilt § 447 BGB: Das Risiko geht bereits mit Übergabe der Ware an den Transportdienstleister auf den Käufer über – sofern der Versand auf Wunsch des Käufers erfolgt.
Geht die Ware unterwegs verloren oder wird beschädigt, trägt grundsätzlich der Käufer den Schaden.
3. Was gilt als „Zustellung“ beim Verbraucher?
Eine wirksame Zustellung liegt nur vor, wenn der Verbraucher die Ware tatsächlich erhält.
Das kann durch persönliche Übergabe oder durch eine zuvor autorisierte alternative Zustellform geschehen, etwa eine vereinbarte Ablage oder die Lieferung an einen bestimmten Nachbarn.
Ohne entsprechende Zustimmung liegt keine Zustellung vor – selbst wenn der Transportdienstleister etwas anderes behauptet.
4. Ablage ohne Zustimmung
Wird ein Paket ohne Zustimmung des Verbrauchers an einem Ort abgelegt – etwa auf der Terrasse, vor der Haustür oder in der Garage –, gilt dies nicht als wirksame Zustellung.
Wird das Paket anschließend entwendet oder beschädigt, haftet der Händler weiterhin. Für Verbraucher ist eine solche Ablage rechtlich risikolos.
5. Abstell- bzw. Garagengenehmigung des Verbrauchers
Erteilt der Verbraucher dem Transportdienstleister im Vorfeld eine Abstellgenehmigung, gilt die Ablage an dem vereinbarten Ort als ordnungsgemäße Zustellung. Mit der Ablage geht das Risiko auf den Verbraucher über.
Händler dürfen auf eine wirksam erteilte Abstellgenehmigung des Verbrauchers vertrauen – nicht jedoch auf die bloße Behauptung des Transportdienstleisters, eine solche Genehmigung liege vor. Bestreitet der Verbraucher deren Existenz, trägt der Händler das Risiko. Schließlich handelt der Transportdienstleister im Verhältnis zum Verbraucher als Erfüllungsgehilfe des Händlers.
6. Nachbarschaftliche Zustellung
Eine Zustellung an einen Nachbarn ist nur dann wirksam, wenn der Verbraucher dieser Zustellart zuvor ausdrücklich zugestimmt hat – etwa durch eine generelle Erlaubnis oder die Benennung eines bestimmten Empfangsberechtigten.
Fehlt eine solche Zustimmung, verbleibt das Transportrisiko beim Händler. Der bloße Hinweis im Tracking, die Sendung sei „bei Nachbar abgegeben“ worden, genügt als Zustellnachweis nicht.
7. Tracking zeigt „zugestellt“, Kunde widerspricht
Der Status „zugestellt“ im Tracking-System stellt keinen rechtssicheren Zustellnachweis dar.
Der Händler muss die tatsächliche Zustellung beweisen können, etwa durch:
- Name und Unterschrift des Empfängers
- Zustellfoto
- dokumentierten Wunsch-Abstellort
- GPS-gestützte Zustellinformationen
Kann der Händler keinen belastbaren Nachweis erbringen, muss er erneut liefern oder den Kaufpreis erstatten.
8. Käufer behauptet Monate später den Nichtzugang
Auch eine sehr verspätete Meldung eines Verbrauchers ändert an der Risikoverteilung nichts. Verbraucher müssen den Nichtzugang nicht innerhalb einer bestimmten Frist anzeigen. Die Beweislast bleibt hier stets beim Händler.
Im B2B-Geschäft hingegen ist eine spätere Nichtzugangsmeldung regelmäßig unbeachtlich, da der Käufer das Risiko bereits mit der Übergabe an den Transportdienstleister übernommen hat.
9. Falsche oder unvollständige Lieferadresse
Gibt der Käufer eine falsche oder unvollständige Lieferadresse an, trägt er das Risiko der daraus resultierenden Unzustellbarkeit. In solchen Fällen ist der Händler nicht verpflichtet, unmittelbar erneut zu liefern; er darf vielmehr abwarten, bis die Sendung an ihn zurückgelangt.
Die Kosten eines erneuten Versands kann der Händler dem Käufer in Rechnung stellen.
Eine Erstattung des ursprünglichen Kaufpreises kommt erst dann in Betracht, wenn feststeht, dass die Ware nicht mehr zurückerlangt werden kann oder der Vertrag auf andere Weise rückabgewickelt wird.
Indiziert eine Firmenadresse automatisch ein B2B-Geschäft?
Nein – die Angabe einer Firmenadresse führt nicht automatisch dazu, dass ein Geschäft als B2B einzuordnen ist. Entscheidend ist immer, in welcher Eigenschaft der Kunde tatsächlich bestellt hat. Handelt er privat, liegt trotz Firmenlieferadresse ein Verbrauchsgüterkauf vor – mit der Folge, dass weiterhin der Händler das Transportrisiko trägt.
Händler sollten daher nicht nur auf die Lieferadresse abstellen, sondern im Zweifel prüfen, ob der Kunde als Verbraucher oder Unternehmer auftritt.
Welche Pflichten treffen den Händler bei Transportschäden?
Trifft die Ware beschädigt beim Kunden ein, greifen die gesetzlichen Gewährleistungsrechte des Käufers nach § 437 BGB. Der Kunde kann zwischen Nachbesserung (Reparatur) und Nachlieferung wählen, wobei der Händler nur in Ausnahmefällen – etwa bei völlig unverhältnismäßigen Kosten – eine bestimmte Art der Nacherfüllung verweigern darf.
Daneben steht Verbrauchern im Fernabsatz weiterhin das Widerrufsrecht offen: Wird fristgerecht widerrufen, kann der Kunde die Ware zurücksenden und erhält den Kaufpreis erstattet, unabhängig davon, ob ein Transportschaden vorliegt.
Händler sollten Kunden im Schadensfall keinesfalls auf die Transportversicherung verweisen – diese betrifft ausschließlich das Innenverhältnis Händler und Transportdienstleister.
Muss der Käufer Transportschäden sofort melden?
Für Verbraucher besteht keine Pflicht, die Ware sofort zu prüfen oder einen Schaden unverzüglich anzuzeigen. Entsprechende Klauseln in AGB sind unzulässig, da sie Verbraucher in unzulässiger Weise benachteiligen würden.
Anders sieht die Lage im reinen B2B-Bereich aus: Handelt es sich um ein beiderseitiges Handelsgeschäft, greift die Rügeobliegenheit des § 377 HGB.
Unterlässt der Unternehmer eine zeitnahe Mängelanzeige, verliert er in der Regel seine Gewährleistungsrechte – ein sehr praxisrelevanter Punkt bei Schadensfällen im Versandhandel zwischen Unternehmen.
Wer trägt das Risiko bei einer Rücksendung im Widerruf?
Geht die Ware nach einem Verbrauchswiderruf auf dem Rückweg verloren oder wird beschädigt, trägt der Verkäufer das Risiko. Voraussetzung ist, dass der Verbraucher die ordnungsgemäße Absendung nachweisen kann (z. B. Einlieferungsbeleg).
Händler dürfen Verbraucher nicht zur Nutzung bestimmter Dienstleister verpflichten, es sei denn, die Rücksendekosten werden vollständig übernommen.
Kann der Händler Regress beim Transportunternehmen nehmen?
Ja – trotz fehlenden direkten Vertragsverhältnisses kann der Händler das Transportunternehmen grundsätzlich in Anspruch nehmen. Regressansprüche können sich sowohl aus eigenem Recht (insbesondere gemäß §§ 425 ff. HGB) als auch aus fremdem Recht nach den Grundsätzen der Drittschadensliquidation ergeben
Allerdings kann er den Käufer hinsichtlich der Rückzahlung des Kaufpreises nicht vertrösten oder hinhalten, weil sich im Verhältnis mit dem Transportunternehmen Schwierigkeiten/Verzögerungen ergeben.
Die Regressfristen sind kurz: Nach § 438 HGB beträgt die Reklamationsfrist regelmäßig 7 Tage bei äußerlich nicht erkennbaren Schäden.
Warum wird oft nur der Einkaufspreis erstattet – ist das zulässig?
Ob der Transportdienstleister nur den Einkaufspreis oder Zeitwert ersetzt, hängt von mehreren Faktoren ab, insbesondere von den vereinbarten Versicherungsbedingungen sowie den AGB des Dienstleisters. Gerade im B2B-Bereich sind Haftungsbegrenzungen häufig wirksam, da Unternehmer als weniger schutzbedürftig gelten.
Zudem enthält das Gesetz selbst eine relevante Vermutung: Nach § 429 HGB gilt der Rechnungsbetrag abzüglich Versandkosten als Marktwert, wenn das Gut unmittelbar vor der Übergabe verkauft wurde. Händler können sich in der Praxis häufig auf diese Vorschrift berufen.
Kann die Transportgefahr per AGB auf Verbraucher übertragen werden?
Nein.
Eine Klausel, die das Transportrisiko auf den Verbraucher verlagert, wäre mit dem gesetzlichen Leitbild unvereinbar und nach § 307 BGB unwirksam. Der Bundesgerichtshof hat dies ausdrücklich bestätigt (BGH, Urteil vom 06.11.2013 – VIII ZR 353/12).
Dürfen Händler mit „versichertem Versand“ werben?
Nicht ohne Weiteres.
Eine Werbung mit „versichertem Versand“ ohne klarstellenden Hinweis darüber, dass der Verkäufer das Transportrisiko trägt, ist irreführend und kann abgemahnt werden, da sie suggeriert, der Verbraucher erhalte ein Mehr an Sicherheit als ihm gesetzlich schon zusteht.
Fragen zum Beitrag? Diskutieren Sie hierzu gerne mit uns in der Unternehmergruppe der IT-Recht Kanzlei auf Facebook.
Link kopieren
Als PDF exportieren
Per E-Mail verschicken
Zum Facebook-Account der Kanzlei
Zum Instagram-Account der Kanzlei

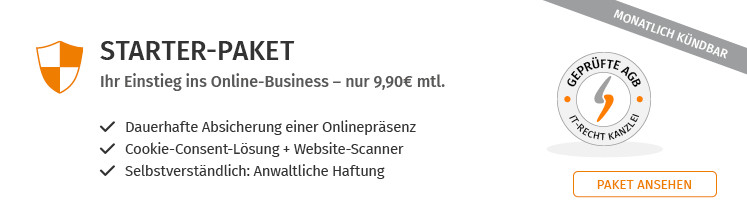




10 Kommentare
Im speziellen Fall handelt es sich um 10 Sammlerstücke, die einer Restauratorin zur Aufbereitung geschickt wurden. Es wurde demnach keine Ware verkauft, der Wert der Ware war aber nach Aufbereitung um einiges Höher als vorher. Wer kommt für den Arbeitslohn der Restauratorin auf?
Ich hatte auch eine letzte Frist von 14Tagen per Mail an den Händler geschickt, mit der Bitte um Ersatz oder Kostenerstattung. Er hat nicht reagiert. Die Mails vorher wurden immer sporadisch beantwortet, angeblich wären die Fotos nicht in der Mail gewesen etc. Habe viermal die Bilder gesendet.
Soll ich jetzt eine Strafanzeige stellen? Ist allerdings kein hoher Betrag 17,8 Euro...
Danke für eine Antwort
LG Petra Demel
Der Großhändler sagt derzeit, dass ihn das nicht berühre, da der Kunde die einwandfreiheit der Ware unterschrieben hat, sprich alles unser Problem. Wir sollen dafür in voller Höhe selbst aufkommen als Einzelhändler.
Vielen Dank für eine Einschätzung...
Der Kunde meldet sich beim Verkäufer welcher Ersatz leisten muss. Nun Reklamiert der Verkäufer den Schaden beim Paketdienst welche aber den Schaden tragen da der Käufer die Ware angenommen und Unterschrieben hat. Wie ist da die Lage ? Jeder weiß ja das die Fahrer keine Zeit haben auf eine Kontrolle der Käufer zu warten.
Könnte mein Händler diesen Absatz umgehen, indem ich als Verbraucher bei der Abholung der angeblich defekten Ware, einen Lieferservice beauftrage, da er die Kosten nicht erstatten will?