Rechtliche Fallstricke bei Online-Verkäufen über Apps

Shopping-Apps sind bei Kunden beliebt. Für Händler bestehen aber rechtliche Risiken: Ob Impressum, Datenschutzhinweise, Widerrufsbelehrung oder Cookies – in Shopping-Apps lauern einige Fallstricke, die Sie kennen müssen.
Inhaltsverzeichnis
- Rechtliche Fallstricke bei Online-Verkäufen über Apps
- Impressum
- 1. Die Impressumspflicht nach dem Digitale-Dienste-Gesetz
- 2. Impressumspflicht auch für Anbieter von Apps
- 3. Pflichtangaben im Impressum
- 4. Keine Ausnahme aufgrund beschränkter Darstellbarkeit
- 5. Gestaltung und Platzierung des Impressums
- Widerrufsbelehrung und Muster-Widerrufsformular in Apps
- 1. Rechtlicher Hintergrund: Informationspflichten bei Fernabsatzgeschäften
- 2. Ordnungsgemäße Widerrufsbelehrung: Was muss hinein?
- 3. Ausnahme von Informationspflichten bei begrenztem Platzangebot
- 4. Möglicher Ausschluss des Widerrufsrechts bei digitalen Inhalten
- Datenschutz
- 1. Pflicht zur DSGVO-Datenschutzerklärung
- 2. Verarbeitung von personenbezogenen Daten
- 3. Inhalt der Datenschutzerklärung
- 4. Darstellung der Datenschutzerklärung
- Cookies
- 1. Vorgaben für Cookies
- 2. Einwilligungspflicht
- Fazit
Rechtliche Fallstricke bei Online-Verkäufen über Apps
Bei vielen App-Entwicklern steht die rechtssichere Gestaltung der Shopping-App nicht ganz oben auf der Agenda. Dabei müssen Händler, die ihre Produkte über eine App anbieten, von den Angaben im Impressum über die Widerrufsbelehrung und weitere Verbraucherschutzinformationen bis hin zur Datenschutzerklärung und Cookies zahlreiche rechtliche Fallstricke beachten.
Impressum
Man muss kein Experte sein, um ein fehlendes, unvollständiges oder fehlerhaftes Impressum zu erkennen. Bereits ein Blick genügt, weshalb wettbewerbsrechtliche Abmahnungen aufgrund fehlender oder unzureichender Impressen immer wieder vorkommen. Ein Händler, der seine Produkte (auch) über eine App anbietet, sollte daher ein rechtssicheres Impressum direkt in der App vorsehen.
1. Die Impressumspflicht nach dem Digitale-Dienste-Gesetz
Für Diensteanbieter von geschäftsmäßigen digitalen Diensten sieht das Digitale-Dienste-Gesetz (DDG) besondere Informationspflichten vor. Hierzu zählen auch Händler, die ihre Produkte und sonstigen Leistungen via Apps vertreiben. Die Veröffentlichung der Angaben im Impressum soll dabei für ein Mindestmaß an Transparenz und Information sorgen, um Verbrauchern Schutz vor unseriösen oder betrügerischen Angeboten zu bieten.
2. Impressumspflicht auch für Anbieter von Apps
Die Regelung in § 5 Abs. 1 DDG verpflichtet
- alle Diensteanbieter,
- die geschäftsmäßige, in der Regel gegen Entgelt angebotene digitale Dienste bereithalten,
zur Angabe eines Impressums, das die gesetzlichen Pflichtangaben zur Anbieterkennzeichnung enthält.
Für Anbieter von Apps bedeutet dies: Der Betrieb einer mobilen App, z.B. auf einem Smartphone, Tablet oder Notebook, in der Kunden Waren und / oder Dienstleistungen bestellen können, ist ein geschäftsmäßig, entgeltlich angebotener digitaler Dienst, so dass der App-Anbieter zur Anbieterkennzeichnung verpflichtet ist. Händler, die ihre Waren auch über eine App anbieten, müssen in der App daher ein Impressum veröffentlichen.
3. Pflichtangaben im Impressum
Der Katalog in § 5 Abs. 1 DGG enthält eine Auflistung von Informationen, die ein App-Anbieter und Shop-Betreiber im Rahmen seines Impressums angeben muss. Dies umfasst die folgenden Angaben:
- Vollständiger Name (Vor- und Nachname) bzw. vollständige Firmenbezeichnung
- vollständige Anschrift, unter der der Anbieter niedergelassen ist
- bei juristischen Personen zusätzlich die Rechtsform, den oder die Vertretungsberechtigten und, sofern Angaben über das Kapital der Gesellschaft gemacht werden, das Stamm- oder Grundkapital
- E-Mail-Adresse
- Telefonnummer
- ggf. Fax-Nummer (soweit vorhanden)
- ggf. zuständige Aufsichtsbehörde (soweit der Dienst im Rahmen einer Tätigkeit angeboten oder erbracht wird, die der behördlichen Zulassung bedarf)
- ggf. den Namen des Registers sowie die Registernummer (falls der Anbieter im Handelsregister, Vereinsregister, Partnerschaftsregister oder Genossenschaftsregister eingetragen ist)
- ggf. Umsatzsteuer-Identifikationsnummer, Wirtschafts-Identifikationsnummer (soweit jeweils vorhanden)
- ggf. EU-Mitgliedstaat, der Sitzland des Diensteanbieters ist oder als dessen Sitzland gilt, sowie zuständige Regulierungs- und Aufsichtsbehörde (falls auch sog. audiovisuelle Mediendienste angeboten werden).
4. Keine Ausnahme aufgrund beschränkter Darstellbarkeit
Bei beschränkter Darstellbarkeit bzw. nur begrenztem Raum für die Darstellung von verbraucherschutzrechtlichen Pflichtinformationen muss gemäß der Ausnahmevorschrift in Art. 246a § 3 EGBGB lediglich über die Identität des Unternehmers - also des App-Anbieters - informiert werden. Zumindest auf den ersten Blick könnte argumentiert werden, die Erfüllung der Informationspflichten im Zusammenhang mit dem Impressum sei in Shopping-Apps aufgrund der im Vergleich zu PC-Bildschirmen geringeren Displaygröße von Smartphones, Tablets & Co. nicht möglich ist.
- Allerdings bieten moderne Smartphones, Tablets und sonstige mobile Endgeräte aufgrund ihrer großen Displays heute in aller Regel genügend Raum, um sämtliche Pflichtangaben aus dem Impressum vollständig darzustellen. Die Ausnahmevorschrift stammt noch aus einer Zeit, in der mobile Endgeräte über kleinere Displays verfügten und deshalb deutlich weniger Raum für die Darstellung von Informationen boten.
- Ein Gericht ließe sich heute wohl kaum mehr davon überzeugen, dass die in einer Shopping-App angebotenen Waren und Leistungen zwar detailliert und bebildert dargestellt werden können, nicht aber die - im Übrigen nicht besonders umfangreichen - Pflichtangaben im Impressum.
App-Anbietern ist daher dringend zu raten, in ihren Shopping-Apps ein vollständiges Impressum mit sämtliche Pflichtinformationen vorzusehen.
5. Gestaltung und Platzierung des Impressums
Das Impressum ist vom App-Anbieter
- leicht erkennbar,
- unmittelbar erreichbar und
- ständig verfügbar
direkt in der App bereitzuhalten (§ 5 Abs. 1 DDG). Wie auf Websites gilt dabei auch für Apps: Das Impressum muss auf jeder Seite der App abrufbar sein. Idealerweise wird das Impressum zum festen Bestandteil des App-Menüs gemacht, so dass es von jeder Seite der App mit nur einem Klick erreichbar ist.
Das Impressum sollte leicht als solches erkennbar sein, also insbesondere passend bezeichnet werden. Händler sollten auf Formulierungen verzichten, die dem Nutzer nicht hinreichend deutlich machen, dass sich unter der Bezeichnung das Impressum, also die gesetzliche Anbieterkennzeichnung versteckt. Daher sollte er auch auf die Verlinkung des Impressums unter zweideutigen Symbolen verzichten. In der Praxis haben sich folgende Bezeichnungen bewährt und sind daher zu empfehlen:
- "Impressum" oder
- "Kontakt".
Widerrufsbelehrung und Muster-Widerrufsformular in Apps
Die fehlende oder unzureichende Widerrufsbelehrung im Online-Shop ist ein Klassiker bei Abmahnern. Bereits vermeintliche Lappalien wie die fehlende Angabe einer Telefonnummer im Impressum können schnell kostspielig werden.
Doch muss auch in Apps ausführlich über das Widerrufsrecht informiert werden? Oder genügt dort eine Kurzdarstellung der Widerrufsbelehrung plus Link auf die ausführliche Belehrung im Shop?
1. Rechtlicher Hintergrund: Informationspflichten bei Fernabsatzgeschäften
Der Gesetzgeber verpflichtet Unternehmer, den Verbraucher bei Fernabsatzverträgen über sein 14-tägiges Widerrufsrecht zu informieren (§ 312d Abs. 1 Satz 1 BGB) . Zu den Fernabsatzverträgen gehören insbesondere Verträge über die Lieferung von Waren, die der Unternehmer mit dem Verbraucher unter ausschließlicher Verwendung von Fernkommunikationsmitteln abschließt. Dies sind Kommunikationsmittel, die ohne gleichzeitige körperliche Anwesenheit der Vertragsparteien eingesetzt werden können, insbesondere E-Mail, Messenger und SMS.
Daraus folgt für Apps: Dem Kunden steht beim Kauf eines Produkts über eine App grundsätzlich ein Widerrufsrecht zu. Über dieses muss der Händler den Verbraucher ausführlich informieren.
2. Ordnungsgemäße Widerrufsbelehrung: Was muss hinein?
Liegt ein Fernabsatzgeschäft vor, müssen Händler den Verbraucher über
- die Bedingungen,
- die Fristen,
- das Verfahren für die Ausübung des Widerrufsrechts und
- den Namen, die Anschrift, die E-Mail-Adresse und die Telefonnummer des Unternehmens
belehren.
Die Pflicht zur Angabe auch einer Telefonnummer in die Widerrufsbelehrung ist in den letzten Jahren in verschiedenen Entscheidungen vom BGH entschieden worden (jüngst etwa mit Urteil vom 25. Februar 2025 - Az. VIII ZR 143/24). Zur Vermeidung von Abmahnrisiken sollte daher stets auch die Telefonnummer angegeben werden.
Der Frage, ob eine Telefonnummer in die Widerrufsbelehrung muss, sind wir zudem in einem gesonderten Beitrag nachgegangen.
Der Widerrufsbelehrung ist zudem ein Muster-Widerrufsformular beizufügen. Dieses soll dem Verbraucher die Möglichkeit geben, seinen Widerruf möglichst einfach mit Hilfe des bereitgestellten Formulars zu erklären.
Sämtliche Informationen muss der Verbraucher zudem
- vor Abgabe von seiner verbindlichen Vertragserklärung
- in klarer und verständlicher Weise
erhalten. Informiert der Unternehmer nicht in dem gesetzlich vorgesehenen Umfang, fängt zum einen die Widerrufsfrist für den Verbraucher nicht an zu laufen, zum anderen besteht für den Unternehmer die Gefahr, abgemahnt zu werden.
3. Ausnahme von Informationspflichten bei begrenztem Platzangebot
Das Gesetz verpflichtet Händler dazu, ihren Kunden sämtliche Informationen in klarer und verständlicher Sprache zur Verfügung zu stellen. Dabei stellt sie die mancherlei beschränkte Displaygröße von Smartphones und Tablets jedoch vor eine besondere Herausforderung. Die beschränkte Darstellbarkeit von Informationen berücksichtigt das Gesetz allerdings: Ein Unternehmer muss den Verbraucher bei Fernkommunikationsmitteln, die nur
- begrenzten Raum
- oder begrenzte Zeit
für die Informationen zum Widerrufsrecht vorsehen, lediglich über das Bestehen eines Widerrufsrechts informieren (Art. 246a § 3 EGBGB) .
Beim Verkauf via Apps bedeutet dies: Bieten App-Shops nur begrenzten Raum für die Darstellung der Informationen zum Widerrufsrecht, könnte eine einfache Darstellung des Widerrufsrechts samt Link auf die Widerrufsbelehrung in einem parallelen Webshop genügen.
In der Rechtsprechung hat die Ausnahme in Art. 246a § 3 EGBGB bei Shops in solchen Fernkommunikationsmitteln, die nur begrenzten Raum oder begrenzte Zeit für die dem Verbraucher zu erteilenden Informationen bietet, soweit ersichtlich keine relevante Rolle gespielt.
Der Grund hierfür ist ganz einfach: Solche Fernkommunikationsmittel kommen in der Praxis kaum (mehr) vor. Ursprünglich zielte diese Ausnahme auf Verkäufe, die über Fernkommunikationsmittel erfolgen, auf deren Displays aufgrund von Zeichenbeschränkungen insgesamt nur wenige Informationen darstellbar waren. Dies war in einer Zeit, bevor Smartphones und Tablets mit großen Displays schnellen und nachhaltigen Einzug in den Markt gefunden hatten. Mittlerweile lassen sich sowohl Produktinformationen als auch gesetzliche Pflichtinformationen in der Regel angemessen in Shop-Apps darstellen - dem technischen Fortschritt sei Dank. Daher lässt sich seit längerem nur schwer argumentieren, die Shop-Apps böten nur begrenzen Raum für die Darstellung der Pflichtinformationen.
Der EuGH hat in seinem Urteil vom 23. Januar 2019 (Az. C-430/17) entschieden, dass die Entscheidung den Gerichten der einzelnen EU-Mitgliedstaaten obliegt, ob ein Fernkommunikationsmittel bloß über einen begrenzten Raum oder begrenzte Zeit für Pflichtinformationen verfügt. EuGH urteilte wie folgt:
Die Frage, ob in einem konkreten Fall auf dem Kommunikationsmittel für die Darstellung der Informationen nur begrenzter Raum bzw. begrenzte Zeit zur Verfügung steht […], [ist] unter Berücksichtigung sämtlicher technischer Eigenschaften der Werbebotschaft des Unternehmers zu beurteilen […]. Hierbei hat das nationale Gericht zu prüfen, ob – unter Berücksichtigung des Raumes und der Zeit, die von der Botschaft eingenommen werden, und der Mindestgröße des Schrifttyps, der für einen durchschnittlichen Verbraucher, an den diese Botschaft gerichtet ist, angemessen ist –, alle […] Informationen objektiv in dieser Botschaft dargestellt werden könnten.
Vor diesem Hintergrund wird man in aller Regel annehmen müssen, dass auf den Displays von Smartphones, Tablets & Co in aller Regel hinreichend Platz für die angemessene Darstellung der Pflichtinformationen vorhanden ist. Daher sollten sich in Shopping-Apps sämtliche Informationen zur Widerrufsbelehrung vollständig darstellen lassen.
4. Möglicher Ausschluss des Widerrufsrechts bei digitalen Inhalten
Bieten Händler digitale Inhalte wie Videos, Bilder, Musik oder Software an, steht Verbrauchern grundsätzlich zwar dennoch ein Widerrufsrecht zu, das sie innerhalb der 14-tägigen Widerrufsfrist ausüben können. Händler können das Widerrufsrecht allerdings durch bestimmte Vorkehrungen wirksam ausschließen. Das Widerrufsrecht kann gemäß § 356 Abs. 5 Nr. 2 BGB zum Erlöschen gebracht werden, wenn
- der Unternehmer mit der Vertragserfüllung begonnen hat,
- der Verbraucher ausdrücklich zugestimmt hat, dass der Unternehmer mit der Ausführung des Vertrages vor Ablauf der Widerrufsfrist beginnt,
- der Verbraucher seine Kenntnis davon bestätigt hat, dass durch seine Zustimmung mit Beginn der Ausführung des Vertrages sein Widerrufsrecht erlischt und
- der Unternehmer dem Verbraucher eine Bestätigung über die Zustimmung und die Kenntnis des Verbrauchers hierüber in Textform zur Verfügung gestellt hat (§ 312f Abs. 3 BGB) .
Das Widerrufsrecht erlischt somit nicht automatisch durch Aufnahme in den AGB, denen der Verbraucher mit dem Vertragsschluss zustimmt. Notwendig ist vielmehr die ausdrückliche Bestätigung des Verbrauchers gemäß dem beschriebenen Prozedere, die zum Erlöschen des Widerrufsrechts führt.
Empfehlenswert ist die Implementierung einer Muster-Einverständniserklärung, die per nicht-vorausgefüllter Opt-In-Funktion bestätigt werden muss. Zeitlich muss diese vor dem Bestellabschluss und somit unmittelbar vor Ausführung des Vertrags (=Bereitstellung des Streams oder Downloads) bereitgestellt werden.
Konkrete Vorschläge finden Sie in unserer Handlungsanleitung.
Datenschutz
Beim Betrieb von Online-Shops in Apps werden zwangsläufig auch personenbezogene Daten erhoben, gespeichert und in sonstiger Weise verarbeitet. Dies betrifft bereits die Nutzerdaten der App-Nutzer und erst recht die Kundendaten, die im Zusammenhang mit einer Kundenbestellung erhoben und verarbeitet werden müssen.
1. Pflicht zur DSGVO-Datenschutzerklärung
Die App-Anbieter müssen als Verantwortliche i.S.d. Datenschutzrechts die Nutzer der App über diese Datenverarbeitungen gemäß den Vorgaben der EU Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) vollständig in ihrer Datenschutzerklärung informieren. Fehlende oder unzureichende Informationen zur Datenverarbeitung stellen ein DSGVO-Verstoß dar und können nicht nur zu Abmahnungen, sondern auch zur Verhängung von empfindlichen Geldbußen durch die Datenschutzbehörden führen.
2. Verarbeitung von personenbezogenen Daten
Die datenschutzrechtlichen Informationspflichten greifen nur, soweit personenbezogene Daten erhoben, gespeichert und verarbeitet werden. Darunter fallen alle Informationen, über die irgendwie ein Personenbezug hergestellt werden kann, wie
- Nutzerdaten der App-Nutzer,
- Name und Anschrift,
- E-Mail-Adresse und Telefonnummer und
- Konto- und Zahlungsdaten.
Auch die IP-Adressen der App-Nutzer, die beispielsweise mittels eines Analysedienstes wie z.B. Google-Analytics erhoben werden, werden als personenbezogene Daten angesehen, über deren Erhebung und Verarbeitung ein App-Anbieter datenschutzkonform informieren muss.
3. Inhalt der Datenschutzerklärung
Eine Datenschutzerklärung sollte grundsätzlich Antworten auf folgende Fragen geben:
- Wer ist für die Verarbeitung der personenbezogenen Daten verantwortlich?
- Welche Daten werden erhoben?
- Auf welcher Rechtsgrundlage werden die Daten verarbeitet?
- Zu welchen Zwecken werden die Daten verwendet?
- An welche Dritten werden die Daten weitergegeben?
- Welche Rechte haben die Nutzer bzw. Kunden?
- Wie lange werden die Daten aufbewahrt?
Dabei muss die Datenschutzerklärung über die Verarbeitung sämtlicher Daten informieren. Im Hinblick auf den Betrieb eines Online-Shops muss die Datenschutzerklärung insbesondere darüber informieren, welche personenbezogenen Daten im Bestellvorgang zu welchen Zwecken erhoben und verwendet werden und ob die Daten im Zuge der Bestellabwicklung an Dritte weitergegeben werden (z.B. Versanddienstleister, Zahlungsdienstleister).
4. Darstellung der Datenschutzerklärung
Wie das Impressum und die Widerrufsbelehrung muss auch die Datenschutzerklärung trotz der Platzknappheit in Apps vollständig und gut lesbar hinterlegt werden. Es muss sichergestellt werden, dass die App-Nutzer die Datenschutzerklärung ohne großen Aufwand lesen können.
Bestenfalls sollte die Datenschutzerklärung fester Bestandteil des App-Menüs sein, so dass sie stets erreichbar ist und abgerufen werden kann. Auch hier sollte sich die Datenschutzerklärung nicht unter unklaren Symbolen oder Bezeichnungen verstecken, sondern mit eindeutigen Betriffen wie
- "Datenschutz",
- "Datenschutzerklärung",
- "Datenschutzhinweise" oder
- "Datenschutzinformationen"
betitelt werden. Darüber hinaus muss die Information in allgemein verständlicher Form erfolgen, sodass technische oder juristische Fachbegriffe und Formulierungen möglichst vermieden werden sollten.
Wir bieten unseren Abo-Mandanten, die eines unserer Schutzpakete gebucht haben, abmahnsichere Rechtstexte - einschließlich Datenschutzerklärungen - zur rechtlichen Absicherung von Webshops und App-Shops bzw. Mobile Shops in unseren Starter-Paketen bereits ab monatlich EUR 9,90 zzgl. USt. an.
Sprechen Sie uns gerne an, wenn Sie hierzu Fragen haben.
Cookies
1. Vorgaben für Cookies
Nicht nur Websites, sondern auch Apps setzen Cookies und ähnliche Technologien ein, die neben dem Datenschutzrecht der DSGVO besonderen rechtlichen Vorgaben unterliegen.
Cookies sind kleine Textdateien, die auf dem Endgerät (=Smartphone, Tablet, Computer) gespeichert werden, um die Präferenzen und Aktivitäten der App-Nutzer zu erfassen. Sie ermöglichen es, den einzelnen App-Nutzer wieder zu erkennen, den Inhalt des Warenkorbs zu erinnern oder dessen Nutzerverhalten zu speichern und auch über die Nutzung anderer digitalen Dienste hinweg weiterzuverfolgen.
2. Einwilligungspflicht
Nach den Vorgaben des Gesetzes über den Datenschutz und den Schutz der Privatsphäre in der Telekommunikation und bei digitalen Diensten (TTDSG) besteht bei bestimmten Arten von Cookies und ähnlichen Technologien eine vorherige Einwilligungspflicht der App-Nutzer (§ 25 TTDSG):
- Demnach sind die Speicherung von Informationen im Endgerät des App-Nutzers oder der Zugriff auf Informationen, die bereits in dessen Endgerät gespeichert sind, nur zulässig, wenn der App-Nutzer auf der Grundlage von klaren und umfassenden Informationen bereits im Vorfeld darin eingewilligt hat.
- Ausnahmsweise ist die vorherige Einwilligung u.a. nicht erforderlich, wenn die Speicherung von Informationen im Endgerät des Nutzers oder der Zugriff auf bereits in dessen Endgerät gespeicherte Informationen erforderlich ist, damit der Anbieter den vom Nutzer ausdrücklich gewünschten digitalen Dienst zur Verfügung stellen kann. Dies ist dann der Fall, wenn der Einsatz des jeweiligen Cookies technisch notwendig ist, um diesen Dienst bereitzustellen.
Bei einwilligungspflichtigen Cookies müssen die App-Anbieter sicherstellen, dass Cookies jeweils nur eingesetzt werden, wenn der einzelne App-Nutzer zuvor über die Cookies informiert worden ist und sich mit deren Einsatz ausdrücklich einverstanden erklärt hat. Dies erfolgt in der Praxis typischerweise im Rahmen eines sog. Cookie-Consent-Tools ("Cookie-Banner"), das dies rechtssicher abbilden muss.
Fazit
Online-Handel über Apps läuft rechtlich im Prinzip nicht anders als im World Wide Web:
- Auch Shop-Betreiber, die ihre Produkte über Shopping-Apps vertreiben, müssen die gesetzlichen Informationspflichten erfüllen, etwa im Impressum zur Anbieterkennung, hinsichtlich des Verbraucher-Widerrufsrechts und insbesondere auch zum Datenschutz.
- Zwar stehen App-Shops in keinem besonderen Fokus von Abmahnern, da sie sich nicht so leicht und schnell automatisiert überprüfen lassen wie Webshops. Verstöße gegen gesetzliche Informationspflichten in Apps sind dennoch leicht erkennbar.
- Händler sollten ihre App-Shops daher rechtskonform gestalten.
Als IT-Recht Kanzlei unterstützen wir Sie hierbei natürlich gerne. Sprechen Sie uns bei Fragen hierzu gerne an.
Fragen zum Beitrag? Diskutieren Sie hierzu gerne mit uns in der Unternehmergruppe der IT-Recht Kanzlei auf Facebook.
Link kopieren
Als PDF exportieren
Per E-Mail verschicken
Zum Facebook-Account der Kanzlei
Zum Instagram-Account der Kanzlei

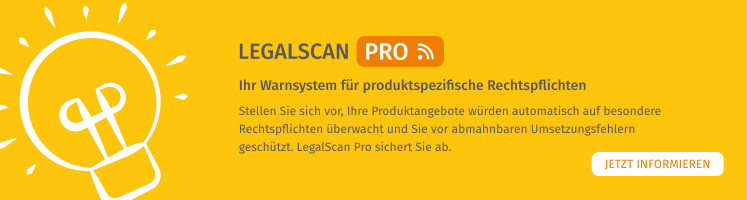

0 Kommentare