Expertenmeinung gefragt - auf wen es bei Beurteilung von Eintragungshindernissen ankommt
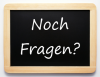
Ein Löschungsanspruch wegen beschreibender Wirkung des Markennamens ist auch bei der Benutzung von Fremdsprachen zu bejahen. Bei bestimmten Waren kommt es bei der Beurteilung des Vorliegens eines absoluten Eintragungshindernisses nicht auf die Sicht des Durchschnittsverbrauchers, sondern auf die des Fachmanns an.
Das Bundespatentgericht (BPatG) hat in einer Entscheidung eine Präzisierung bezüglich der zu stellenden Anforderungen an einen Löschungsanspruch gem. § 50 MarkenG, wegen fehlender Unterscheidungskraft eines Markennamens vorgenommen. Bei der Beurteilung, ob eine ausreichende Unterscheidungskraft vorliegt, ist im Regelfall auf die Auffassung des „normal informierten und verständigen“ Durchschnittsverbrauchers abzustellen. Es besteht jedoch die Möglichkeit, dass bei einem bestimmten Warenbereich nicht auf die Sicht eines Durchschnittsverbrauchers, sondern auf die eines Fachmanns abzustellen ist. Dies ist dann der Fall, wenn beim Erwerb der Ware vom Endverbraucher immer ein Fachpersonal zu Rate hinzugezogen wird. In diesem Fall wird bei der Beurteilung, ob eine Verwechslungsgefahr besteht, vollständig auf die Sicht des Experten abgestellt.
Des Weiteren kann auch eine beschreibende Wirkung eines Markennamens vorliegen, wenn er in einer Fremdsprache ist, Bundespatentgericht (BPatG), Entscheidung vom 06.08.2013, Az.: 25 W (pat) 10/12;
Was ist vorgefallen?
Beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) wurde die Wortmarke „Secca“ eingetragen. Das Amt erkannte zwar die Bedeutung des italienischen Wortes „secco/a“ für u. a. „dürr, getrocknet“ oder „trocken“, erblickte jedoch hierin für die Warenklasse 19 „Schiefer, insbes. Naturschiefer“ keine Warenbeschreibung. Nach Ansicht des DPMA wären Angaben wie „Dicke“, „mechanische Festigkeit“, „Inhalt von Karbonat“ und dergleichen für Schiefer warenbeschreibende Merkmale. Die „Trockenheit“ gehört allerdings nicht zu einer Beschreibung einer Eigenschaft von Schiefer.
Überdies handelt es sich um ein italienisches Wort. Da jedoch 90 % des Schiefers aus Spanien importiert würde, sei dies schon deshalb nicht warenbeschreibend. Die Löschungsantragstellerin widersprach dem und argumentierte, dass von Schieferfachleuten mit dem Adjektiv „seca“ durchaus ein ganz bestimmtes Schiefervorkommen mit speziellen Charakteristika in Spanien bezeichnet werde und damit durchaus eine Produktbezeichnung vorliegt. Die schriftbildliche Abwandlung des „doppel-c“ im italienischen und des „einfachen c“ im spanischen ändere an dieser Tatsache nichts, da ein Empfänger hier an einen Schreibfehler glauben werde.
Der rechtliche Rahmen:
a) Die Unterscheidungskraft einer Marke
§ 50 MarkenG statuiert die Voraussetzungen für einen Löschungsanspruch einer Marke, die trotz Vorliegen eines oder mehrerer absoluter Schutzhindernisse im Register eingetragen ist. Ein derartiges absolutes Eintragungshindernis besteht gem. § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG für solche Marken, denen für Waren oder Dienstleistungen jegliche Unterscheidungskraft fehlt. Hierbei versteht man unter der Unterscheidungskraft, die einer Marke innewohnende (konkrete) Eignung, vom Verkehr als betrieblicher Herkunftsnachweis aufgefasst zu werden. Die Hauptfunktion einer Marke ist es also, den Verbraucher wissen zu lassen, woher eine Ware oder Dienstleistung stammt, also seine Ursprungsidentität zu gewährleisten.
Der Verbraucher soll bei der Beurteilung keiner Verwechslungsgefahr ausgesetzt sein, (vgl. dazu: EuGH GRUR 2004, 428, Tz. 30, 31, ebenso: BGH GRUR 2006, 850, Tz. 18, FUSSBALL WM 2006).
Auch warenbeschreibende Markennamen gem. § 8 Abs. 2 Nr.2 MarkenG begründen einen Löschungsanspruch. Eine solche produktbezeichnende Verwendung liegt dann vor, wenn der gewählte Markenname gleichzeitig das Produkt beschreibt, für das es steht. Als Beispiel sei der Markenname „AntiVir“ für ein PC Ani-Virenprogramm genannt. Hier ist jedem Verbraucher wohl auf Anhieb klar, worum es sich bei der Ware, die unter diesem Markennamen vertrieben wird, handelt.
b) Warenbeschreibende Wirkung von fremdsprachlichen Begriffen?
Bei der Beurteilung, wann eine Produktbeschreibung vorliegt, ist nicht alleine auf deutsche Sprache abzustellen. Nach gefestigter Rechtsprechung sind Begriffe aus dem Englischen, Französischen, Italienischen, Spanischen und Portugiesischen, sowie anderen Sprachen durchaus geeignet, Waren oder Dienstleistungen zu beschreiben und stellen ebenso ein absolutes Eintragungshindernis iSv. § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG dar.
c) Auf wen kommt es bei der Beurteilung an?
Bei „Alltagswaren“ wird bei der Beurteilung, ob ein Schutzhindernis vorliegt auf die Auffassung der beteiligten inländischen Verkehrskreise abgestellt. Hierbei kommt es auf die Auffassung eines normal informierten, angemessen aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbrauchers im Bereich des einschlägigen Waren- und Dienstleistungsangebots an. Sofern es sich jedoch nicht um „Alltagswaren- oder Dienstleistungen“ handelt und der Endverbraucher regelmäßig einen Fachmann zum Erwerb der Ware oder Dienstleistung heranzieht, ist dessen Beurteilung abzustellen. Dieses gilt für sämtliche Verwechslungsgefahren, die bei seiner Beurteilung unterlaufen können.
Die rechtliche Einordnung des BPatG:
Das BPatG urteilte anhand des eben dargestellten rechtlichen Rahmens und ordnete die Löschung der Wortmarke „Secca“ an. Der Senat fand heraus, dass es tatsächlich eine Schieferart gibt, die vom Fachverkehr als „seca“ bezeichnet wird und gewisse charakteristische Merkmale besitzt. Dies bestätigt auch eine spanische Organisation für Schiefer. Des Weiteren recherchierte das Gericht, dass die Bezeichnung „Seca“ auch von einem französischen Schieferhändler als Produkt- bzw. Eigenschaftsangabe verwendet wird.
Bezüglich des Buchstabens „c“ im Wort „secca“ bzw. „seca“ urteilten die Richter, dass die angesprochenen deutschen Fachleute die Abweichung der angegriffenen Marke „Secca“ und der Beschreibung „seca“ im Einzelfall wohl nicht bemerken würden. Sofern sie dies doch im Zusammenhang mit dem Produkt „Schiefer“ bemerken würden, so würden sie dies wohl für einen Hör- oder Druckfehler halten, da beide im Regelfall gleich ausgesprochen werden. Der Senat sprach daher eine erforderliche Unterscheidungskraft ab und ordnete an, die Marke aus dem Register zu löschen.
Das Fazit:
Der Fall zeigt deutlich auf, dass bei der Recherche zur Findung eines Markennamens einiges an Recherchewand geboten ist, um nicht Gefahr zu laufen, dass der gewünschte Markenname einem Löschungsantrag eines Mitbewerbers ausgesetzt ist. Das DPMA hatte zwar auch einiges an Recherchearbeit geleistet, doch waren die Bemühungen des Bundespatentgerichtes höher und brachten eindeutige Ergebnisse hervor.
Letztlich bleibt der Antragsteller selbst dafür verantwortlich, sicherzustellen, dass keine Eintragungshindernisse vorliegen. Diese Arbeit im Vorfeld der Markenfindung sollte also keinesfalls vernachlässigt werden, um spätere rechtliche Schwierigkeiten sowie finanzielle Nachteile zu vermeiden. Gerade bei beschreibenden Markennamen ist die Versuchung groß, diese zu benutzen, da sie dem Verbraucher eingänglich sind und einen Werbeeffekt haben. Hierbei ist zu beachten, dass auch eine Warenbeschreibung vorliegt, wenn eine Fremdsprache benutzt wird.
Zuletzt ist festzustellen, das bei der Beurteilung, ob ein absolutes Eintragungshindernis vorliegt, im Normalfall auf einen verständigen Durchschnittsverbraucher abzustellen ist. In einigen Ausnahmesituationen wird dabei allerdings auf die Beurteilung eines kundigen Fachmanns abgestellt. Dies ist immer dann der Fall, wenn der Endverbraucher beim Erwerb des Produkts oder der Dienstleistung, die unter dem Markennamen vertrieben wird, im Regelfall immer einen solchen Fachmann zur Beratung hinzuzieht.
Fragen zum Beitrag? Diskutieren Sie hierzu gerne mit uns in der Unternehmergruppe der IT-Recht Kanzlei auf Facebook.
Link kopieren
Als PDF exportieren
Per E-Mail verschicken
Zum Facebook-Account der Kanzlei
Zum Instagram-Account der Kanzlei

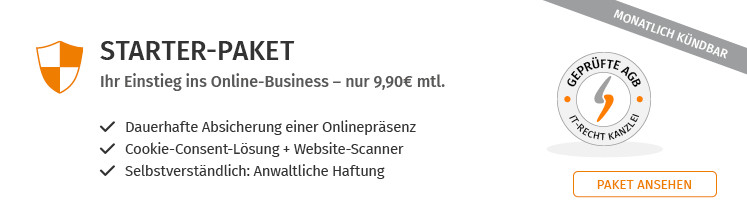




0 Kommentare