EuGH: Entfall der Einwilligung beim Email-Newsletter?

Email-Newsletter sind ein beliebtes Marketing-Instrument, doch in Deutschland sehr strengen Zulässigkeitsvoraussetzungen unterworfen. Eine Entscheidung des EuGH scheint auf den ersten Blick massive Erleichterung zu bringen – ein Trugschluss.
Inhaltsverzeichnis
- EuGH-Urteil sorgt für ordentlich Verwirrung
- Worum geht es überhaupt?
- Grundsatz: Newsletter immer nur mit Einwilligung
- Ausnahme: Newsletter ohne Einwilligung in engen Grenzen
- Alles neu macht der EuGH?
- Funktionaler Newsletter-Begriff
- Weites Verständnis des Begriffs „Verkauf“
- Vorrang von Art. 13 Abs. 2 ePrivacy-RL gegenüber Art. 6 Abs. 1 DSGVO
- Fazit
EuGH-Urteil sorgt für ordentlich Verwirrung
Seit einigen Tagen sorgt ein Urteil des Europäischen Gerichtshofs vom 13.11.2025 in der Rechtssache C-654/23 für Verwirrung.
Es häufen sich Artikel mit dem Tenor „EuGH ermöglicht Newsletter ohne Einwilligung “ unter Bezugnahme auf die aktuelle Rechtsprechung des EuGH, die Webseitenbetreibern und Online-Händlern die Hoffnung machen, Newsletter könnten von nun an viel einfacher als bisher rechtskonform versendet werden.
Bereits vorab bleibt festzuhalten, dass sich in der Praxis des rechtskonformen Newsletter-Versandes durch das EuGH-Urteil jedoch keine gravierenden Erleichterungen ergeben.
Die vielfach verbreitete Euphorie im Zusammenhang mit der Berichterstattung über die Entscheidung des EuGH ist also fehl am Platz.
Denn: Den teilweise verlautbarten Paradigmenwechsel gibt es nicht. Vielmehr hat sich in der Sache kaum etwas getan hat.
Ob daher alles beim Alten bleibt, lesen Sie im Folgenden.
Worum geht es überhaupt?
Die Werbung per Email ist ein stark verbreitetes Marketing-Instrument, auf welches nur die wenigsten Webseitenbetreiber und Online-Händler verzichten können und wollen.
Durch einen Email-Newsletter lässt sich mit überschaubarem Aufwand und bei geringen Kosten ein ganz erhebliches Marketingpotential ausschöpfen.
Gerade, wenn es in Richtung Weihnachtsgeschäft und „Black Week“ geht, steckt viel Potential in einer entsprechenden Newsletter-Kampagne.
Aber auch zur Schaffung bzw. Steigerung der Kundenbindung ist die Ansprache per Email ein wichtiges Instrument.
Die Werbung mittels Email-Newsletter bietet zahlreiche Vorteile, etwa:
- Direkte Kundenansprache: Webseitenbetreiber und Online-Händler erreichen Interessenten wie Kunden persönlich und regelmäßig im Posteingang. Dadurch können Inhalte gezielt und segmentiert auf Interessen abgestimmt werden.
- Effektive Verkaufsförderung: Durch gezielte Angebote, Produktvorstellungen und entsprechende Ansprache lassen sich Verkäufe direkt steigern.
- Schnelle und flexible Kommunikation: Produktneuheiten, Angebote und Aktionen können kurzfristig und direkt kommuniziert werden.
- Kosteneffizienz: Im Vergleich zu klassischen Print- oder Postwerbekampagnen erfolgt die Erstellung sowie der Versand eines Newsletters deutlich günstiger und ressourcenschonender.
- Messbarkeit: Öffnungs-, Klick- und Conversion-Raten lassen sich genau ermitteln. Das ermöglicht eine laufende Optimierung und Erfolgskontrolle.
- Starke Kundenbindung: Regelmäßig versendete Newsletter stärken die Bindung zum Unternehmen und können so nachhaltige Kundenbeziehungen schaffen.
- Unternehmens- und Markenbekanntheit: Durch regelmäßige, hochwertige Informationen bleibt das werbende Unternehmen im Gedächtnis von Interessenten und Kunden.
Wussten Sie schon?
Update-Service-Mandanten der IT-Recht Kanzlei (und solche, die es werden wollen) profitieren von der Kooperation mit Campaign.Plus und können kostenfrei monatlich bis zu 7.500 professionelle Email-Newsletter versenden lassen.
Details und eine Anmeldemöglichkeit finden Mandanten im Mandanten-Portal.
So positiv ein Email-Newsletter aus Sicht des Werbenden erscheinen mag, so negativ empfindet ein Empfänger den Newsletter, wenn er diesen gar nicht wünscht. Nahezu jeder Email-Nutzer muss heutzutage Tools wie Spamfilter oder Email-Sortierung nutzen, um der Flut an Email-Spam, also Werbung per Email, in die gar nicht eingewilligt wurde, überhaupt noch Herr werden zu können.
Nicht zuletzt aus diesem Grund hat der Gesetzgeber sehr strikte Anforderungen aufgestellt, damit eine werbliche Ansprache per Email überhaupt in zulässiger Weise erfolgen kann.
Egal, ob mit einem solchen Newsletter direkt die zu verkaufende Ware, eine aktuelle Rabattaktion wie etwa am „Black Friday“ oder nur die kommerziell betriebene Webseite mit deren Inhalten, ggf. mit kostenpflichtigen Zusatzdiensten, angepriesen wird:
Im rechtlichen Sinne handelt es sich nahezu immer um Werbung. Und eine solche Werbung per Email "ungefragt" zu versenden, ist grundsätzlich unzulässig. Wer sich als Werbender nicht an das Verbot hält, muss mit Abmahnungen, Unterlassungserklärungen, Schadensersatzansprüchen und Aktivitäten der Datenschutzbehörden rechnen (Anhörungen, Bußgelder etc.).
Zulässig ist der Versand eines Email-Newsletters grundsätzlich immer nur nach erteilter, vorheriger Einwilligung des Email-Empfängers.
Nur ganz ausnahmsweise kommt auch ein zulässiger Versand ohne eine solche Einwilligung in Betracht.
Grundsatz: Newsletter immer nur mit Einwilligung
In aller Regel darf ein Email-Newsletter nur dann verschickt werden, wenn der Empfänger vor dem Versand ausdrücklich und freiwillig in den Erhalt von Email-Werbung durch den Werbenden eingewilligt hat. Andernfalls ist nach dem Gesetz stets von einer unzumutbaren Belästigung durch die Werbe-Email auszugehen, § 7 Abs. 2 Nr. 2 UWG.
Eine unzumutbare Belästigung ist stets anzunehmen
(…)
bei Werbung unter Verwendung einer automatischen Anrufmaschine, eines Faxgerätes oder elektronischer Post, ohne dass eine vorherige ausdrückliche Einwilligung des Adressaten vorliegt,
Mit anderen Worten:
Der Adressat des Email-Newsletters muss also zuvor ausdrücklich „Ja“ gesagt haben, was den Erhalt solcher Werbung per Email betrifft.
Dies geschieht typischerweise im Rahmen einer Newsletter-Anmeldemaske, wo der Interessent bzw. Kunde aktiv eine Checkbox anhakt (diese darf nicht vorausgewählt sein) und mittels eines Einwilligungstextes über Bedeutung, Umfang und Widerruflichkeit seiner Einwilligung informiert wird.
Indem er dort seine Email-Adresse hinterlegt, die Checkbox anhakt, und die Anmeldung absendet, erklärt er seine Einwilligung in den künftigen Erhalt von Email-Werbung durch den Anbieter des Newsletters.
Damit die Einwilligung auch tatsächlich von der berechtigten Person, also dem Inhaber der angegebenen Email-Adresse, eingeholt wird, muss in technischer Hinsicht das sogenannte Double-Opt-In-Verfahren durchgeführt werden. Die Aktivierung des Newsletterversandes erfolgt dabei in zwei Stufen:
1. Stufe:
Auf die Anmeldung zum Newsletter hin muss der Werbende dabei zunächst eine Bestätigungs-Email ohne werblichen Charakter an den Interessenten über die erfolgte Newsletter-Anmeldung versenden.
Diese enthält einen Bestätigungslink, der erst aktiv angeklickt werden muss, damit der Newsletter-Versand „scharfgeschaltet“ wird.
2. Stufe:
Nach Erhalt der Bestätigungsemail klickt der Interessent auf den enthaltenen Bestätigungslink. Damit ist sichergestellt, dass sich der „Verfügungsberechtigte“ über die angegebene Email-Adresse auch tatsächlich zum Newsletter-Versand angemeldet hat, und kein Dritter, und so eine ausreichende Einwilligung in den Erhalt von Email-Werbung vorliegt.
Wichtig: Ohne Aktivierung des Links darf keinerlei Werbung per Email erfolgen.
Wie die rechtskonforme Anmeldung zu einem Newsletter in der Praxis konkret ausgestaltet werden kann, zeigen wir Ihnen gerne im folgenden Leitfaden.
Das Grundproblem in der Praxis besteht für den Werbenden also darin, dass es einer aktiven Anmeldung von Interessenten bzw. Kunden bedarf, um rechtssicheres Email-Marketing betreiben zu können.
Mit anderen Worten: Der Werbende ist darauf angewiesen, dass sich Interessenten für seinen Newsletter anmelden.
Er kann den Empfängerkreis also gerade nicht beliebig erweitern, etwa indem er seinen Newsletter einfach an ihm bekannte, von ihm recherchierte oder gar im Tausenderpack gekaufte Email-Adressen sendet.
Ausnahme: Newsletter ohne Einwilligung in engen Grenzen
Eine (in der Praxis jedoch nur sehr begrenzt anwendbare) Ausnahme vom Einwilligungserfordernis beim Newsletter-Versand existiert in § 7 Abs. 3 UWG für den Fall einer bestehenden Geschäftsbeziehung:
Abweichend von Absatz 2 Nummer 2 ist eine unzumutbare Belästigung bei einer Werbung unter Verwendung elektronischer Post nicht anzunehmen, wenn
1. ein Unternehmer im Zusammenhang mit dem Verkauf einer Ware oder Dienstleistung von dem Kunden dessen elektronische Postadresse erhalten hat,
2. der Unternehmer die Adresse zur Direktwerbung für eigene ähnliche Waren oder Dienstleistungen verwendet,
3. der Kunde der Verwendung nicht widersprochen hat und
4. der Kunde bei Erhebung der Adresse und bei jeder Verwendung klar und deutlich darauf hingewiesen wird, dass er der Verwendung jederzeit widersprechen kann, ohne dass hierfür andere als die Übermittlungskosten nach den Basistarifen entstehen.
Die Ausnahmevorschrift des § 7 Abs. 3 UWG hat es in der Praxis „in sich“. Was auf dem Papier relativ leicht erfüllbar wirkt, wächst sich in der Praxis oftmals zu einem großen Problem aus und führt nicht selten zu Streit und teuren Abmahnungen.
Nicht nur, dass es oft bereits an den formalen Anforderungen fehlt (etwa Hinweis bei Erhebung bzw. Verwendung auf die jederzeitige Widerspruchsmöglichkeit ohne Kostenanfall mit Ausnahme der Übermittlungskosten nach den Basistarifen).
In aller Regel scheitert die Rechtfertigung des einwilligungslosen Newsletterversandes nach § 7 Abs. 3 UWG am Tatbestandsmerkmal der Ähnlichkeit der im Newsletter beworbenen Ware bzw. Dienstleistung. Hier werden sehr strenge Anforderungen gestellt, so dass die werbliche Wirkung des Newsletters massiv kastriert werden muss, um die Zulässigkeitsvoraussetzungen des § 7 Abs. 3 UWG überhaupt einhalten zu können.
Damit geht nicht nur ein erheblicher Verlust der Werbewirkung einher. Vielmehr steigt auch der Aufwand massiv an, da es quasi eines individuellen Newsletters je Kunden bedarf, inhaltlich angepasst bzw. kastriert auf die bereits zuvor einmal gekaufte Ware(n), jedenfalls wenn der Händler nicht nur einen Artikel bzw. eine Artikelart vertreibt.
Ist auch nur eines der oben genannten Tatbestandsmerkmale des § 7 Abs. 3 UWG nicht erfüllt, wird der Newsletter „rechtswidrig“ und dürfte somit gar nicht versendet werden. Andernfalls drohen Ärger und Abmahnungen.
Insbesondere sagt § 7 Abs. 3 UWG gerade nicht aus, dass Newsletter an Bestandskunden per se ohne Einwilligung versendet werden dürfen.
Die Vorschrift regelt vielmehr sehr formal und unter ganz engen Voraussetzungen, wann ausnahmsweise ein Newsletter ohne vorherige Einwilligung an Bestandskunden versendet werden darf.
Hier finden Sie unseren Leitfaden für den rechtssicheren Versand eines Newsletters an Bestandskunden ohne Einwilligung.
Alles neu macht der EuGH?
Vorab zu Klarstellung: Die Entscheidung des EuGH bezieht sich gerade nicht auf den Fall des Newsletters mit Einwilligung nach § 7 Abs. 2 Nr. 2 UWG.
Der EuGH hat sich rein mit der Zulässigkeit der Konstellation des Newsletters ohne Einwilligung beschäftigt, die in § 7 Abs. 3 UWG geregelt ist.
Hinsichtlich der Zulässigkeit eines Newsletters ohne Einwilligung hat sich der Gerichtshof zudem (nur) mit einer absoluten Sonderkonstellation beschäftigt:
Konkret ging es in dem vom EuGH zu entscheidenden Streitfall um die Beantwortung von Vorlagefragen eines rumänischen Tribunalgerichts zur Zulässigkeit des Newsletterversandes ohne Einwilligung nach Art. 13 Abs. 2 der Richtlinie 2002/58/EG („ePrivacy-RL“), in Deutschland umgesetzt durch § 7 Abs. 3 UWG) .
Stein des Anstoßes war dabei ein in Rumänien ansässiges Online-Rechtsinformationsportal, das seine Informationen in beschränktem Umfang kostenfrei und im vollen Umfang im Rahmen eines kostenpflichtigen „Premium-Dienstes“ zugänglich machte.
Nutzer können bis zu sechs Artikel des Mediums pro Monat kostenfrei lesen. Nutzer, die Zugriff auf weitere Inhalte wünschen, müssen ein kostenloses Benutzerkonto einrichten, verbunden mit der Zustimmung zu den Bedingungen des „Premium-Dienstes“.
Wer ein solches, kostenfreies Benutzerkonto eröffnete, erlangte damit Zugriff auf zwei zusätzliche „Freiartikel“ pro Monat und ein „Personal Update“ in der Form eines täglichen Email-Newsletters mit Informationen zu gesetzgeberischen Neuerungen inklusive Links zu den entsprechenden Artikeln auf der Webseite des Informationsportals. Weiterhin bestand die Möglichkeit, gegen Bezahlung auf zusätzliche Artikel und Analysen zuzugreifen.
Bei der Registrierung des Benutzerkontos bestand die Option, den Newsletter „Personal Update“ im Rahmen eines Opt-outs abzulehnen. Auch später konnte der Newsletter jederzeit über eine „Abbestellen“-Schaltfläche abbestellt werden.
Die rumänische Datenschutzbehörde ANSPDCP verhängte gegen die Portal-Betreiberin eine Geldbuße wegen Verstoßes gegen Art. 5 Abs. 1 Buchst. a, b, Art. 6 Abs. 1 Buchst. a sowie Art. 7 DSGVO. Hiergegen wehrte sich die Betreiberin und klagte gegen die Entscheidung der Datenschutzbehörde vor dem Tribunalgericht.
Dieses Gericht legte dem EuGH dann Fragen zur Vorabentscheidung betreffend die Auslegung der Vorschrift des Art. 13 ePrivacy-RL vor.
Artikel 13 Abs. 1 und Abs. 2 ePrivacy-RL lauten wie folgt:
Unerbetene Nachrichten
(1) Die Verwendung von automatischen Anrufsystemen ohne menschlichen Eingriff (automatische Anrufmaschinen), Faxgeräten oder elektronischer Post für die Zwecke der Direktwerbung darf nur bei vorheriger Einwilligung der Teilnehmer gestattet werden.
(2) Ungeachtet des Absatzes 1 kann eine natürliche oder juristische Person, wenn sie von ihren Kunden im Zusammenhang mit dem Verkauf eines Produkts oder einer Dienstleistung gemäß der Richtlinie 95/46/EG deren elektronische Kontaktinformationen für elektronische Post erhalten hat, diese zur Direktwerbung für eigene ähnliche Produkte oder Dienstleistungen verwenden, sofern die Kunden klar und deutlich die Möglichkeit erhalten, eine solche Nutzung ihrer elektronischen Kontaktinformationen bei deren Erhebung und bei jeder Übertragung gebührenfrei und problemlos abzulehnen, wenn der Kunde diese Nutzung nicht von vornherein abgelehnt hat.
(Hinweis: Die o.g. Vorgaben des Art. 13 ePrivacy-RL wurden durch § 7 Abs. 2 Nr. 2 und Abs. 3 UWG in deutsches Recht umgesetzt).
Das vorlegende Gericht wollte dabei vom EuGH primär wissen, ob Art. 13 Abs. 1 und 2 ePrivacy-RL dahingehend auszulegen sind,
- dass die Email-Adresse des Newsletter-Empfängers auch dann „im Zusammenhang mit dem Verkauf eines Produkts oder einer Dienstleistung“ im Sinne von Art. 13 Abs. 2 ePrivacy-RL erhalten worden ist, wenn dieser Nutzer (nur) ein kostenloses Angebot des Anbieters nutzt, und
- dass die Übersendung eines Newsletters wie im Streitfall eine Verwendung von elektronischer Post „zur Direktwerbung“ für „ähnliche Produkte oder Dienstleistungen“ im Sinne von Art. 13 Abs. 2 ePrivacy-RL darstellt.
Über diese Fragen entschied der EuGH nun im Rahmen seines Urteils vom 13.11.2025.
Funktionaler Newsletter-Begriff
Der streitgegenständliche Newsletter war kein klassischer „Verkaufsnewsletter“, mit welchem eine bestimmte Ware oder Dienstleistung angepriesen wurde. Dieser hatte vorrangig informativen Charakter, da er in erster Linie Rechtsinformationen enthielt.
Der EuGH stellte fest, dass Art. 13 Abs. 1 und 2 ePrivacy-RL keine Legaldefinition des Begriffs „elektronischer Post für die Zwecke der Direktwerbung“ enthält.
Nach der Rechtsprechung des EuGH seien von diesem Begriff Nachrichten umfasst, die ein kommerzielles Ziel umfassen und sich direkt und individuell an Verbraucher richten.
Der hier streitgegenständliche, tägliche Email-Newsletter hat in erster Linie informativen Charakter, da mit diesem Informationen zu Rechtsthemen verbreitet werden.
Dennoch unterfalle der gegenständliche Newsletter diesem Begriff und stelle eine Form der Direktwerbung dar, weil der Nutzer durch ihn dazu bewegt werden solle, auch kostenpflichtige Inhalte des Medienanbieters abzurufen und damit den Verkauf fördert:
Was erstens den Wortlaut von Art. 13 Abs. 1 und 2 der Richtlinie 2002/58 betrifft, ist festzustellen, dass diese Bestimmung keinen Hinweis auf die Bedeutung des Begriffs der Nachricht enthält, die „für die Zwecke der Direktwerbung“ erfolgt. Hingegen ergibt sich aus der Rechtsprechung des Gerichtshofs, dass dieser Begriff Nachrichten erfasst, mit denen ein kommerzielles Ziel verfolgt wird und die sich direkt und individuell an einen Verbraucher richten (vgl. in diesem Sinne Urteil vom 25. November 2021, StWL Städtische Werke Lauf a.d. Pegnitz, C 102/20, EU:C:2021:954, Rn. 47).
Im Hinblick auf diese Kriterien hat der Gerichtshof entschieden, dass Werbenachrichten, die die Bewerbung von Diensten zum Gegenstand haben und in der Form einer E Mail verbreitet werden, so dass sie direkt in der Inbox des privaten E Mail-Postfachs des betreffenden Nutzers erscheinen, solche Nachrichten darstellen (vgl. in diesem Sinne Urteil vom 25. November 2021, StWL Städtische Werke Lauf a.d. Pegnitz, C 102/20, EU:C:2021:954, Rn. 48).
Im vorliegenden Fall besteht ausweislich der Vorlageentscheidung die im Ausgangsverfahren in Rede stehende Nachricht in einem täglichen Newsletter, der in Form einer E Mail verbreitet wird und eine Zusammenfassung von gesetzgeberischen Neuerungen, die in den Artikeln eines Online-Pressemediums behandelt werden, sowie Hyperlinks zu diesen Artikeln enthält. Erst durch Klicken auf diese Hyperlinks können die betreffenden Nutzer deren vollständigen Inhalt einsehen, kostenlos bis zu acht Artikel pro Monat und gegen Bezahlung sämtliche Artikel, die auf der von Inteligo Media betriebenen Online-Plattform verfügbar sind.
Der vom vorlegenden Gericht angeführte Umstand, dass diese Nachricht, da sie eine Zusammenfassung der in den Artikeln dieses Mediums behandelten Themen enthalte, auch einen informativen Inhalt habe, kann nicht bedeuten, dass sie vom Begriff der Nachricht „für die Zwecke der Direktwerbung“ im Sinne von Art. 13 Abs. 1 und 2 der Richtlinie 2002/58 und damit vom Anwendungsbereich dieser Bestimmung auszunehmen wäre.
Vielmehr soll eine solche Nachricht, wie der Generalanwalt in den Nrn. 32 bis 34 seiner Schlussanträge im Wesentlichen ausgeführt hat, die betreffenden Nutzer dazu veranlassen, auf den von einem Presseherausgeber bereitgestellten kostenpflichtigen Inhalt zuzugreifen, indem sie dazu beiträgt, dass die Anzahl der Artikel, die auf der fraglichen Online-Plattform kostenlos abgerufen werden können, bald erschöpft ist und ein volles Abonnement abgeschlossen wird. Sie soll somit den Verkauf dieses Inhalts fördern und verfolgt daher ein kommerzielles Ziel im Sinne der in Rn. 41 des vorliegenden Urteils angeführten Rechtsprechung. Da die Nachricht, die in Form einer E Mail verbreitet wird, direkt im Posteingang des privaten E Mail-Postfachs ihrer Empfänger erscheint, ist außerdem davon auszugehen, dass sie „für die Zwecke der Direktwerbung“ im Sinne von Art. 13 Abs. 1 und 2 der Richtlinie 2002/58 erfolgt, und zwar unabhängig von der Frage, ob dieser Zweck allein aus dem Inhalt der Nachricht oder auch aus der Struktur des Angebots des Absenders der Nachricht abgeleitet werden kann.
Damit stellt der EuGH klar, dass der streitgegenständliche Newsletter grundsätzlich den Regelungen des Art. 13 Abs. 1 und 2 ePrivacy-RL unterfällt.
Weites Verständnis des Begriffs „Verkauf“
Der größte rechtliche Erkenntnisgewinn der EuGH-Entscheidung dürfte sich in Bezug auf das Verständnis des Tatbestandsmerkmals „im Zusammenhang mit dem Verkauf eines Produkts oder einer Dienstleistung“ des Art. 13 Abs. 2 ePrivacy-RL ergeben.
Die vorliegende Konstellation ist bereits deswegen nicht mit dem typischen Anwendungsfall einer Bestandskundenansprache per Newsletter im Online-Handel zu vergleichen, weil es hier gar nicht zu einem „echten“ Verkauf gekommen war.
Genutzt wurde lediglich die Möglichkeit der kostenfreien Eröffnung eines Nutzerkontos. Eine kostenpflichtige Bestellung ist hier nicht erfolgt und eine Vergütung ist gerade nicht geflossen.
Im Online-Handel geht es dagegen in erster Linie darum, Kunden, die bereits einmal im Shop eingekauft haben (aber keinen Newsletter aktiv abonniert haben) künftig per Newsletter legal ansprechen und zu einem weiteren Kauf bewegen zu können.
Der EuGH stellt dahingehend fest, dass der Begriff „Verkauf“ grundsätzlich eine Vergütung voraussetze. Diese könne jedoch auch indirekt erfolgen.
Dies sei etwa dann anzunehmen, wenn unentgeltliche Leistungen zu Werbezwecken (etwa als Einstiegs- bzw. Lockangebot) erbracht werden und die hierfür beim Anbieter anfalllenden Kosten dann im Preis kostenpflichtiger Angebote enthalten sind.
Genau das sei vorliegend der Fall. Denn die Möglichkeit der Anlage des kostenfreien Nutzerkontos mit dem Newsletterempfang sei (nicht zuletzt durch die beschränkte Abrufbarkeit kostenloser Artikel bzw. Informationen) darauf angelegt, den Abschluss des kostenpflichtigen „Premium-Dienstes“ des Medienanbieters zu fördern.
Es liegt damit eine indirekte Vergütung vor.
Der EuGH kommt deshalb zu dem Ergebnis, dass der Medien-Anbieter die Email-Adresse des Empfängers hier im Zusammenhang mit dem Verkauf einer Dienstleistung erlangt habe, und das entsprechende Tatbestandsmerkmal des Art. 13 Abs. 2 ePrivacy-RL mithin erfüllt sei.
Daran ändere auch nichts, dass die Vorschrift des Art. 13 Abs. 2 ePrivacy-RL gerade als Ausnahme zur „Grundregel“ des Art. 13 Abs. 1 ePrivacy-RL fungiere und daher schon systematisch eng auszulegen sei.
Die Auslegung dürfe nicht so eng erfolgen, dass die praktische Wirksamkeit der Ausnahmevorschrift beeinträchtigt werde.
Insbesondere sei dem Wortlaut des Art. 13 Abs. 2 ePrivacy-RL nach nicht ausgeschlossen, dass die (notwendige) Vergütung von einer anderen Person als dem Newsletter-Empfänger geleistet wird.
Ziel der Ausnahmevorschrift sei es, eine Sonderregelung für bestehende Kundenbeziehungen zu schaffen. Für eine solche Kundenbeziehung reichte dem EuGH hier die Anlage eines kostenfreien Benutzerkontos aus.
Erstens bezeichnet zum einen der Begriff „Verkauf“, wie der Generalanwalt in Nr. 40 seiner Schlussanträge ausgeführt hat, nach einer allgemein anerkannten Definition eine Vereinbarung, die notwendigerweise die Zahlung eines Entgelts für eine Ware oder einen Dienst mit sich bringt. Dieser Begriff kann daher nur Vorgänge erfassen, die die Zahlung einer Vergütung voraussetzen.
Zum anderen ist festzustellen, dass sich Art. 13 Abs. 2 der Richtlinie 2002/58 allgemein auf „Dienstleistung[en]“ bezieht, ohne nach der Art der betreffenden Erbringung zu unterscheiden. Zu den in den Anwendungsbereich der Richtlinie 2000/31 fallenden Dienstleistungen hat der Gerichtshof entschieden, dass die Vergütung für einen Dienst, den ein Anbieter im Rahmen seiner wirtschaftlichen Tätigkeit erbringt, nicht notwendig von denjenigen bezahlt wird, denen sie zugutekommt. Das ist insbesondere dann der Fall, wenn eine unentgeltliche Leistung von einem Anbieter zu Werbezwecken für von ihm verkaufte Güter oder angebotene Dienstleistungen erbracht wird, da die Kosten dieser Tätigkeit dann in den Verkaufspreis dieser Güter oder Dienstleistungen einbezogen werden (Urteil vom 15. September 2016, Mc Fadden, C 484/14, EU:C:2016:689, Rn. 41 und 42 sowie die dort angeführte Rechtsprechung). Diese Erwägungen lassen sich auf die Auslegung von Art. 13 Abs. 2 der Richtlinie 2002/58 übertragen.
Dabei ist genau dies hier der Fall. Wie aus dem Wortlaut der ersten Frage und der Begründung der Vorlageentscheidung hervorgeht, erhielt Inteligo Media nämlich die elektronischen Kontaktinformationen der betreffenden Nutzer, als diese ein kostenloses Konto auf der von diesem Unternehmen betriebenen Online-Plattform einrichteten, was voraussetzte, dass diese Nutzer die Vertragsbedingungen für die Bereitstellung des „Premium-Dienstes“ akzeptierten. Mit dem Abonnieren dieses Dienstes erhielten diese Nutzer das Recht auf kostenlosen Zugang zu einer gewissen Anzahl von Artikeln, die in dem betreffenden Medium erschienen, und auf Erhalt des Newsletters „Personal Update“. Wie sich aus Rn. 45 des vorliegenden Urteils ergibt, dient die Erbringung einer solchen Dienstleistung vor allem einem Werbezweck, der darin besteht, den von Inteligo Media bereitgestellten kostenpflichtigen Inhalt anzupreisen, wobei die Kosten dieser Dienstleistung in den Preis dieses Inhalts einbezogen werden.
Unter diesen Umständen ist in Übereinstimmung mit den Ausführungen des Generalanwalts in Nr. 43 seiner Schlussanträge festzustellen, dass eine indirekte Vergütung wie die im Ausgangsverfahren in Rede stehende, die in den Verkaufspreis des von diesem Dienstleister angebotenen vollständigen Abonnements einbezogen wird, das in Rn. 53 des vorliegenden Urteils genannte Erfordernis der Zahlung eines Entgelts erfüllt.
Folglich kann ein Vorgang wie jener, in Zusammenhang mit dem Inteligo Media die elektronischen Kontaktinformationen der Nutzer erhalten hat, unter den Begriff „Verkauf … einer Dienstleistung“ im Sinne von Art. 13 Abs. 2 der Richtlinie 2002/58 fallen.
Zweitens steht diese Auslegung im Einklang mit dem Zusammenhang, in dem dieser Begriff verwendet wird, und den Zielen, die mit der Regelung, zu der er gehört, verfolgt werden.Insoweit trifft es zwar zu, dass Art. 13 Abs. 2 der Richtlinie 2002/58 eine Ausnahme von der in Art. 13 Abs. 1 aufgestellten Grundregel vorsieht und daher eng auszulegen ist. Allerdings schließt erstens der Wortlaut von Art. 13 Abs. 2 nicht die Möglichkeit aus, dass die Vergütung, die für einen „Verkauf“ im Sinne dieser letzteren Bestimmung verlangt wird, von einer anderen Person als dem Empfänger des Produkts oder der Dienstleistung, die Gegenstand dieser Transaktion ist, gezahlt wird. Vielmehr ergibt sich aus diesem Wortlaut, dass der Unionsgesetzgeber nur vorgeschrieben hat, dass die elektronischen Kontaktinformationen der betreffenden Nutzer „im Zusammenhang mit dem Verkauf eines Produkts oder einer Dienstleistung“ erlangt worden sein müssen.
Zweitens muss die Auslegung des Wortlauts von Art. 13 Abs. 2 der Richtlinie 2002/58 in jedem Fall mit dem mit dieser Bestimmung verfolgten Ziel im Einklang stehen. Daher darf die Notwendigkeit einer solchen engen Auslegung nicht so verstanden werden, dass sie eine Auslegung dieser Begriffe erlaubt, die ihnen ihre praktische Wirksamkeit nähme (vgl. entsprechend Urteil vom 4. März 2021, Frenetikexito, C 581/19, EU:C:2021:167, Rn. 22 und die dort angeführte Rechtsprechung).
Was das mit Art. 13 Abs. 2 der Richtlinie 2002/58 verfolgte Ziel betrifft, geht aus dem 41. Erwägungsgrund dieser Richtlinie hervor, dass der Unionsgesetzgeber eine Ausnahme vom in Art. 13 Abs. 1 der Richtlinie aufgestellten Grundsatz vorsehen wollte, wenn die elektronischen Kontaktinformationen der betreffenden Nutzer „[i]m Rahmen einer bestehenden Kundenbeziehung“ erlangt wurden, ohne diese Beziehung näher zu beschreiben.
Folglich zeigt sich – vorbehaltlich der vom vorlegenden Gericht vorzunehmenden Prüfungen –, dass im vorliegenden Fall sowohl die Voraussetzung erfüllt ist, dass die elektronischen Kontaktinformationen der betreffenden Nutzer „im Zusammenhang mit dem Verkauf eines Produkts oder einer Dienstleistung“ erlangt wurden, als auch, wie sich aus den Rn. 55 und 56 des vorliegenden Urteils ergibt, die Voraussetzung, dass die Dienstleistung, um die es in der fraglichen Werbung geht, ähnlich ist.
Nach alledem ist auf die Frage 1 und die Frage 4 Buchst. a zu antworten, dass Art. 13 Abs. 1 und 2 der Richtlinie 2002/58 dahin auszulegen ist, dass die E Mail-Adresse eines Nutzers vom Herausgeber eines Onlinemediums „im Zusammenhang mit dem Verkauf eines Produkts oder einer Dienstleistung“ im Sinne von Art. 13 Abs. 2 erhalten worden ist, wenn dieser Nutzer ein kostenloses Konto auf seiner Online-Plattform einrichtet, das ihm das Recht gibt, kostenlos auf eine bestimmte Anzahl von Artikeln dieses Mediums zuzugreifen, kostenlos per E Mail einen täglichen Newsletter zu erhalten, der eine Zusammenfassung der in Artikeln dieses Mediums behandelten gesetzgeberischen Neuerungen einschließlich Hyperlinks zu diesen Artikeln enthält, und gegen Bezahlung auf zusätzliche Artikel und Analysen dieses Mediums zuzugreifen. Die Übermittlung eines solchen Newsletters stellt eine Verwendung elektronischer Post „zur Direktwerbung“ für „ähnliche Produkte oder Dienstleistungen“ im Sinne von Art. 13 Abs. 2 dar.
Nachdem mit dem angegriffenen Newsletter hier auch ähnliche Produkte bzw. Dienstleistungen beworben wurden, sah der EuGH die Voraussetzungen des Art. 13 Abs. 2 ePrivacy-RL als erfüllt an.
Mit anderen Worten: Es durfte hier (ausnahmsweise) der Newsletter ohne vorherige Einwilligung rechtmäßig versendet werden.
Der EuGH hat hier also gerade nicht festgestellt, dass nun Newsletter (immer) auch ohne vorherige Einwilligung versendet werden dürfen.
Vielmehr hat der EuGH nur festgestellt, dass (auch in dieser besonderen Situation der „kostenlosen Mitgliedschaft“) „ausnahmsweise“ die (strenge) Ausnahmevorschrift für die Zulässigkeit des einwilligungslosen Newsletterversands erfüllt ist.
Vorrang von Art. 13 Abs. 2 ePrivacy-RL gegenüber Art. 6 Abs. 1 DSGVO
Schließlich kam der EuGH zu dem Schluss, dass es bei Vorliegen der (Ausnahme)Voraussetzungen des Art. 13 Abs. 2 ePrivacy-RL für die Rechtmäßigkeit des Newsletterversandes dann nicht mehr auf das Vorliegen der Rechtfertigungsvoraussetzungen nach Art. 6 Abs. 1 DSGVO ankomme.
Denn Art. 95 DSGVO bestimme, dass für Verarbeitungsvorgänge, die den besonderen Pflichten der ePrivacy-RL unterliegen, keine zusätzlichen Pflichten nach der DSGVO bestehen.
Im konkreten Fall beurteile sich die Rechtmäßigkeit der Datenverarbeitung im Zusammenhang mit dem versendeten Newsletter allein nach Art. 13 Abs. 2 ePrivacy-RL. Auf die Anforderungen des Art. 6 Abs. 1 DSGVO komme es nicht mehr an, da die DSGVO hinter Art. 13 Abs. 2 ePrivacy-RL als lex specialis zurücktrete und damit nicht anwendbar sei.
Der Newsletterversand hat quasi einen „Doppelcharakter“:
Einmal wettbewerbsrechtlich bzw. individualrechtlich, und einmal datenschutzrechtlich.
Wer in unzulässiger Weise einen Email-Newsletter versendet, der kann daher in vielfacher Hinsicht „Ärger“ bekommen.
Auf der einen Seite kann er deswegen wettbewerbsrechtlich in Anspruch genommen werden (etwa, wenn er einen Mitbewerber „zuspammt“ bzw. der Mitbewerber mitbekommt, dass der Werbende Interessenten oder Kunden unerlaubt anschreibt).
Bei Fehlen eines Wettbewerbsverhältnisses (etwa, wenn branchenfremd „gespammt“ wird), kann der Empfänger wegen der Verletzung des Rechts am eingerichteten und ausgebübten Gewerbebetrieb (wenn Empfänger geschäftlich betroffen) bzw. wegen Verletzung des allgemeinen Persönlichkeitsrechts (wenn Empfänger als Privatperson betroffen) gegen den „Spam“ vorgehen, z.B. mit einer Abmahnung und der Forderung von Unterlassung und Schadensersatz.
Auf der anderen Seite stellen die Email-Adresse des Empfängers sowie mögliche Inhalte des Newsletters (wie der Name oder die Anschrift) personenbezogene Daten des Empfängers dar, die von der DSGVO geschützt werden und deren Verarbeitung grundsätzlich einer Rechtfertigung nach der DSGVO bedarf. Dies bedeutet, dass bei nicht gerechtfertigter Verarbeitung solcher Daten im Zuge des Newsletterversandes auch die Datenschutzbehörde ins Spiel kommen kann (was schon der aktuelle Fall zeigt).
Der EuGH hat nun aber klargestellt, dass es bei Erfüllung der Ausnahmeregel des Art. 13 Abs. 2 ePrivacy-RL (in Deutschland damit der Ausnahmeregel des § 7 Abs. 3 UWG) dann aber nicht mehr auf eine datenschutzrechtliche Rechtfertigung ankommt (sondern § 7 Abs. 3 UWG dem Art. 6 Abs. 1 DSGVO vorgeht).
Dass der EuGH die Anwendbarkeit der DSGVO hier verneint hat, bedeutet insbesondere nicht, dass der Newsletterversand generell ohne Einwilligung zulässig wäre.
Der EuGH führte zu dieser Fragestellung aus:
Mit seiner Frage 2 möchte das vorlegende Gericht im Wesentlichen wissen, ob Art. 13 Abs. 2 der Richtlinie 2002/58 in Verbindung mit Art. 95 DSGVO dahin auszulegen ist, dass die in Art. 6 Abs. 1 DSGVO vorgesehenen Voraussetzungen für die Rechtmäßigkeit der Verarbeitung gelten, wenn der Verantwortliche die E Mail-Adresse eines Nutzers verwendet, um ihm eine unerbetene Nachricht gemäß diesem Art. 13 Abs. 2 zu senden.
Wie der Gerichtshof wiederholt entschieden hat, enthält Art. 6 Abs. 1 Unterabs. 1 DSGVO eine erschöpfende und abschließende Liste der Fälle, in denen eine Verarbeitung personenbezogener Daten als rechtmäßig angesehen werden kann. Daher muss eine Verarbeitung unter einen der in dieser Bestimmung vorgesehenen Fälle subsumierbar sein, um als rechtmäßig angesehen werden zu können (Urteile vom 22. Juni 2021, Latvijas Republikas Saeima [Strafpunkte], C 439/19, EU:C:2021:504, Rn. 99, sowie vom 9. Januar 2025, Mousse, C 394/23, EU:C:2025:2, Rn. 25 und die dort angeführte Rechtsprechung).
Allerdings erlegt die DSGVO nach den ausdrücklichen Bestimmungen ihres Art. 95 natürlichen oder juristischen Personen in Bezug auf die Verarbeitung in Verbindung mit der Bereitstellung öffentlich zugänglicher elektronischer Kommunikationsdienste in öffentlichen Kommunikationsnetzen in der Union keine zusätzlichen Pflichten auf, soweit sie besonderen in der Richtlinie 2002/58 festgelegten Pflichten unterliegen, die dasselbe Ziel verfolgen.
Im Übrigen stellt der 173. Erwägungsgrund dieser Verordnung entsprechend klar, dass sie auf alle Fragen des Schutzes der Grundrechte und Grundfreiheiten bei der Verarbeitung personenbezogener Daten Anwendung finden sollte, die nicht den in der Richtlinie 2002/58 bestimmten Pflichten, die dasselbe Ziel verfolgen, unterliegen, einschließlich der Pflichten des Verantwortlichen und der Rechte natürlicher Personen.
Wie aber der Generalanwalt in Nr. 50 seiner Schlussanträge ausgeführt hat, regelt Art. 13 Abs. 2 der Richtlinie 2002/58 die Voraussetzungen und die Zwecke der Verarbeitung sowie die Rechte der betroffenen Person abschließend und erlegt dem Verantwortlichen insoweit „besondere Pflichten“ im Sinne von Art. 95 DSGVO auf. Folglich kann die Rechtmäßigkeit einer Verarbeitung personenbezogener Daten im Rahmen einer in den Anwendungsbereich von Art. 13 Abs. 2 der Richtlinie 2002/58 fallenden Nachricht auf der Grundlage dieser Bestimmung festgestellt werden, ohne dass sie anhand der in Art. 6 Abs. 1 Buchst. a bis f DSGVO vorgesehenen Voraussetzungen geprüft zu werden braucht.
Nach alledem ist auf die Frage 2 zu antworten, dass Art. 13 Abs. 2 der Richtlinie 2002/58 in Verbindung mit Art. 95 DSGVO dahin auszulegen ist, dass die in Art. 6 Abs. 1 DSGVO vorgesehenen Voraussetzungen für die Rechtmäßigkeit der Verarbeitung nicht gelten, wenn der Verantwortliche die E Mail-Adresse eines Nutzers verwendet, um ihm eine unerbetene Nachricht gemäß diesem Art. 13 Abs. 2 zu senden.
Fazit
Wenn diverse Medien aktuell feierlich darüber berichten, dass dank des EuGH nun (erstmals) ein Newsletterversand ohne Einwilligung zulässig sein soll, ist dies schlicht falsch. Und zwar aus zweierlei Hinsicht:
- Zum einen bestand diese (rechtlich nur in sehr engen Grenzen zulässige) Möglichkeit ja längst (siehe Ausnahme des § 7 Abs. 3 UWG) .
- Zum anderen bleibt es auch nach der Entscheidung des EuGH dabei, dass der (rechtlich zulässige) Newsletterversand ohne Einwilligung nach wie vor eine absolute Ausnahmekonstellation darstellt, die an die Einhaltung strenger Ausnahmekriterien geknüpft ist und einen einwilligungslosen Newsletterversand an Bestandskunden nach wie vor keineswegs „per se“ zulässig macht.
In rechtlicher Hinsicht findet sich daher wenig Neues in der Entscheidung des EuGH.
Weder entfällt nach Ansicht des EuGH generell das grundsätzlich zu beachtende Einwilligungserfordernis beim Newsletter, noch hat ein Paradigmenwechsel im Bereich des (auch weiterhin nur in seltenen Ausnahmefällen) zulässigen Newsletterversandes an Bestandskunden ohne Einwilligung stattgefunden, noch gibt es in diesem Bereich nun spürbare Erleichterungen für den Werbenden.
Vielmehr beschränkt sich die neuen rechtlichen Erkenntnisse aus Entscheidung des EuGH im Wesentlichen darauf, den (generell sehr engen) Anwendungsbereich des § 7 Abs. 3 UWG (etwas) zu erweitern.
Insbesondere dahingehend, das für den einwilligungslosen Newsletterversand erforderliche Tatbestandsmerkmal des Verkaufs weiter als bisher zu verstehen (auch für an sich kostenlose Leistungen, die von anderen bzw. einer damit beworbenen kostenpflichtigen Leistungen „querfinanziert“ werden).
Die Feststellung des EuGH, dass ein "Verkauf", in dessen Rahmen die Email-Adresse des Newsletter-Empfängers angegeben worden sein muss, nicht zwingend die Leistung einer direkten Vergütung durch den Empfänger voraussetzt, wird typischerweise Anbietern von Dienstleistungen den einwiligungslosen Versand von Newslettern an Bestandskunden erleichtern, da nunmehr als Bestandskunde auch gelten kann, wer gar nicht für die erhaltene Leistung selbst bezahlt hat.
Diese Erkenntnis des EuGH ist zumindest aus deutscher Sicht aber keineswegs „neu“. Ganz ähnlich hatte bereits das OLG München im Jahre 2018 entschieden.
Zudem stellt der EuGH klar, dass für den einwilligungslosen Newsletterversand an Bestandskunden die Vorschrift des Art. 13 Abs. 2 ePrivacyRL (in Deutschland umgesetzt durch § 7 Abs. 3 UWG) lex specialis zu Art. 6 Abs. 1 DSGVO ist, es also keiner (zusätzlichen) datenschutzrechtlichen Einwilligung mehr für den Newsletterversand bedarf (eine Ansicht, die in Deutschland ebenfalls nicht neu ist).
Der EuGH hat damit – aus deutscher Sicht – lediglich bestätigt, dass die speziellere Regelung des § 7 Abs. 3 UWG Vorrang zur allgemeineren Regelung des Art. 6 DSGVO genießt.
Das Wichtigste in Kürze:
Im Ergebnis ändert sich rechtlich für Werbende daher durch die Entscheidung des EuGH kaum etwas:
- Wer rechtssicher Newsletter per Email versenden möchte, benötigt dafür weiterhin grundsätzlich die vorherige, ausdrückliche und freiwillige Einwilligung des Empfängers (und muss diese im Streitfall später auch nachweisen können).
- Nur ganz ausnahmsweise ist eine Einwilligung bei einem bestehenden „Kundenverhältnis“ in den strengen Grenzen der Vorgaben des § 7 Abs. 3 UWG entbehrlich. Dies betrifft in erster Linie den Newsletterversand an Bestandskunden, wenn dabei ausschließlich ähnliche Waren bzw. Dienstleistungen beworben werden.
- Bitte missverstehen Sie die Vorschrift des § 7 Abs. 3 UWG nicht dahingehend, dass an Bestandskunden generell Newsletter ohne Einwilligung versendet werden dürften. Dies trifft gerade nicht zu. Vielmehr sind dafür die (sehr strengen) Kriterien des § 7 Abs. 3 UWG kumulativ einzuhalten, an denen es in der Praxis meist scheitert – mit ärgerlichen Konsequenzen für den Werbenden.
- Die weite Auslegung des Begriffs "Verkauf" (in dessen Rahmen die Email-Adresse erlangt sein muss) durch den EuGH hat für Newsletter ohne Einwilligung im Online-Handel eher nur geringe Bedeutung, da hier ja in der Regel bereits ein "echter" Verkauf erfolgt ist. Diese "Neuerung" durch die Entscheidung des EuGH dürfte sich in erster Linie Dienstleistern zu Gute kommen, die auf ihrer Webseite eine kostenlose Einstiegsleistung anbieten, bei deren Inanspruchnahme es zur Angabe der Email-Adresse kommt.
- Sie fühlen sich unsicher im „Dschungel“ der rechtlichen Vorgaben für Webseitenbetreiber und Online-Händler? Kein Problem, dafür gibt es die Schutzpakete der IT-Recht Kanzlei. Wir nehmen Sie an die Hand und sichern Ihren Onlineauftritt ab!
Das Urteil des EuGH ist damit alles andere als die vielfach behauptete Revolution des Newsletter-Marketings. Vielmehr beschränkt sich die rechtliche Ausbeute auf klarstellende Elemente.
Profitieren dürften von der Entscheidung des EuGH in erster Linie Anbieter kostenloser Dienste, die als „Vorstufe“ zu ebenfalls angebotenen, kostenpflichtigen Premium-Diensten anzusehen sind.
Hier wird sich die „Bestandskundeneigenschaft“ und damit die grundsätzliche Anwendbarkeit der Ausnahmevorschrift des § 7 Abs. 3 UWG nun problemlos bejahen lassen, obwohl es noch gar nicht zu einem „Verkauf“ nach klassischem Verständnis gekommen ist.
Achtung: Natürlich müssen dann – wie immer – auch noch die weiteren Voraussetzungen des § 7 Abs. 3 UGW erfüllt sein, soll der „Bestandskunde“ rechtssicher per Newsletter angeschrieben werden, ohne dass er in den Erhalt von Email-Werbung zuvor eingewilligt hat.
Die Rechtsprechung des EuGH lässt insbesondere das Grundgefüge der Newsletter-Zulässigkeit nach § 7 Abs. 2 Nr. 2 und Abs. 3 UWG unberührt und stärkt lediglich etwas die Möglichkeit der Bewerbung von Bestandskunden, indem der Anwendungsbereich eines „Verkaufs“ erweitert wird.
Es sind also nur Nuancen der Zulässigkeit des Newsletterversandes, die sich durch den EuGH ändern.
Im Grundsatz bleibt also alles wie bisher. Die Revolution des Newsletter-Marketings ist also (aus Händlersicht: leider) ausgefallen.
Fragen zum Beitrag? Diskutieren Sie hierzu gerne mit uns in der Unternehmergruppe der IT-Recht Kanzlei auf Facebook.
Link kopieren
Als PDF exportieren
Per E-Mail verschicken
Zum Facebook-Account der Kanzlei
Zum Instagram-Account der Kanzlei

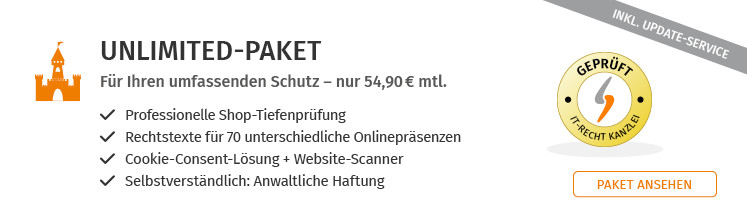




0 Kommentare