Gott sei Dank?! Zur Eintragungsfähigkeit der Marke "Gottesrache"

Die erste Hürde, die ein Zeichen zu überwinden hat, um ins Register eingetragen zu werden, ist die Prüfung der Eintragungsfähigkeit durch das Deutsche Patent- und Markenamt (DPMA). Das Amt prüft dabei sowohl die generelle Markenfähigkeit des Namens oder Zeichens, sowie die so genannten absoluten Schutzhindernisse. Ein absolutes Schutzhindernis stellt dabei auch ein Verstoß gegen die guten Sitten im Sinne von § 8 Abs. 2 Nr. 5 MarkenG dar. Das Bundespatentgericht hat in seinem Beschluss vom 27. Mai 2014 (Az.: 27 W (pat) 565/13) seine Rechtsprechung dazu exemplarisch an der Bezeichnung „GOTTESRACHE“ erläutert und bestätigt.
Inhaltsverzeichnis
I. Das Problem
Dass man die Marke am Besten eintragen lässt, um den eigenen Marktwert dauerhaft zu schützen, ist mittlerweile bekannt. Dies gilt auch bezüglich der Folge einer Anmeldung, nämlich, dass dem Markeninhaber ein ausschließliches Recht an der Verwendung des Zeichens zusteht und Dritte diese nicht einfach schamlos kopieren dürfen.
Eine Eintragung erfolgt durch Antrag bei dem Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA). Was genau das DPMA nach Eingang dieses Antrags prüft, ist hingegen nicht jedem geläufig. So prüft das DPMA im Eintragungsverfahren die Eintragungsfähigkeit der Marke. Darunter fällt die generelle Markenfähigkeit des Namens oder Zeichens und die so genannten absoluten Schutzhindernisse. Ist die Eintragungsfähigkeit nicht gegeben, führt dies zur Ablehnung der Markenanmeldung durch das Amt. Es kommt somit gar nicht erst zur Eintragung.
Wichtig ist, dass das DPMA gerade nicht die relativen Schutzhindernisse prüft, d.h. ob bereits ein identisches oder ähnliches Markenzeichen existiert und es deshalb durch die neue Eintragung zu einer markenrechtlichen Kollision kommen könnte.
Das DPMA nimmt eine Markeneintragung also nur dann vor, wenn keine absoluten Schutzhindernisse im Sinne des § 8 MarkenG entgegenstehen. Regelungszweck des § 8 MarkenG ist es, bestimmte Kennzeichen im öffentlichen Interesse von der Eintragung auszuschließen.
Besonders praxisrelevant ist in diesem Zusammenhang vor allem die mangelnde Unterscheidungskraft gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG.
Danach sind Marken von der Eintragung ausgeschlossen, denen jegliche Unterscheidungskraft fehlt. Auf Grund der Hauptfunktion der Marke als betrieblicher Herkunftshinweis, kommt einem Zeichen Unterscheidungskraft zu, wenn es geeignet ist, die Ware für die Eintragung beantragt wird, als von einem bestimmten Unternehmen stammend zu kennzeichnen und diese Ware somit von denjenigen anderer Unternehmen zu unterscheiden. Grundsätzlich gilt bei Wortmarken, dass diese keinen für die relevanten Waren oder Dienstleistungen lediglich beschreibenden Begriffsinhalt aufweisen dürfen. Ferner sollte es sich bei der Wortmarke nicht um ein gebräuchliches Wort der deutschen oder einer bekannten Fremdsprache handeln.
Das DPMA prüft aber auch, ob der Eintragung ein Freihaltebedürfnis nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG entgegensteht. Ein Freihaltebedürfnis besteht dann, wenn für die angemeldeten Waren/Dienstleistungen konkrete Interessen der Allgemeinheit daran bestehen, dass die Angaben für die betreffende Warengruppe nicht exklusiv von einem Marktteilnehmer allein, sondern allgemein genutzt werden können. Zweck der berechtigten Freihaltung ist dabei, den Mitbewerbern die freie Wahl zwischen allen unmittelbar beschreibenden Angaben und Zeichen zu erhalten. Dabei kann das Freihaltebedürfnis entweder gegenwärtig schon bestehen oder es kann zu erwarten sein, dass es in Zukunft entstehen könnte.
Keineswegs zu vernachlässigen ist darüber hinaus die Vorschrift des § 8 Abs. 2 Nr. 5 MarkenG, wonach auch der Verstoß gegen die öffentliche Ordnung oder gegen die guten Sitten zu einem Eintragungshindernis führt. Ein Verstoß gegen die guten Sitten kann beispielsweise bei obszönen Marken, grob sexuellen Motiven oder einer anderer Verletzung des Schamgefühls vorliegen. Auch die Verletzung religiöser Gefühle, insbesondere wenn es sich um Hinweise auf Gott oder die Verwendung religiöser Begriffe handelt, kommt als Verstoß gegen die guten Sitten in Betracht.
Eine derartige Konstellation hatte das Bundespatentgericht erst kürzlich zu entscheiden (Az.: 27 W (pat) 565/13). Dabei ging es um die Beschwerde gegen den Beschluss der Markenstelle, in welcher die Eintragung des Wortes „GOTTESRACHE“ mit der Begründung abgelehnt wurde, dass die Wortmarke gegen die guten Sitten verstoße.
II. Die Entscheidung
Die Richter des Bundespatentgerichts gaben dem Beschwerdeführer Recht und entschieden, dass die dass ein Schutzhindernis nicht bestehe, da die Marke „Gottesrache“ nicht gegen die guten Sitten gem. § 8 Abs. 2 Nr. 5 MarkenG verstößt.
Gegen die guten Sitten verstoßen Marken nach Rechtsprechung des Bundesgerichtshofes dann, wenn sie geeignet sind das Empfinden eines beachtlichen Teils der beteiligten Verkehrskreise zu verletzen. Dies kann dadurch bewirkt werden, dass die Marke sittlich, politisch oder religiös anstößig wirkt oder eine grobe Geschmacksverletzung enthält. Maßgeblich ist hierbei die Auffassung des angesprochenen Publikums in seiner Gesamtheit, wobei weder eine übertrieben laxe noch eine besonders feinfühlige Meinung des durchschnittlich informierten, aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbrauchers erforderlich ist.
"Die sittlich religiöse Anstößigkeit oder grobe Geschmacklosigkeit ist stets im Hinblick auf die betroffenen Waren zu beurteilen. Dabei darf nicht unberücksichtigt bleiben, dass die maßgebliche
Verkehrsauffassung von der fortschreitenden Liberalisierung der Anschauungen über Sitte und Moral geprägt ist. Soweit allerdings das religiöse Empfinden eines wesentlichen Teils des Verkehrs durch religionsbezogene Angaben unerträglich verletzt wird, ist auch weiterhin von der Schutzunfähigkeit der Marke auszugehen."
Bezüglich der Wortmarke „Gottesrache“ ist das Gericht der Ansicht, dass diese eventuell den Anforderungen des guten Geschmacks nicht genügt, dieser Umstand aber für sich betrachtet keine Schutzversagung gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 5 MarkenG rechtfertige, da eine ästhetische Prüfung auf die Anforderungen des guten Geschmacks nicht Gegenstand des markenrechtlichen Eintragungsverfahrens sein könne.
Mit Hinblick auf die Liberalisierung der Anschauungen über Sitte und Moral in der Bevölkerung, verletzte die angemeldete Marke gerade nicht deren Sittlichkeits- und Glaubensempfinden in völlig unerträglicher Art und Weise. Ein unerträglicher Verstoß gegen das sittliche Empfinden, so das Urteil der Richter, sei dann anzunehmen, wenn die angemeldete Marke über eine bloße Geschmacklosigkeit hinaus religiöse Aussagen enthalte, die massiv diskriminierend und/oder die Religionsfreiheit beeinträchtigend seien bzw. ernsthaft so verstanden werden können.
"Davon kann bei dem Wort „GOTTESRACHE”, das in seinem Aussagegehalt glaubensneutral und nicht einseitig herabwürdigend ist, auch angesichts der Tendenz zur Lockerung religiöser Bindungen nicht ausgegangen werden. Aus Religion stammende Begriffe wie Himmel, Hölle, Gott, Heilig sind sowohl in positiv wie negativ anmutenden Zusammenhängen und Kombinationen allgegenwärtig im Werbe-, Medien- und Sprachgebrauch, so dass für die auch durch die Markenstelle nicht überzeugend belegte Annahme, ein beachtlicher Teil des angesprochenen Publikums würde an GOTTESRACHE religiösen Anstoß nehmen, kein Raum ist."
III. Unser Fazit
De Frage der Sittenwidrigkeit ist also immer im Hinblick auf den Einzelfall zu entscheiden und wurde dementsprechend von der Rechtsprechung häufig sehr unterschiedlich beurteilt.
Zur Veranschaulichung, wie konträr diese Bewertung ausfallen kann, hier ein extremes Beispiel:
Bezüglich der Wortmarke „Ficken“ hat der 26. Senat des Bundespatentgerichts (Az.: 26 W (pat) 116/10) mit Hinweis auf die fortschreitende Liberalisierung entschieden, dass kein unerträglicher Verstoß gegen das sittliche Empfinden der Allgemeinheit vorliege. Nach Ansicht des Gerichts sei die derbe Bezeichnung für den Vollzug des Geschlechtsverkehrs in ihrem Aussagegehalt geschlechtsneutral und damit nicht einseitig herabsetzend. Im Übrigen werde der Ausdruck mittlerweile in verschiedensten gesellschaftlichen Schichten und Altersklassen verwendet.
Anderer Ansicht war der 27. Senat des Bundespatentgerichts bezüglich des Zeichens „Ready to Faak!“ ( Az.: 27 W (pat) 138/10). Hier stellten die Richter fest, dass der vulgäre Ausdruck „Fuck“ für die Ausübung von Geschlechtsverkehr in Verbindung mit „ready to“ (bereit für) sittlichen Anstoß errege. Daran ändere, so das Gericht, auch dessen zahlreiche Verwendung in Filmen, in der Literatur und in den Medien nichts, da die Verwendung von Vulgärsprache nichts mit Liberalisierung zu tun habe.
Fragen zum Beitrag? Diskutieren Sie hierzu gerne mit uns in der Unternehmergruppe der IT-Recht Kanzlei auf Facebook.
Link kopieren
Als PDF exportieren
Per E-Mail verschicken
Zum Facebook-Account der Kanzlei
Zum Instagram-Account der Kanzlei

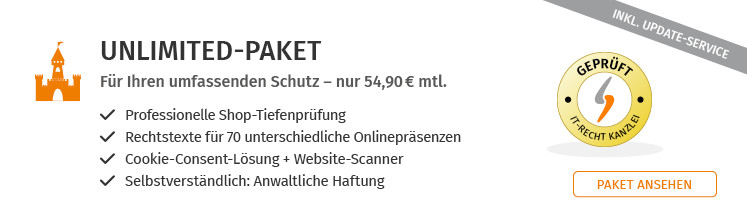





0 Kommentare