Ab 19.06.2026: Der Widerrufsbutton im Online-Handel kommt – was Sie jetzt wissen müssen

Mit dem „Widerrufsbutton“ steht Online-Händlern ab Mitte 2026 eine neue gesetzliche Verpflichtung ins Haus. Diese FAQ sollen als Navigationshilfe dienen, um die rechtlichen Anforderungen zu verstehen, die häufigsten Fallstricke zu vermeiden und die Umsetzung reibungslos zu gestalten.
Inhaltsverzeichnis
- Rechtlicher Hintergrund
- Was genau ist der Widerrufsbutton und warum wird er eingeführt?
- Welche Verträge sind von der neuen Regelung betroffen?
- Welche Ausnahmen von der Widerrufsbutton-Pflicht gibt es?
- Gilt die Pflicht auch für Verträge zur Bereitstellung von digitalen Inhalten?
- Gilt die Pflicht auch für Kleinunternehmer?
- Was gilt, wenn ich sowohl widerrufsfähige als auch nicht widerrufsfähige Produkte anbiete?
- Ab wann ist der Widerrufsbutton für Online-Händler Pflicht?
- Gelten die neuen Regeln auch für Händler, die über Plattformen wie eBay oder Amazon verkaufen?
- Technische Umsetzung
- Wie muss der Widerrufsbutton optisch gestaltet sein?
- Welchen Wortlaut muss der Button haben?
- Muss es zwingend ein „Button“ sein?
- Welcher Prozess muss nach dem Klick auf den Button ablaufen?
- Welche Informationen darf und muss ich vom Kunden abfragen?
- Darf ich den Kunden nach dem Grund für den Widerruf fragen?
- Was muss nach dem Absenden des Widerrufs geschehen?
- Was passiert nach dem erfolgreichen Widerruf mit dem Vertrag und den Zahlungen?
- Muss die Widerrufsfunktion auch für „Gastbesteller“ zugänglich sein?
- Muss die Widerrufsfunktion auch einen Teilwiderruf ermöglichen?
- Durchgehende Verfügbarkeit des Buttons
- Was bedeutet die Anforderung, dass der Button "während der gesamten Widerrufsfrist" verfügbar sein muss?
- Gibt es eine praktikable Lösung für dieses Problem?
- Kann die dauerhafte Verfügbarkeit als "verlängertes" Widerrufsrecht ausgelegt werden?
- Rechtliche Fallstricke – Lehren aus der Praxis des „Kündigungsbuttons“
- Warum ist die Rechtsprechung zum Kündigungsbutton auch relevant für den Widerrufsbutton?
- Darf der Button erst nach einem Login im Kundenkonto bereitgestellt werden?
- Darf der Button in einer Linkliste platziert werden?
- Rechtsfolgen bei Verstößen
- Welche Rechtsfolgen drohen mir, wenn ich den Button nicht oder falsch einbinde?
- Wer haftet bei Online-Marktplätzen für die korrekte Umsetzung?
- Handlungsempfehlungen – So bereiten Sie sich rechtzeitig vor
- Was sind die wichtigsten Maßnahmen?
- Wann sollte ich mit der technischen Umsetzung beginnen?
- Muss ich meine Widerrufsbelehrung anpassen?
- Muss ich meine Datenschutzerklärung anpassen?
- Kann ich ein Plugin für mein Shopsystem nutzen?
Rechtlicher Hintergrund
Was genau ist der Widerrufsbutton und warum wird er eingeführt?
Der Widerrufsbutton ist eine neue, gesetzlich vorgeschriebene elektronische Funktion, die es Verbrauchern erleichtern soll, online geschlossene Verträge zu widerrufen.
Ziel der EU-Gesetzgebung ist es, den Widerruf von Verträgen ebenso einfach zu gestalten, wie der Vertragsschluss selbst erfolgt ist – nämlich mit wenigen Klicks. Die neue Pflicht ergibt sich aus der EU-Richtlinie 2023/2673, die den Verbraucherschutz stärken soll und die Einführung einer europaweit "funktionierenden und leicht zugänglichen" elektronischen Widerrufsmöglichkeit vorsieht.
Der Begriff „Widerrufsbutton“ hat sich in der Praxis bereits durchgesetzt, auch wenn der Gesetzestext von einer „Widerrufsfunktion“ spricht. Es handelt sich dabei um eine zusätzliche Option für den Verbraucher, sein Widerrufsrecht auszuüben, welche die bisherigen Wege, wie den Widerruf per E-Mail oder Brief, ergänzt, aber nicht ersetzt.
Welche Verträge sind von der neuen Regelung betroffen?
Die neue Regelung gilt für Fernabsatzverträge über Waren, Dienstleistungen und Finanzdienstleistungen, die über eine Online-Benutzeroberfläche geschlossen werden. Unter einer Online-Benutzeroberfläche ist eine Software zu verstehen, darunter auch Websites oder Teile davon sowie Anwendungen, einschließlich Mobil-Apps. Verträge, die außerhalb einer Online-Benutzeroberfläche abgeschlossen werden, beispielsweise am Telefon, per E-Mail-Korrespondenz, per Post oder stationär, sind nicht betroffen.
Welche Ausnahmen von der Widerrufsbutton-Pflicht gibt es?
Die Pflicht gilt nur dann, wenn auch ein gesetzliches Widerrufsrecht für den Verbraucher besteht. Für einige Verträge ist das Widerrufsrecht von vornherein ausgeschlossen, sofern die Parteien hierzu nichts anderes vereinbart haben. Dies gilt etwa für folgende Vertragsgegenstände:
- Waren, die nach Kundenspezifikationen angefertigt oder auf die persönlichen Bedürfnisse des Verbrauchers zugeschnitten wurden,
- Waren, die schnell verderben können, wie frische Lebensmittel,
- Versiegelte Waren, die aus Gründen des Gesundheitsschutzes oder der Hygiene nicht zur Rückgabe geeignet sind, wenn das Siegel entfernt wurde,
- Ton- oder Videoaufnahmen oder Computersoftware in versiegelten Verpackungen, wenn diese nach der Lieferung entsiegelt wurden,
- Buchungen für Freizeitaktivitäten, die einen spezifischen Termin oder Zeitraum vorsehen (z. B. Konzertkarten, Flugtickets).
Zudem gilt die Pflicht nicht für B2B-Verträge, an denen Verbraucher nicht beteiligt sind.
Gilt die Pflicht auch für Verträge zur Bereitstellung von digitalen Inhalten?
Die Pflicht zur Bereitstellung eines Widerrufsbuttons gilt auch für online geschlossene Verträge zur Bereitstellung von digitalen Inhalten, sofern für diese ein gesetzliches Widerrufsrecht besteht. Die Regelung betrifft alle Online-Verträge über Waren, Dienstleistungen und eben auch digitale Inhalte/Dienstleistungen (z. B. E-Books, Online-Kurse), sofern ein Widerrufsrecht gegeben ist. Auch insoweit soll der Verbraucher die Möglichkeit haben, den Vertrag ebenso einfach zu widerrufen, wie er ihn geschlossen hat.
Dagegen spricht auch nicht die Tatsache, dass der Unternehmer das Widerrufsrecht unter bestimmten Voraussetzungen vorzeitig zum Erlöschen bringen kann. Denn zum einen müssen diese Voraussetzungen erst einmal vorliegen und zum anderen besteht eine solche Möglichkeit grundsätzlich auch bei Verträgen über Dienstleistungen, die ebenfalls in den Anwendungsbereich der neuen Regelung fallen.
Ist das Widerrufsrecht des Verbrauchers in Bezug auf einen konkreten Vertragsgegenstand (digitalen Inhalt) vorzeitig erloschen, so würde es auch nicht wieder dadurch aufleben, dass der Unternehmer auf seiner Website (weiterhin) einen Widerrufsbutton bereitstellt. Denn hiermit kommt der Unternehmer lediglich seiner gesetzlichen Verpflichtung nach und trifft keine Aussage zum Bestehen eines Widerrufsrechts im konkreten Einzelfall.
Gilt die Pflicht auch für Kleinunternehmer?
Ja, die Pflicht zur Bereitstellung eines Widerrufsbuttons gilt für alle Unternehmen, die mit Verbrauchern Verträge über eine Online-Benutzeroberfläche schließen. Es gibt keine Ausnahmen, die sich auf die Unternehmensgröße, den Umsatz oder die Rechtsform beziehen.
Was gilt, wenn ich sowohl widerrufsfähige als auch nicht widerrufsfähige Produkte anbiete?
Auch in diesem Fall muss der Widerrufsbutton vorgehalten werden. Die Pflicht entfällt nur, wenn ausnahmslos alle Angebote in einem Online-Shop unter die gesetzlichen Ausnahmen fallen. Hierzu muss der Händler die rechtliche Wertung treffen, ob ein Widerrufsrecht besteht, was in der Praxis zu Unsicherheiten führen kann.
Ab wann ist der Widerrufsbutton für Online-Händler Pflicht?
Die betreffende EU-Richtlinie trat am 18.12.2023 in Kraft und sieht eine nationale Umsetzungsfrist bis spätestens 19.12.2025 vor. Für Online-Händler selbst wird die Pflicht zur Bereitstellung des Widerrufsbuttons jedoch erst ab dem 19.06.2026 wirksam.
Gelten die neuen Regeln auch für Händler, die über Plattformen wie eBay oder Amazon verkaufen?
Ja, auch Händler, die ihre Produkte über Online-Marktplätze wie eBay oder Amazon anbieten, sind von der neuen Regelung betroffen. Die Verpflichtung greift, wenn der Vertrag über eine Online-Benutzeroberfläche geschlossen wird. Dies ist in der Regel auch bei Online-Marktplätzen der Fall. Allerdings muss in diesen Fällen nicht der Händler, sondern der Betreiber des Marktplatzes für die technische Umsetzung sorgen, da der Händler hierauf keinen Einfluss hat.
Technische Umsetzung
Wie muss der Widerrufsbutton optisch gestaltet sein?
Der Widerrufsbutton muss hervorgehoben platziert und leicht zugänglich sein. Er sollte gut lesbar und optisch vom restlichen Design der Website abgehoben sein. Sofern die Widerrufsfunktion beispielsweise in der Fußzeile der Online-Benutzeroberfläche angezeigt wird, sind jedenfalls für eine gute Leserlichkeit besondere Maßnahmen wie z.B. die Farbwahl oder Kontraste sowie eine hervorgehobene Platzierung erforderlich, die die Widerrufsfunktion eindeutig von anderen Informationen, wie den AGB, dem Impressum oder Ähnlichem abgrenzt.
Welchen Wortlaut muss der Button haben?
Für die Beschriftung sieht der Gesetzgeber die Worte „Vertrag widerrufen“ oder eine entsprechend eindeutige Formulierung vor. Mehrdeutige Begriffe wie "Stornieren" oder "Serviceanfrage" sollten vermieden werden.
Muss es zwingend ein „Button“ sein?
Nein, der Gesetzestext spricht von einer "Widerrufsfunktion". Zwar wird dies in der Praxis meist als Schaltfläche (Button) umgesetzt, aber auch andere klar erkennbare Lösungen wie ein hervorgehobener Link, der direkt zur Widerrufsfunktion führt, sind zulässig.
Welcher Prozess muss nach dem Klick auf den Button ablaufen?
Der Gesetzgeber schreibt ein zweistufiges Verfahren vor. Der Klick auf den ersten Button („Vertrag widerrufen“) darf den Widerruf nicht sofort auslösen. Stattdessen muss der Verbraucher auf eine separate Seite weitergeleitet werden, auf der er ein Widerrufsformular vorfindet. Die zweite Stufe wird durch einen Bestätigungsbutton ausgelöst, der ebenfalls gut lesbar und ausschließlich mit den Worten „Widerruf bestätigen“ oder einer vergleichbaren eindeutigen Formulierung beschriftet sein muss.
Welche Informationen darf und muss ich vom Kunden abfragen?
Der Gesetzgeber hat klare Vorgaben hinsichtlich der Daten gemacht, die im Widerrufsformular abgefragt werden dürfen. Nach dem Grundsatz der Datensparsamkeit dürfen ausschließlich die folgenden Informationen vom Verbraucher abgefragt werden, um den Widerruf eindeutig dem jeweiligen Vertrag zuordnen zu können:
- der Name des Verbrauchers,
- Angaben zur Identifizierung des Vertrags, den der Verbraucher widerrufen möchte (z. B. Bestellnummer, Auftragsnummer oder Vertragsnummer),
- Angaben zu dem elektronischen Kommunikationsmittel, mit welchem dem Verbraucher die Eingangsbestätigung für den Widerruf übermittelt werden wird (in der Regel per E-Mail).
Aus den Angaben muss nach der Gesetzesbegründung zum deutschen Gesetzentwurf erkennbar hervorgehen, welchen Vertrag oder welchen Vertragsteil der Verbraucher widerrufen möchte. Sofern also mehrere Verträge abgeschlossen worden sind oder von dem Vertrag mehrere Waren oder Dienstleistungen umfasst sind, muss die Angabe des zu widerrufenden Vertrags oder des zu widerrufenden Vertragsteils konkret erfolgen. Dies kann durch eine Auswahl in einer Bestellübersicht – beispielsweise über das Kundenkonto – erfolgen. So kann auch ermöglicht werden, dass nur ein Teil des Vertrags, also einzelne Waren oder Dienstleistungen, widerrufen wird.
Darf ich den Kunden nach dem Grund für den Widerruf fragen?
Die Abfrage eines Grundes für den Widerruf als Pflichtangabe ist nicht zulässig. Das Gesetz sieht ausdrücklich vor, dass Verbraucher "ohne Angaben von Gründen" widerrufen können. Eine Abfrage des Grundes könnte als Versuch gewertet werden, das Widerrufsrecht einzuschränken oder den Verbraucher umzustimmen. Gegen eine zusätzliche Abfrage des Widerrufsgrundes dürfte allerdings nichts einzuwenden sein, wenn es sich hierbei um eine optionale Angabe handelt, die vom Verbraucher nicht gemacht werden muss, um den Widerrufsprozess abzuschließen.
Was muss nach dem Absenden des Widerrufs geschehen?
Sobald der Verbraucher seine Widerrufserklärung über den Bestätigungsbutton abgesendet hat, muss der Händler ihm unverzüglich und auf einem dauerhaften Datenträger eine Eingangsbestätigung übermitteln. Dies geschieht in der Regel in Form einer automatisierten E-Mail, die den Inhalt der Widerrufserklärung sowie das Datum und die genaue Uhrzeit des Eingangs enthält. Der Händler muss die Bestätigung unverzüglich, also ohne schuldhaftes Zögern, versenden.
Bei der Formulierung der Eingangsbestätigung sollte nach der Gesetzesbegründung zum deutschen Gesetzentwurf darauf geachtet werden, dass nicht ungewollt der Eindruck entsteht, die materiell-rechtliche Wirksamkeit des Widerspruchs sei bereits geprüft worden (z.B. durch Formulierungen wie „Ihr Widerruf wird hiermit bestätigt.“ oder ähnliches). Es kann sich anbieten in der Eingangsbestätigung darauf hinzuweisen, dass eine Prüfung der Wirksamkeit und Reichweite der Widerrufserklärung noch aussteht.
Was passiert nach dem erfolgreichen Widerruf mit dem Vertrag und den Zahlungen?
Nach einem erfolgreichen Widerruf muss der Händler den Vertrag rückabwickeln und ggf. bereits erhaltene Zahlungen zurückerstatten. Wurde die Ware bereits geliefert, kann der Unternehmer die Rückerstattung des Kaufpreises verweigern, bis er die Ware erhalten oder der Verbraucher die Rücksendung nachgewiesen hat.
Muss die Widerrufsfunktion auch für „Gastbesteller“ zugänglich sein?
Die Widerrufsfunktion muss auch für nicht registrierte Kunden zugänglich sein. Der Gesetzgeber will sicherstellen, dass auch Gastbesteller ihren Widerruf ebenso leicht vornehmen können, wie sie die Bestellung getätigt haben.
Muss die Widerrufsfunktion auch einen Teilwiderruf ermöglichen?
Das Gesetz sieht die Möglichkeit eines Teilwiderrufs eigentlich nicht vor, da der Verbraucher seine Vertragserklärung grundsätzlich nur insgesamt widerrufen kann. Etwas anderes kann aber für den Fall gelten, dass der Verbraucher neben widerrufsfähigen Waren auch Waren bestellt hat, für die das Widerrufsrecht von Gesetzes wegen ausgeschlossen ist. Außerdem kann es im Einzelfall für beide Parteien von Vorteil sein, wenn der Verbraucher seine Vertragserklärung nicht vollständig widerrufen muss. Daher lassen einige Händler in der Praxis auch Teilwiderrufe zu. Aus dem Erwägungsgrund 37 zur EU-Richtlinie sowie aus der Gesetzesbegründung zum deutschen Gesetzentwurf ergibt sich, dass der Händler dies ggf. auch in der Widerrufsfunktion abbilden muss. Dabei ist allerdings zu berücksichtigen, dass es in der Praxis bei Teilwiderrufen zu Rückabwicklungsproblemen kommen kann, insbesondere im Hinblick auf die Frage, ob die Versandkosten vom Händler (vollständig) zu erstatten sind oder ob der Verbraucher ggf. für eine bestimmte Bestellmenge gewährte Preisvorteile zurückgewähren muss.
Durchgehende Verfügbarkeit des Buttons
Was bedeutet die Anforderung, dass der Button "während der gesamten Widerrufsfrist" verfügbar sein muss?
Die EU-Richtlinie und der deutsche Gesetzentwurf fordern, dass die Widerrufsfunktion „während der gesamten Widerrufsfrist durchgehend verfügbar“ sein muss. Die gesetzliche Widerrufsfrist von 14 Tagen beginnt bei einem Warenkauf jedoch erst mit dem Erhalt der Ware. Schon aus diesem Grund ist die Frist für jeden Kunden individuell. Zudem sind in der Praxis Fälle denkbar, in denen der Händler seinen Kunden freiwillig ein verlängertes Widerrufsrecht einräumt, ggf. sogar beschränkt auf einen bestimmten Teil seines Warensortiments.
Eine exakte, nutzerspezifische Anzeige, die den Button für jeden Kunden individuell nach Ablauf der individuellen Widerrufsfrist ausblendet, ist extrem aufwendig. Das Shopsystem müsste den genauen Lieferzeitpunkt für jede einzelne Ware kennen und prüfen, ob ein Kunde überhaupt als Verbraucher widerrufsberechtigt ist. Die technische Komplexität würde zu hohen Implementierungskosten führen.
Gibt es eine praktikable Lösung für dieses Problem?
Der deutsche Gesetzgeber hat das Problem erkannt und in der Gesetzesbegründung zum deutschen Gesetzentwurf adressiert. Danach muss der Widerrufsbutton nicht kundenindividuell aus- oder eingeblendet werden. Die pauschale Bereitstellung der Widerrufsfunktion, unabhängig von den im Einzelfall geltenden Widerrufsfristen, soll zulässig sein.
Kann die dauerhafte Verfügbarkeit als "verlängertes" Widerrufsrecht ausgelegt werden?
Obwohl die Gesetzesbegründung zum deutschen Gesetzentwirf versucht, diese Gefahr auszuräumen, sehen einige Juristen das Risiko, dass die pauschale Bereitstellung des Buttons von Gerichten als freiwillige Einräumung eines über das gesetzliche Maß hinausgehenden Widerrufsrechts ausgelegt werden könnte. Dagegen spricht jedoch, dass die Widerrufsfrist nach Vertragsabschluss kommuniziert wird und bei verständiger Würdigung die bloße Anzeige der Widerrufsfunktion nicht das gleichzeitige Bestehen eines Widerrufsrechts beinhaltet.
Rechtliche Fallstricke – Lehren aus der Praxis des „Kündigungsbuttons“
Warum ist die Rechtsprechung zum Kündigungsbutton auch relevant für den Widerrufsbutton?
Die Rechtsprechung zum Kündigungsbutton, der bereits seit dem 01.06.2022 für Dauerschuldverhältnisse verpflichtend ist, bietet wertvolle Einblicke in die rechtlichen Anforderungen an den Widerrufsbutton. Die Grundprinzipien des Kündigungsbuttons, wie die leichte Zugänglichkeit und die Verhinderung von unzulässigen Hürden, sind direkt auf den Widerrufsbutton übertragbar. Beide Funktionen dienen dem Zweck, den Ausstieg aus einem Vertrag ebenso einfach zu gestalten wie den Abschluss.
Darf der Button erst nach einem Login im Kundenkonto bereitgestellt werden?
Die Anforderung der leichten Zugänglichkeit ist nicht erfüllt, wenn der Button nur in einem geschützten Kundenbereich nach gesondertem Login angezeigt wird. Lediglich dann, wenn und soweit auch der Vertrag ausschließlich mit der Einrichtung eines Kundenkontos geschlossen werden kann, ist die Bereitstellung der Widerrufsfunktion im Login-Bereich ausreichend.
Darf der Button in einer Linkliste platziert werden?
Nein, der Button darf nicht in einer Linkliste versteckt werden. Er muss unmittelbar und prominent platziert werden.
Rechtsfolgen bei Verstößen
Welche Rechtsfolgen drohen mir, wenn ich den Button nicht oder falsch einbinde?
Ein Verstoß gegen die Pflicht zur Bereitstellung des Widerrufsbuttons kann eine Ordnungswidrigkeit begründen. Für Unternehmen mit einem Jahresumsatz von über 1,25 Millionen EUR können Bußgelder von bis zu 4% des Jahresumsatzes verhängt werden. Bei kleineren Unternehmen beträgt das Bußgeld maximal 50.000 EUR.
Zudem kann die fehlerhafte oder fehlende Bereitstellung des Widerrufsbuttons einen Wettbewerbsverstoß begründen, da es sich insoweit um eine Marktverhaltensregelung handelt. Abmahnungen können etwa drohen, wenn die Platzierung, die Beschriftung oder der zweistufige Ablauf fehlerhaft umgesetzt wurden. Auch das Verstecken des Buttons oder die Verwendung veralteter Rechtstexte können Abmahnungsgründe darstellen.
Wer haftet bei Online-Marktplätzen für die korrekte Umsetzung?
Die Pflicht zur Bereitstellung eines Widerrufsbuttons bezieht sich auf Unternehmer, die Fernabsatzverträge über eine Online-Benutzeroberfläche schließen. Demnach haftet in jedem Fall der Händler für die korrekte Umsetzung der Widerrufsfunktion. Bei Online-Marktplätzen ist allerdings in der Regel der Marktplatzbetreiber für die technische Umsetzung verantwortlich, da der Händler hierauf keinen Einfluss hat. Bei fehlender oder mangelhafter Umsetzung durch den Marktplatzbetreiber kann der Händler sich für materielle Schäden ggf. im Regresswege vom Marktplatzbetreiber freistellen lassen.
Handlungsempfehlungen – So bereiten Sie sich rechtzeitig vor
Was sind die wichtigsten Maßnahmen?
Händler sollten umgehend eine Bestandsaufnahme durchführen. Dazu gehört die Prüfung, welche eigenen Angebote überhaupt unter die neue Pflicht fallen. Ferner ist es ratsam, bereits jetzt ein entsprechendes Budget für die Umsetzung einzuplanen.
Wann sollte ich mit der technischen Umsetzung beginnen?
Die technische Umsetzung sollte erst nach Verabschiedung des endgültigen nationalen Gesetzes erfolgen, um sicherzustellen, dass alle spezifischen Vorgaben korrekt umgesetzt werden. Spätestens zum Stichtag 19.06.2026 sollte die technische Umsetzung abgeschlossen sein.
Muss ich meine Widerrufsbelehrung anpassen?
Ja, die Widerrufsbelehrung muss angepasst werden. Künftig muss über das „Bestehen und die Platzierung der Widerrufsfunktion“ belehrt werden. Auch die Muster-Widerrufsbelehrung wird entsprechend ergänzt und erhält einen Zusatz, der auf die Möglichkeit der Online-Ausübung des Widerrufsrechts verweist.
Allerdings sollte die Widerrufsbelehrung nicht voreilig angepasst werden, da eine vorzeitige Änderung gegen die aktuell gültigen gesetzlichen Vorgaben verstoßen und somit selbst eine Abmahngefahr mit sich bringen könnte.
Muss ich meine Datenschutzerklärung anpassen?
Die Datenschutzerklärung muss ebenfalls angepasst werden. Insoweit muss darüber informiert werden, welche Daten im Rahmen des Widerrufsprozesses erhoben, verarbeitet und wie lange sie gespeichert werden. Hierbei ist der Grundsatz der Datensparsamkeit gemäß DSGVO zu beachten, der es verbietet, mehr Daten als die zwingend notwendigen abzufragen.
Kann ich ein Plugin für mein Shopsystem nutzen?
Es ist davon auszugehen, dass die Anbieter gängiger Shop-Systeme auch Plugins für eine Widerrufsfunktion anbieten werden. Diese Plugins müssen jedoch sorgfältig dahingehend geprüft werden, ob sie den gesetzlichen Anforderungen entsprechen.
Fragen zum Beitrag? Diskutieren Sie hierzu gerne mit uns in der Unternehmergruppe der IT-Recht Kanzlei auf Facebook.
Link kopieren
Als PDF exportieren
Per E-Mail verschicken
Zum Facebook-Account der Kanzlei
Zum Instagram-Account der Kanzlei

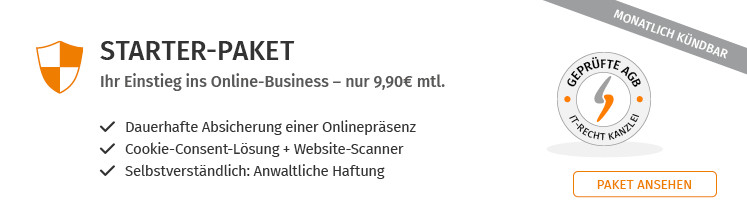
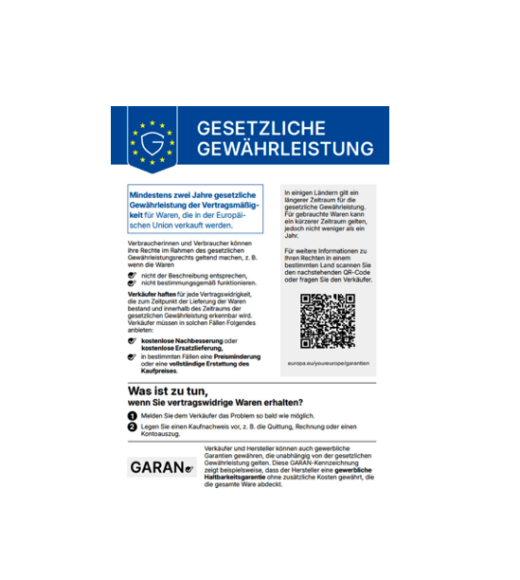



7 Kommentare
Für alle, die mit Magento 2 arbeiten: Ich habe ein kleines Open-Source-Modul veröffentlicht, das die Anforderungen aus § 356a BGB / EU-Richtlinie technisch umsetzt (Widerrufsbutton, Formular, automatische Eingangsbestätigung etc.).
Link: https://github.com/Zwernemann/magento2-withdrawl
Es lässt sich als natives Modul per Composer integrieren und erspart die Eigenentwicklung oder den Einsatz eines kommerziellen Moduls – gerade, wenn man eine pragmatische und rechtssichere Lösung sucht. Vielleicht für den ein oder anderen hier hilfreich.
habe mich auch gefragt wie ich das ganze in meinem Shopify Store umsetze. Habe folgende kostenlose App gefunden: https://apps.shopify.com/eu-widerrufsbutton
Ging gut und bin jetzt schon bereit für Juni 2026.
wird das Einpflegen des Buttons von it-recht erfolgen, b.z.w. die Möglichkeit dazu bereit gestellt?
MfG
Nach dem Motto die Dienstleitung soll sofort beginnen und der Kunde verzichtet auf sein Widerrufsrecht.
Wäre ein platzieren des Buttons in der Bestellbestätigungsmail statt auf der Website erlaubt? Das würde dieses Problem umgehen, es klingt aber danach als ob es unbedingt direkt auf der Website verlinkt sein muss..