Einführung: selektive Vertriebssysteme als Unterfall der vertikalen Vertriebsvereinbarungen (1. Teil der Serie zu selektiven Vertriebssystemen)

Im 1. Teil der Serie der IT-Recht Kanzlei zu selektiven Vertriebssystemen geht um die grundsätzliche rechtliche Einordnung und den Aufbau der Serie. In selektiven Vertriebssystemen wählt der Anbieter einer Ware (Hersteller oder Händler) den weiteren Vertriebsweg bis zum Endverbraucher gezielt aus (Selektion), um bestimmte Ziele zu erreichen.
Inhaltsverzeichnis
A. Einführung
Selektive Vertriebssysteme zählen zu den vertikalen Vertriebsvereinbarungen. Vertikale Vertriebsvereinbarungen sind Vereinbarungen zwischen Unternehmen unterschiedlicher Wirtschaftsstufen über den Vertrieb von Waren und Dienstleistungen.
I. Unternehmen unterschiedlicher Wirtschaftsstufen
Unternehmen unterschiedlicher Wirtschaftsstufen sind die verschiedenen Unternehmen in der Lieferkette zwischen dem Hersteller beziehungsweise Importeur eines Produktes und dem Verbraucher. Diese können unterschiedliche viele sein. Schemenartig gedacht, könnte die Lieferkette aus dem Hersteller, dem Großhändler, dem Einzelhändler und dem Verbraucher bestehen. Jeder von ihnen steht auf einer eigenen Wirtschaftsstufe.
Da jeder auf einer anderen Wirtschaftsstufe steht, werden die Vereinbarungen „vertikale Vereinbarungen“ genannt.
Im Gegensatz dazu stehen bei den sogenannten horizontalen Vereinbarungen die Unternehmen auf derselben Wirtschaftsstufe. Ein Beispiel hierfür wäre eine Vereinbarung zwischen zwei Großhändlern.
Der Hersteller ist derjenige, der das Produkt oder die Dienstleistung herstellt, produziert oder erbringt. Alternativ steht der Importeur auf der ersten Stufe, der das Produkt nicht herstellt, aber außerhalb des EU-Binnenmarktes erwirbt und in den EU-Binnenmarkt einführt. Der Großhändler liefert das Produkt in der Regel an eine Vielzahl von Einzelhändlern, die regional verstreut sind, verkauft jedoch in der Regel nicht an Endverbraucher. Der Einzelhändler verkauft die Ware an den Verbraucher und hat deswegen in der Regel einen Verkaufsladen und / oder einen Online-Shop. Der Verbraucher ist schließlich der Endkunde, der das Produkt konsumiert, d.h. ge- oder verbraucht.
Es können aber auch mehr oder weniger Stufen sein. So kann der Hersteller bereits direkt an Einzelhändler liefern. Oder es gibt wegen der Größe des zu beliefernden Gebiets zwischen dem Hersteller und dem Einzelhändler zwei Großhändler.
Die Begriffe „Anbieter“ und „Abnehmer“ werden für sämtliche Handelsstufen verwendet und bezeichnen Verkäufer und Käufer.
II. Worum geht es inhaltlich bei Vertikalen Vertriebsvereinbarungen?
Die Inhalte der vertikalen Vertriebsvereinbarungen können ganz verschieden sein. Grundsätzlich kann alles das vereinbart werden, was auch sonst in einem Vertrag geregelt werden kann. Meistens dreht es sich jedoch um Preise, den Umfang oder die Art und Weise der Leistung oder um den Kreis der weiteren Vertragspartner.
B. Gesetzliche Schranken
Vertikale Vereinbarungen können jedoch nicht unbegrenzt aufgestellt werden. Sie können den Wettbewerb zwischen den Händlern auf dem Wirtschaftsmarkt einschränken. Dies ist aber im Sinne eines freien und fairen Wettbewerbes nicht gewollt. Vertikale Vertriebsvereinbarungen können deshalb gegen Wettbewerbsverbot bzw. Kartellverbot verstoßen. Das Verbot steht im deutschen Recht im Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen (abgekürzt GWB und auch Kartellgesetz genannt). Zudem ist es auch im europäischen Recht - im Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union (AEUV) - enthalten. Der AEUV gilt, wenn die vertikalen Vereinbarungen geeignet sind, den europäischen Markt zu beeinflussen. Nur bei rein nationalen Auswirkungen ist das GWB einschlägig. Wegen der bezweckten Harmonisierung der Rechtsräume stimmen die deutschen Regelungen und die europäischen Regelungen weitestgehend überein.
Die nationale Norm des § 1 GWB lautet:
Vereinbarungen zwischen Unternehmen, Beschlüsse von Unternehmensvereinigungen und aufeinander abgestimmte Verhaltensweisen, die eine Verhinderung, Einschränkung oder Verfälschung des Wettbewerbs bezwecken oder bewirken, sind verboten.
Die europäische Norm des Art. 101 I AEUV (früher Art. 81 EGV) lautet:
(1) Mit dem Binnenmarkt unvereinbar und verboten sind alle Vereinbarungen zwischen Unternehmen, Beschlüsse von Unternehmensvereinigungen und aufeinander abgestimmte Verhaltensweisen, welche den Handel zwischen Mitgliedstaaten zu beeinträchtigen geeignet sind und eine Verhinderung, Einschränkung oder Verfälschung des Wettbewerbs innerhalb des Binnenmarkts bezwecken oder bewirken, insbesondere
a) die unmittelbare oder mittelbare Festsetzung der An- oder Verkaufspreise oder sonstiger Geschäftsbedingungen;
b) die Einschränkung oder Kontrolle der Erzeugung, des Absatzes, der technischen Entwicklung oder der Investitionen;
c) die Aufteilung der Märkte oder Versorgungsquellen;
d) die Anwendung unterschiedlicher Bedingungen bei gleichwertigen Leistungen gegenüber Handelspartnern, wodurch diese im Wettbewerb benachteiligt werden;
e) die an den Abschluss von Verträgen geknüpfte Bedingung, dass die Vertragspartner zusätzliche Leistungen annehmen, die weder sachlich noch nach Handelsbrauch in Beziehung zum Vertragsgegenstand stehen.
Im 2. Teil der Serie der IT-Recht Kanzlei wird auf die Voraussetzungen des Verbots wettbewerbsbeschränkender Vereinbarungen nach § 1 GWB und Art. 101 AEUV eingegangen.
Fragen zum Beitrag? Diskutieren Sie hierzu gerne mit uns in der Unternehmergruppe der IT-Recht Kanzlei auf Facebook.
Link kopieren
Als PDF exportieren
Per E-Mail verschicken
Zum Facebook-Account der Kanzlei
Zum Instagram-Account der Kanzlei

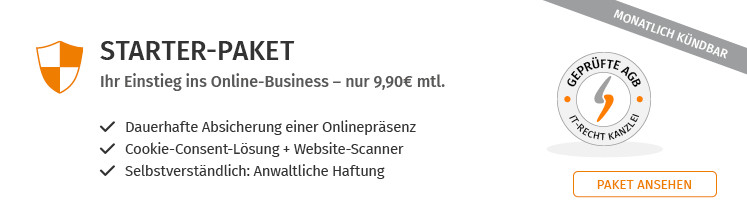




0 Kommentare