Lieferhindernisse im Online-Shop: Wenn die Lieferung unmöglich wird
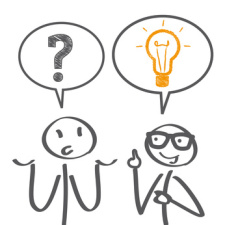
Wird eine Ware in einem Shop als bestellbar angezeigt, darf der Kunde ihre Lieferung erwarten. Was gilt jedoch, wenn sie nicht geliefert werden kann? Wir erklären, welche Rechte greifen und wie Händler richtig reagieren.
Inhaltsverzeichnis
- Unmöglichkeit der Lieferung: Wann kann ein Händler nicht mehr leisten?
- 1. Wann liegt eine Unmöglichkeit vor?
- 2. Welche rechtlichen Folgen hat eine Unmöglichkeit?
- Rechte des Käufers, wenn der Händler nicht liefern kann
- 1. Rückzahlung des Kaufpreises
- 2. Schadensersatz
- 3. Anspruch auf Herausgabe von Ersatzleistungen
- Formulierungsmuster für Mandanten: So reagieren Sie richtig
- Fazit
Unmöglichkeit der Lieferung: Wann kann ein Händler nicht mehr leisten?
Kann der Händler einen bestellten Artikel aufgrund von Kapazitätsproblemen nicht liefern, wird regelmäßig ein Fall der Erfüllungsunmöglichkeit gemäß § 275 Abs. 1 BGB vorliegen.
1. Wann liegt eine Unmöglichkeit vor?
Die Unmöglichkeit als Rechtstatsache tritt dann ein, wenn die Erfüllung des Lieferanspruchs eines Verbrauchers für den Händler
- subjektiv oder
- objektiv
nicht durchführbar ist.
Die subjektive Unmöglichkeit erfasst alle Fälle, in denen nur dem Händler als Schuldner persönlich die Erfüllung unmöglich ist, etwa weil sich die Kaufsache aufgrund einer zwischenzeitlichen Weiterveräußerung nun im Eigentum eines anderen befindet.
a. Subjektive Unmöglichkeit: Wenn nur der Händler nicht liefern kann
Ein Händler verkauft über seinen Online-Shop ein Einzelstück – etwa eine gebrauchte Kamera.
Kurz nach dem Verkauf bemerkt er, dass er dieselbe Kamera bereits wenige Tage zuvor auf einem anderen Marktplatz an einen anderen Kunden verkauft und ausgeliefert hat.
b. Objektive Unmöglichkeit: Wenn niemand mehr liefern kann
Die objektive Unmöglichkeit adressiert hingegen Konstellationen, bei denen auch für jeden anderen ein unüberwindbares Lieferhindernis bestünde (etwa bei Sachzerstörung).
Ein Antiquitätenhändler betreibt einen Online-Shop und bietet dort ein historisches, signiertes Porzellan-Service aus einer limitierten Auflage (eine sogenannte Stückschuld) an.
Ein Kunde kauft das Porzellan-Service über den Online-Shop und bezahlt per Vorkasse.
Bevor das Service verpackt und versandt werden kann, bricht im Lager des Händlers ein Feuer aus. Das Porzellan-Service wird dabei unwiederbringlich zerstört.
c. Bestimmung der Unmöglichkeit nach Art der Kaufsache
Ob eine vertragliche Unmöglichkeit eingetreten ist, bemisst sich grundsätzlich nach dem konkreten Gegenstand der vertraglichen Schuld, bei Kaufverträgen mithin nach der Art der Kaufsache.
Bei Verkäufen von Handelswaren, die keine Unikate sind, ist die Unmöglichkeit allerdings nicht exemplarbezogen und nicht bereits dann gegeben, wenn der Händler selbst nicht entsprechend bevorratet ist.
Sie tritt vielmehr erst ein, wenn der Händler ein vergleichbares Exemplar auch am Markt von keinem Dritten unter zumutbaren Bedingungen beschaffen kann.
2. Welche rechtlichen Folgen hat eine Unmöglichkeit?
Ist einem Händler die Erfüllung eines Lieferanspruchs unmöglich geworden, ordnet § 275 Abs. 1 BGB als Rechtsfolge den Ausschluss des Käuferanspruchs an. Bei Unmöglichkeit kann der Käufer insofern keine Erfüllung seines Lieferanspruchs mehr verlangen.
Freilich wird der Käufer in derartigen Fällen aber nicht rechtlos gestellt. Vielmehr stehen ihm bei einer Erfüllungsunmöglichkeit des Händlers verschiedene Rechte und Ansprüche zu, die den Leistungsausfall kompensieren sollen.
Rechte des Käufers, wenn der Händler nicht liefern kann
Beruft sich ein Händler aufgrund eines Lieferhindernisses auf die Unmöglichkeit, kann der Käufer auf verschiedene Rechtsinstitute zurückgreifen, die für den Händler entsprechende Handlungspflichten begründen.
1. Rückzahlung des Kaufpreises
Gemäß § 326 Abs. 1 Satz 1 BGB entfällt bei Lieferunmöglichkeit der Anspruch des Händlers auf den Kaufpreis.
Zahlt der Käufer nach der Bestellung den Kaufpreis unmittelbar und kann der Händler aufgrund von Unmöglichkeit die Kaufsache sodann nicht liefern, ist er dem Käufer nach § 326 Abs. 4 BGB zur Rückzahlung des vollen Kaufpreises verpflichtet.
Hat der Käufer noch nicht gezahlt (etwa bei "Lieferung auf Rechnung"), erlischt die Kaufpreisforderung.
2. Schadensersatz
Liegt auf der Händlerseite eine Erfüllungsunmöglichkeit vor, steht dem Käufer zudem ein Anspruch auf Schadensersatz nach §§ 280 Abs. 1, Abs. 3, 283 BGB zu.
Diesen kann er ohne Nachfristsetzung geltend machen, da eine Nachlieferbarkeit wegen Unmöglichkeit allgemein ausscheidet.
Der von dem Ersatzanspruch erfasste Mindestschaden ist in jedem Fall der vom Käufer gezahlte Kaufpreis.
In Einzelfällen können mit dem Ersatzanspruch aber auch weitere, darüberhinausgehende Positionen geltend gemacht werden. Am relevantesten dürfte hier ein entgangener Gewinn im Sinne des § 252 BGB sein, den der Käufer bei Weiterveräußerung des zu liefernden Gegenstandes erzielt hätte, aufgrund des Nichterhalts aber nicht erzielen konnte.
Der Schadensersatzanspruch kann, sofern er betragsmäßig über die Summe des gezahlten Kaufpreises hinausgeht, grundsätzlich neben dem Rückforderungsanspruch aus § 326 Abs. 4 BGB geltend gemacht werden (s. § 325 BGB) .
Zwar setzt jede schadensrechtliche Inanspruchnahme ein Vertretenmüssen des Händlers voraus.
In Unmöglichkeitsfällen müsste der Händler also gerade die Unmöglichkeit der Leistung zu verschulden haben.
Allerdings wird gemäß § 280 Abs. 1 Satz 2 BGB im Vertragsrecht ein verkäuferisches Verschulden vermutet.
Will sich der Händler einer Schadensersatzforderung entziehen, muss er beweisen, für die Lieferunmöglichkeit nicht verantwortlich zu sein.
3. Anspruch auf Herausgabe von Ersatzleistungen
Ein besonderes mit der Unmöglichkeit verknüpftes Rechtsinstitut, ist der Anspruch auf Herausgabe des Ersatzes.
Dieser Anspruch adressiert Leistungshindernisse auf der Händlerseite, die dadurch entstanden sind, dass ein einzigartiger Kaufgegenstand bereits anderweitig veräußert wurde und daher dem Käufer nicht mehr zur Verfügung gestellt werden kann.
Ist die Erfüllungsmöglichkeit des Händlers insofern auf eine zwischenzeitliche Weitergabe des Kaufgegenstandes an einen Dritten zurückzuführen, kann der Käufer vom Händler die Herausgabe dessen verlangen, was der Händler durch die Weitergabe des Gegenstandes erlangt hat.
Ein derartiger Anspruch macht es dem Käufer also möglich, einen durch eine anderweitige Veräußerung vom Händler erzielten Gewinn abzuschöpfen.
Ein Händler kann einen zum Preis von 400€ als Einzelstück gekauften Ring nicht liefern, weil er ihn vor der Bestellung bereits für 600€ an einen anderen Käufer verkauft und infolgedessen übereignet hat.
Aus dem Grund steht dem Käufer zur Kompensation der Unmöglichkeit gegen den Händler ein Anspruch auf Zahlung der 600€ zu.
Fordert der Käufer die Herausgabe des Erlangten, behält der Händler den Anspruch auf den mit dem Käufer vereinbarten Kaufpreis, § 326 Abs. 3 BGB. Anderenfalls wäre der Käufer doppelt einerseits um den Kaufpreis und andererseits den durch die Zwischenveräußerung erzielten Betrag bereichert.
Zwar ist der Herausgabeanspruch in der Theorie attraktiv. Die praktische Durchsetzbarkeit ist aber problematisch. Zur Abschöpfung eines Erlöses beim Händler müsste der Käufer nämlich beweisen können, dass der Händler den Kaufgegenstand vorzeitig weiterveräußert und hierfür eine Gegenleistung erhalten hat.
Allerdings wird der Käufer regelmäßig die dafür notwendige Einsicht in die geschäftlichen Abläufe und Beziehungen des Händlers nicht aufweisen.
Formulierungsmuster für Mandanten: So reagieren Sie richtig
Schutzpaket-Mandanten stellen wir exklusiv das hilfreiches Reaktionsmuster "Rückerstattungsangebot wegen Lieferunmöglichkeit" zur Verfügung, das im Falle einer Lieferunmöglichkeit verwendet werden kann und dem Käufer entschuldigend die Kaufpreiserstattung anbietet.
Fazit
Vermag ein Händler aufgrund mangelnden Warenbestandes nicht zu leisten und ist die Ware auch nicht unter zumutbaren Anstrengungen anderswo zu beschaffen, kann er sich auf Unmöglichkeit berufen.
Damit verliert er nicht nur automatisch seinen Anspruch auf den Kaufpreis und muss dem Käufer diesen, sofern bereits bezahlt, erstatten.
Vielmehr muss er auch einen vom Käufer aufgrund der Unmöglichkeit erlittenen weiteren Schaden, etwa einen entgangenen Gewinn, kompensieren.
Fragen zum Beitrag? Diskutieren Sie hierzu gerne mit uns in der Unternehmergruppe der IT-Recht Kanzlei auf Facebook.
Link kopieren
Als PDF exportieren
Per E-Mail verschicken
Zum Facebook-Account der Kanzlei
Zum Instagram-Account der Kanzlei







1 Kommentar
war es nicht bisher so, dass bei einer Bestellbestätigung (und in dieser wird auch nur der Eingang der Bestellung bestätigt und nichts dergleichen wie Auftragsbestätigung etc formuliert) es noch keine Annahmeerklärung darstellt und daher kein Kaufvertrag geschlossen wurde - so wie Sie gleich im ersten Satz Ihres Beitrages darstellen?
(OLG Nürnberg, Beschluss vom 10.06.2009 sowie 27.02.2009, Aktenzeichen 14 U 622/09)