Firmenadresse schützt nicht vor Widerruf: Urteil des AG Bonn

Rechnung an die Praxisadresse, Alarmanlage fürs Privathaus – Verbraucher oder Unternehmer? Im Fall vor dem AG Bonn zeigte sich, wie schnell Händler die Widerrufslage falsch einschätzen können.
Inhaltsverzeichnis
- Update: Rechtslage 2025 – Kurzüberblick
- 14-tägiges Widerrufsrecht nur für Verbraucher
- Verbrauchereigenschaft nur bei privaten Rechtsgeschäften
- Der Streitfall: Käufer wünscht Rechnungsstellung an Geschäftsadresse
- Amtsgericht Bonn: Rechnungsstellung an Unternehmen spricht nicht gegen Verbrauchereigenschaft des Kunden
- Fazit
Update: Rechtslage 2025 – Kurzüberblick
Das (unten besprochene) Urteil des AG Bonn aus dem Jahr 2015 beleuchtet ein Problem, das Händler bis heute beschäftigt: Reicht eine Rechnungsstellung an die Geschäftsadresse aus, um einem Kunden die Verbrauchereigenschaft abzusprechen?
Das Amtsgericht verneinte dies eindeutig. Entscheidend sei nicht die Adresse auf der Rechnung, sondern der tatsächliche Nutzungszweck – und der lag im entschiedenen Fall klar im privaten Bereich.
Diese Einschätzung ist nach wie vor tragfähig und wurde inzwischen durch die höchstrichterliche Rechtsprechung ausdrücklich bestätigt.
Der BGH hat mit Urteil vom 07.04.2021 (VIII ZR 191/19) klargestellt, dass allein die Angabe einer geschäftlichen Liefer- oder Rechnungsadresse keine Unternehmereigenschaft begründen kann.
Maßgeblich bleibt der objektive Zweck des Geschäfts – beurteilt aus Sicht des Händlers anhand der erkennbaren Umstände beim Vertragsschluss.
Damit steht fest: Weder die Angabe einer Firmenadresse für die Rechnung noch eine Lieferung an Praxis, Kanzlei oder Büro erlaubt für sich genommen den Schluss, dass der Kunde als Unternehmer handelt.
Entscheidend bleibt der objektive Zweck des Geschäfts. Nur wenn aus Sicht des Händlers eindeutige und zweifelsfreie Umstände erkennbar sind, die auf ein berufliches Handeln schließen lassen, darf die Verbrauchereigenschaft verneint werden.
14-tägiges Widerrufsrecht nur für Verbraucher
Grundsätzlich gilt im deutschen Recht, dass Verträge einzuhalten, also zu erfüllen sind.
Eine Ausnahme von dem Grundsatz der Vertragserfüllung stellt das 14-tägige Widerrufsrecht dar. Ein solches steht Verbrauchern bei Fernabsatzgeschäften und bei außerhalb von Geschäftsräumen geschlossenen Verträgen zu. Innerhalb der 14-tägigen Frist können sich Verbraucher ohne Angabe von Gründen wieder vom Vertrag lösen.
Durch die Möglichkeit des Widerrufs sollen Verbraucher davor geschützt werden, dass sie in einer besonderen Kaufsituation übereilt oder ohne gründliche Abwägung eine vertragliche Bindung eingegangen sind. Unternehmern steht ein Widerrufsrecht grundsätzlich nicht zu, es sei denn ein solches wurde vertraglich vereinbart. Aus diesem Grund spielt die Unterscheidung zwischen einem Verbraucher und einem Unternehmer im Rechtsverkehr eine entscheidende Rolle.
Verbrauchereigenschaft nur bei privaten Rechtsgeschäften
Das Gesetz definiert Verbraucher in § 13 BGB als „jede natürliche Person, die ein Rechtsgeschäft zu Zwecken abschließt, die überwiegend weder ihrer gewerblichen noch ihrer selbständigen beruflichen Tätigkeit zugerechnet werden können.“ Ob dem Kunden ein Widerrufsrecht zusteht, ist also vom Zweck des jeweiligen Rechtsgeschäfts abhängig. Soll der Vertragsgegenstand sowohl der beruflichen als auch der privaten Benutzung dienen, ist entscheidend, welche Benutzung überwiegt.
Für Händler ist es nicht immer einfach zu beurteilen, ob der Kunde den Kauf zu privaten oder unternehmerischen Zwecken getätigt hat. Schwierig wird es insbesondere dann, wenn der Kunde die Rechnung auf seine Geschäftsadresse ausstellen lässt, um den getätigten Privatkauf steuerlich absetzen zu können. Durch diese Praxis werden Betriebsausgaben fingiert, der Gewinn seines Unternehmens und damit auch die Steuerlast gemindert. Unterm Strich handelt es sich dabei um Steuerhinterziehung.
Der Streitfall: Käufer wünscht Rechnungsstellung an Geschäftsadresse
Dem Amtsgericht (AG) Bonn lag genau dieser Streitfall zur Entscheidung vor (Urteil vom 08.07.2015, 103 C 173/14). Der Kunde hatte für sein Privathaus eine Alarmanlage zum Preis von 1.200,00 € gekauft. Dort wurde auch der Kaufvertrag geschlossen. Der Lieferschein enthielt die Angabe, dass die Rechnung an die Geschäftsadresse des Kunden, nämlich an eine von diesem betriebene Arztpraxis, gehen möge.
Nur zwei Tage später erklärte der Kunde den Widerruf des Kaufvertrags. Der Verkäufer ließ den Kaufpreis gleichwohl vom Konto des Kunden abbuchen, woraufhin sich die Parteien schließlich vor dem AG Bonn wiedertrafen. Der Verkäufer war dabei der Ansicht, aufgrund der gewünschten Rechnungsstellung an die Geschäftsadresse des Kunden habe dieser nicht als Verbraucher gehandelt.
Amtsgericht Bonn: Rechnungsstellung an Unternehmen spricht nicht gegen Verbrauchereigenschaft des Kunden
Das AG Bonn entschied zugunsten des Kunden und sprach ihm ein Widerrufsrecht gemäß § 312g Abs. 1 i.V.m. § 312b BGB zu. Der Käufer habe beim Kauf der Alarmanlage als Verbraucher gehandelt. So sprachen insbesondere die Beratung und die Installation der Alarmanlage im Privathaus für seine Verbrauchereigenschaft.
Für eine Zuordnung zur unternehmerischen Tätigkeit des Käufers sprach lediglich die Tatsache, dass die Rechnungsstellung an die Geschäftsadresse des Käufers erfolgen sollte. Dies habe typischerweise den Zweck, eine im Rahmen der unternehmerischen Tätigkeit steuerrechtlich relevante Rechnung zu erhalten. Die überwiegenden Anhaltspunkte, insbesondere die Installation im Privathaus des Käufers, sprachen jedoch dafür, dass die Alarmanlage nicht vorwiegend für unternehmerische Zwecke, sondern im privaten Bereich eingesetzt werde. Aufgrund der Rechnungsstellung an die Geschäftsadresse ließe sich lediglich vermuten, dass das Finanzamt betrogen werden soll. Dies sei jedoch für die zivilrechtliche Beurteilung der Verbrauchereigenschaft ohne Bedeutung.
Fazit
In dem zugrundeliegenden Streitfall war die Verbrauchereigenschaft des Kunden, insbesondere aufgrund der Installation der Alarmanlage in seinem Privathaus, offensichtlich. Schwieriger ist die Beurteilung bei Fernabsatzgeschäften, wie im Online-Handel, bei denen der Shop-Betreiber keine derartigen Anhaltspunkte hat.
Der BGH hat jedoch entschieden, dass rechtsgeschäftliches Handeln mit einer natürlichen Person grundsätzlich als Verbraucherhandeln einzustufen ist. Shop-Betreiber müssen ihren Kunden dementsprechend ein Widerrufsrecht einräumen, es sei denn aus den Umständen ergibt sich eindeutig und zweifelsfrei, dass der Kunde beim Vertragsschluss als Unternehmer gehandelt hat.
Fragen zum Beitrag? Diskutieren Sie hierzu gerne mit uns in der Unternehmergruppe der IT-Recht Kanzlei auf Facebook.
Link kopieren
Als PDF exportieren
Per E-Mail verschicken
Zum Facebook-Account der Kanzlei
Zum Instagram-Account der Kanzlei

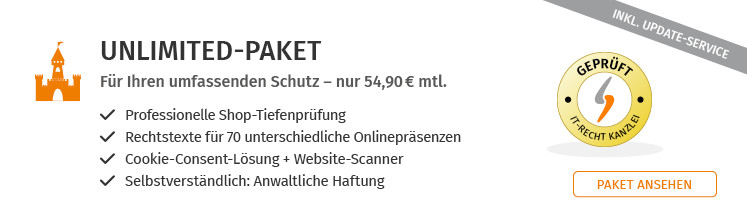





1 Kommentar
1.AG Hamburg-Wandsbek, 716A C 11/08
Leitsätze
: 1. Entscheidend für die Verbrauchereigenschaft iSd. § 13 BGB ist ausschließlich für welchen Zweck der Käufer den Kaufgegenstand erwirbt.2. Es ist daher unerheblich, wenn sich ein Verbraucher die Kaufgegenstände in die betriebliche Firma, in der er arbeitet, liefern lässt oder wenn auf der Rechnung die Firmenanschrift vermerkt ist.
2. Der diese Entscheidung aufhebenden Berufungsentscheidung LG Hamburg, Urt. v. 16.12.2008 - Az.: 309 S 96/, welches der Auffassung war, dass Klägerin kein fernabsatzrechtliches Widerrufsrecht zustehe, da sie nicht als Verbraucherin gehandelt habe.und
3. Der Revisionsentscheidung BGH vom 30.09.2009, VIII ZR 7/09, JA 2010, S. 748 ff., welche auf die Revision der Klägerin das Urteil des Landgerichts Hamburg, Zivilkammer 9, vom 16. Dezember 2008 aufhob und die Berufung der Beklagten gegen das Urteil des Amtsgerichts Hamburg-Wandsbek vom 13. Juni 2008 zurückgewies.