Rätsel um Gefahr und Schuld bei der Lieferung

Das Bürgerliche Gesetzbuch (BGB) kann manchmal fast poetisch sein. So geht es beim Kauf und der Lieferung einer Sache um „*Gefahr* “ und „*Schuld* “. Gemeint ist hier der „Gefahrübergang“ und die Frage, wo der Leistungserfolg also der Leistungsort ist. Noch einfacher ausgedrückt geht es um die Frage, wer haftet dafür, dass eine Ware beim Versand beschädigt wird oder verloren geht. Muss der Verkäufer eine neue Ware schicken oder muss der Käufer zahlen, obwohl er eine beschädigte oder gar keine Ware erhalten hat. Dieses Problem beschäftigt sowohl Käufer und Verkäufer beim so genannten B2B-Verkauf (Verkäufe an einen Unternehmer) als auch beim B2C-Verkauf (Verkäufe an einen Verbraucher).
Der folgende Beitrag will hier Aufklärung bieten:
1. Grundsatz Gefahrübergang bei Übergabe
Das Gesetz normiert in § 446 BGB den Grundsatz, dass mit der Übergabe der verkauften Sache die Gefahr des zufälligen Untergangs und der zufälligen Verschlechterung auf den Käufer übergeht.
Mit Gefahr meint der Gesetzgeber also die Verantwortung für die Beschädigung oder den Verlust der verkauften Sache.
Beispiel:
Lässt ein Verkäufer ein kostbares Glas fallen, bevor er es dem Käufer aushändigen konnte, dann trägt er die Verantwortung für den Verlust. Lässt der Käufer aber das Glas fallen, nachdem es ihm vom Verkäufer ausgehändigt wurde, trägt er die Verantwortung und muss das Glas bezahlen, obwohl es nicht mehr zu gebrauchen ist.
2. Abweichende Regeln beim Versendungskauf
Aber nicht immer wird die Ware direkt vom Verkäufer dem Käufer übergeben. Sehr oft wird vereinbart, dass die Ware an den Käufer geschickt wird.
Fallbeispiel:
Der Rechtsanwalt Schlau kauft für seine Kanzlei einen PC im Internet. Die Parteien vereinbaren lediglich, dass der PC an die Kanzlei geschickt wird. Es ist für die Parteien selbstverständlich, dass der Transport nicht vom Verkäufer sondern durch ein Transportunternehmen erfolgen soll. Der PC wird nicht geliefert. Der Verkäufer kann aber eine UPS-Bestätigung vorlegen, dass er den PC abgeschickt hat. Der Rechtsanwalt besteht auf der Versendung eines neuen PCs und will nicht zahlen. Zu Recht?
2.1 Grundsatz
Wir alle kennen es, dass uns ein Möbelstück oder ein Küchengerät geschickt wird. Ja oft wird es sogar vom Verkäufer aufgebaut. Was gilt in solchen Fällen, wenn die Ware beim Transport verloren geht oder beim Transport oder bei der Montage beschädigt wird?
Hier gilt § 447 BGB. Diese Vorstellung lautet: „Versendet der Verkäufer auf Verlangen des Käufers die verkaufte Sache nach einem anderen Ort als dem Erfüllungsort, so geht die Gefahr auf den Käufer über, sobald der Verkäufer die Sache dem Spediteur, dem Frachtführer oder der sonst zur Ausführung der Versendung bestimmten Person oder Anstalt ausgeliefert hat.* “
Nun wäre das Rätsel fast gelöst, wenn feststünde wo der Erfüllungsort ist. Denn gemäß § 447 BGB geht die Gefahr auf den Käufer über, wenn der Erfüllungsort beim Verkäufer ist.
2.2 Wo ist der Erfüllungsort?
Die Sache bleibt also rätselhaft. Was ist nun der Erfüllungsort und ist er beim Käufer oder beim Verkäufer?
Das Schuldrecht unterscheidet zwischen dem Ort, an dem die Leistung zu erfolgen hat (Ort der Leistung) oder Erfüllungsort und dem Ort des Leistungserfolges. Der Erfüllungsort ist der Ort, an dem der Verkäufer seine Leistung erbringt. Der Erfolgsort ist der Ort, an dem der Käufer die Ware und das Eigentum erhält. Beide Orte können auseinander fallen. Dies geschieht insbesondere beim Versendungskauf. Hier gibt der Verkäufer am Ort seines Wohn- oder Geschäftsitzes die Ware zur Post oder bei einem Transportunternehmen ab und die Ware trifft am Wohnsitz des Käufers ein. Hier geht auch erst das Eigentum über
Der Gesetzgeber unterscheidet nun zwischen drei Schuldtypen jeweils danach ob der Erfüllungsort oder Erfolgsort beim Verkäufer ist.
- Zunächst ist da die Holschuld. Hier hat der Käufer die Ware abzuholen. Erfüllungs- und Erfolgsort sind beim Verkäufer.
- Muss der Verkäufer die Ware zum Käufer bringen, dann spricht man von Bringschuld. Hier ist also der Erfüllungs- und Erfolgsort beim Käufer angesiedelt.
- Dann gibt die Schickschuld , bei der der Erfüllungsort beim Verkäufer liegt aber der Erfolg beim Käufer eintritt. Der Verkäufer muss die Ware versenden, also einem Transportunternehmen anvertrauen. Der Erfolg, also die Übereignung der Ware tritt erst ein, wenn der Käufer die Ware erhält.
Es liegt an den Parteien, sich bei Abschluss des Kaufvertrages auch über die Art der Schuld zu einigen. Geschieht dies ausdrücklich nicht, wird dies vom Gesetzgeber durch § 269 BGB festgelegt. Wenn also weder ausdrücklich noch durch Auslegung des Parteilwillens der Leistungsort vereinbart ist, kommt es auf die „Natur des Schuldverhältnisses“ an. Zum Beispiel weiß jeder, der einkaufen geht, dass die Ware ihm direkt im Kaufhaus vom Verkäufer übereignet wird. Werden aber Möbel vom Verkäufer selbst geliefert oder sogar aufgebaut, ist die Leistung erst mit der Anlieferung erbracht, und bei Montageverpflichtung erst, wenn der Einbau beim Käufer abgeschlossen ist; ja hier trägt der Verkäufer gemäß § 434 Abs. 3 BGB auch die Verantwortung dafür, dass die Montage ordnungsgemäß ist und die Küche nicht beim Einbau beschädigt wird.
Wenn sich aber aus der Natur des Schuldverhältnisses und dem Parteiwillen nichts ergibt, legt § 269 BGB fest, dass der Erfüllungsort beim Verkäufer ist.
2.3 Auflösung
Wenn man diese Erkenntnisse auf den Fall des Rechtsanwalts Schlau anwendet, kommen wir zu folgenden Überlegungen.
- Hätten die Parteien eine Bringschuld vereinbart, dann müsste der Rechtsanwalt nicht bezahlen. Er könnte auf eine neue Lieferung bestehen. Eine Bringschuld ist aber nicht vereinbart.
- Läge eine Holschuld vor, müsste der Rechtsanwalt bezahlen, obwohl er die Ware nicht erhalten hat. Auch eine Pflicht den PC abzuholen, wurde nicht vereinbart.
- Alles spricht für eine Schickschuld. In diesem Fall wäre der Erfüllungsort beim Verkäufer und die Gefahr ginge auf den Rechtsanwalt über, nachdem die Ware an das Transportunternehmen übergeben worden ist. Der Rechtsanwalt müsste also zahlen, obwohl er keine Ware erhalten hat, wenn der Verkäufer nach § 243 Abs. 2 BGB seine Leistung ordnungsgemäß erbracht, nämlich die Ware gut verpackt einem anerkannten Transportunternehmen übergeben hat. In unserem Fall kommen wir durch Auslegung zu einer Schickschuld. Beide Parteien gingen davon aus, dass zu den Pflichten des Verkäufers lediglich die Absendung und nicht die Übersendung gehörte. Auch sollte der Verkäufer nicht selbst für den Transport sorgen, sondern ein Transportunternehmen mit der Aufgabe betreuen. Die Aufgabe des Verkäufers war es also, den PC sorgfältig verpackt einem geeigneten Transportunternehmen zu übergeben. Dies ist geschehen.
Pech für Rechtsanwalt Schlau.
2.4 Besonderheiten im Verbrauchsgüterkauf
Bevor aber nun Panik bei den Onlinekäufern ausbricht, die als Verbraucher Waren im Internet gekauft haben, soll gleich zur Beruhigung auf § 474 Abs. 2 BGB hingewiesen werden. Der oben vorgeführte § 447 BGB gilt nicht, wenn ein Verbraucher (§ 13 BGB) eine bewegliche Sache von einem Unternehmer (§ 14 BGB) kauft.
Das heißt, es bleibt bei dem in § 446 BGB festgelegten Grundsatz, dass die Gefahr erst mit der Übergabe der Ware an den Käufer übergeht. Der Käufer muss also nicht zahlen, wenn er die Ware nicht erhält, obwohl der Verkäufer sie an ihn geschickt hat. Dies kann auch nicht zu Lasten des Käufers in AGB oder Individualvereinbarungen anders wirksam geregelt werden. Da unser Rechtsanwalt aber nicht als Verbraucher gekauft hatte, sondern für seine Kanzlei und damit als Unternehmer, kommt er nicht in den Genuss dieser Verbraucherprivilegierung..
2.5 Anforderung an vertragliche Regelungen zum Erfüllungsort
Es ist also Käufern, die nicht als Verbraucher von einem Unternehmer kaufen, zu raten, den „*Erfüllungsort* “ im Sinne von § 447 BGB zu ihren Gunsten zu regeln. Ist dies aber nicht geschehen und ergibt sich auch nichts aus der Natur des Schuldverhältnisses (siehe oben) dann muss der Käufer, der nicht zahlen will, beweisen, dass die Parteien eine Bringschuld vereinbart haben. Hier sind die Anforderungen aber sehr hoch. So ist die Übernahme der Versandkosten alleine noch kein Indiz für eine Bringschuld, auch Klauseln wie „frei Haus x“ oder „bahnfrei“. Übernimmt aber der Verkäufer selbst oder sein Erfüllungsgehilfe den Transport, dann wird in der Regel von einer Bringschuld ausgegangen.
3. Fazit
Beim Verbrauchsgüterkauf gilt § 447 BGB nicht. Das heißt, die Gefahr geht erst über, wenn der Verbraucher die Ware erhalten hat.
Liegt kein Verbrauchsgüterkauf vor, ist beim Versendungskauf in der Regel von einer Schickschuld auszugehen. Das heißt, der Erfüllungsort ist beim Verkäufer und die Gefahr geht über, wenn der Verkäufer die Ware an seinem Geschäftssitz an ein Transportunternehmen übergeben hat.
Fragen zum Beitrag? Diskutieren Sie hierzu gerne mit uns in der Unternehmergruppe der IT-Recht Kanzlei auf Facebook.
Link kopieren
Als PDF exportieren
Per E-Mail verschicken
Zum Facebook-Account der Kanzlei
Zum Instagram-Account der Kanzlei

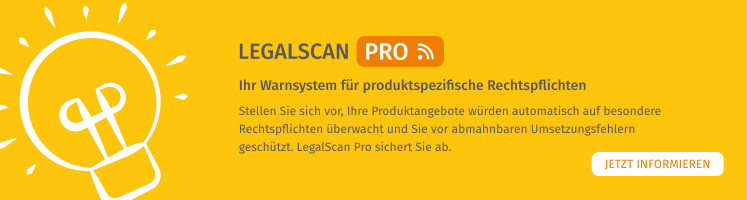
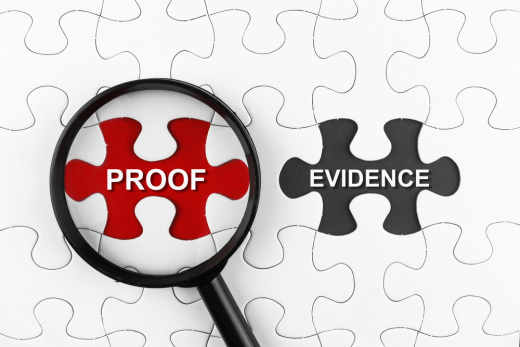

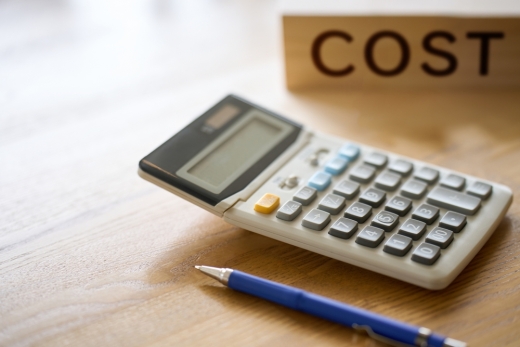
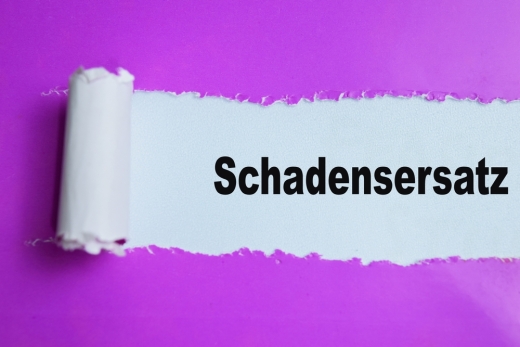
33 Kommentare
danke für die anschauliche Darstellung der Rechtslage, die "Schickschuld" war mir noch nicht bekannt.
Es dreht sich ja vieles um den Erfüllungsort und ob das Paket auf dem Versandweg verloren ging.
Folgender realer Fall:
Auf ebay wird eine Ware angeboten mit "Versand möglich", der Verkäufer übernimmt ohne Mehrkosen den Versand.
Der Verkäufer legt das Päckchen in eine Box von einer DHL-Versandstation. Lt. DHL Sendungsnachverfolgung ist die Lieferung vom Verkäufer elektronisch angekündigt und in die Box gelegt worden. Das Päckchen ist von DHL aus der Box entnommen worden und danach bricht die Statusfortschreibung ab.
D.h. das Päckchen hat das Absendezentrum von DHL nicht erreicht. Möglicherweise gab es ein Beschriftungsprobelm (was zuvor nicht überprüft werden konnte).
Ist in diesem Fall der Gefahrenübergang das Einlegen des Päckchens vom Privatverkäufers in die DHL-Box?
Bei den Transportunternehmen kommt es zu Paketbeschädigungen und -Verlusten. Wenn sich nun eine Privatperson fragt, wer die Gefahr trägt und Schäden zu ersetzen hat, findet mit diesem langen Aufsatz anfangs mittels eines einzigen aussagefähigen Satzes nicht eine etwa eine schnelle und eindeutige Antwort, sondern ein akademisches Geplänkel. Liebe Frau Anwältin, wir wissen, dass Sie intelligent sind, Sie müssen uns hier keine Doktor-Arbeit vorlegen!
Mit freundlichem Gruß
Allerdings heißt die Seite: https://www.it-recht-kanzlei.de/leistungsort-schickschuld-bringschuld-hohlschuld-versendungskauf.html
Ob der IT-Mensch auch holen mit "h" schreibt?
ist bei einem Ticketverkauf eines Fußballvereins an einen Zuschauer von einem Verbrauchsgüterverkauf auszugehen? Das heißt, geht das Risiko des Verlustes erst bei erfolgreicher Ticketzustellung auf den Kaäufer über?
Mit freundlichen Grüßen. Johannes Kupper
besten Dank für Ihre Informationen.
Für mich als Laien wäre es hilfreich, wenn Sie vor einer Bewertung die Begrifflichkeiten und Definitionen klarziehen, die für eine Bewertungszuordnung wichtig sind:
was versteht der Gesetzgeber unter einem "Verbrauchsgüterkauf" was unter einem "Nicht-Verbrauchsgüterkauf". Grundsätzlich unterliegt doch jede Sache einem gewissen Verschleiß.
Zweitens ist unklar wie das hierbei in Relation zu einer bewegliche Sache zu bringen ist.
Die Thematik mit dem Möbelkauf wurde von Ihnen wohl einem BGH-Urteil entnommen. Für mich ist unklar was Sie uns damit sagen wollen und welche generelle Auslegung damit abgeleitet werden kann. Warum haben Sie einen Unternehmer als Warenempfänger benannt? Mich verwirrt das sehr, ich denke die meisten Leser hier werden Endverbraucher sein.
Danke,
schöne Grüße,
Michael
Wer Trägt die Beweislast, welche Waren zurückgesandt wurden.
Der Verkäufer und der Lieferant berufen sich nun darauf vier Reifen geliefert zu haben. Ich war zu der nicht angekündigten Lieferzeit nicht zu Hause. Der Minderjährige ist mein Sohn.
Wer haftet nun?
Sie meinen:
"Das heißt, der Erfüllungsort ist beim Verkäufer und die Gefahr geht über, wenn der VERKÄUFER die Ware an seinem Geschäftssitz an ein Transportunternehmen übergeben hat."
Kann ich absolut nichts mehr dagegen Tun.
LG
ich habe vor 2 Wochen einen Artikel für 27€ verkauft und per unversicherten Versand abgegen. Doch 1 Woche später schreibt mir der Käufer das er einen Fehler bei seiner Lieferadresse gemacht hat undmich darum kkümmern soll, dass der Artikel dort ankommt.
Nun ist das Problem, dass das Päckchen nicht an mich zurück kam und es sich auch nicht auffindenllässt bei der DHL.
Der Käufer hat mir nun geschrieben, dass ich entweder das gesamte Geld zurück überweisen oder erestur Polizei geht.
Nun die Frage: wer ist hier ihm recht?
Vielen dank für die antworten!
Mit freundlichem Gruß
Ansonsten ein super Artikel.
Eine Frage gibt es bei mir noch und zwar wenn der Verkäufer die Ware "frei Haus" an Herrn Rechtsanwalt Schlau liefert und die Ware auf dem Transportweg verloren geht.
Wo ist bei dieser Situation der Kosten sowie Gefahrenübergang?
und
Wer und Warum muss für die verlorene Ware zahlen oder Neuliefern?
Danke im Voraus für Ihre Antwort.
MfG
M. Schubert
sehr guter Artikel! Vielen Dank!
Was ist, wenn beim Privatverkauf (Privat-Privat) eine Holschuld bestand (Paket wurde an Paketunternehmen übergeben), der Käufer die Ware aber verweigert und das Paket verloren geht.
Danke
Käufer hatte eine Mail bekommen, dass die Ware am 18.3. verschickt wurde.
Ware wurde per Brief verschickt.
Gibt es eine Frist, in der sich ein Käufer beim Verkäufer melden muss ?
Danke und viele Grüße
Gabi
ich habe gerade Ihren Artikel über den Gefahrübergang gelesen. Im abschließenden Satz sagen sie:
"Liegt kein Verbrauchsgüterkauf vor, ist beim Versendungskauf in der Regel von einer Schickschuld auszugehen. Das heißt, der Erfüllungsort ist beim Verkäufer und die Gefahr geht über, wenn der Käufer die Ware an seinem Geschäftssitz an ein Transportunternehmen übergeben hat."
Müsste es denn nicht richtig heißen, dass die Gefahr übergeht, wenn der VERKäufer die Sache an ein Transportunternehmen übergibt? Immerhin schreiben Sie dies vorher unter Punkt 2.3 in der Auflösung:
"Alles spricht für eine Schickschuld. In diesem Fall wäre der Erfüllungsort beim Verkäufer und die Gefahr ginge auf den Rechtsanwalt über, nachdem die Ware an das Transportunternehmen übergeben worden ist."
Desweiteren kann der Käufer ja auch keine Sache übergeben, da er ja eben nichts hat.
Eine kleine Anmerkung. Vielen Dank ansonsten für den hilfreichen Artikel.
Gruß
Matthias Wegmann
bezüglich des Kommentars vom 25.03. habe ich eine Frage: Gibt es einen Quellenangabe zu dieser Aussage? Ist diese Teil eines Urteils?
Vielen Dank im Voraus für einen kleinen Hinweis.
Gruss
Frank S.
danke für die interssanten Informationen.
Ich hätte ergänzend zum vorherigen Kommentar noch gern erfahren wie die Lage ist, wenn der Empfang mit dem Namen des Empfängers quittiert wird und der Empfänger dann behauptet die Unterschrift wäre nicht seine (gefälscht) und versichert die Ware nicht erhalten zu haben.
Vielen Dank im vorraus für die Antwort!
Hätte aber gern noch etwas dazu gehört, wer die Beweislast der Zustellung trägt! Im vorliegenden Fall wurde Empfangsbeleg mit anderem Namen (nicht dem Käufer) unterschrieben, Paket wurde dem Käufer auch nicht ausgehändigt, sondern ist beim Zusteller verschwunden. Zusteller legt aber Eidesstattliche Erklärung vor, dass Ware an Käufer übergeben wurde. Käufer erklärt ebenfalls an Eides statt die Ware nicht erhalten zu haben und kann auch beweisen, das er zur angegebenen Zustellzeit nicht zu Hause war.
Vielen Dank für Ihre Rückantwort!
ist die Ware geliefert. Stellt der Kunde dann später Mängel fest, stehen ihm die gesetzlichen Mängelansprüche zu. Da der Kunde Verbraucher ist, liegt die Beweislast bis zum 6. Monat nach Lieferung beim Verkäufer, dass die Ware bei Lieferung nicht mangelhaft war.
Eine Klärung wäre auch ich sehr dankbar. (info [at] la-perladonna.de)
Für eine Klärung dieser Sachlage wäre ich dankbar. (info@4all-web.de)