Widerrufsbelehrung im Online-Shop: Rechtliche Pflichten und Abmahnrisiken

Das Widerrufsrecht ist im Online-Handel Pflichtprogramm. Doch schon kleine Fehler in der Widerrufsbelehrung können rechtliche Folgen haben. Händler sollten daher genau wissen, wann und wie korrekt zu belehren ist.
Inhaltsverzeichnis
- Widerrufsrecht: Sinn und Zweck
- Widerrufsbelehrung und Haftung
- 1. Die Widerrufsbelehrung fehlt völlig
- 2. Unzureichende Widerrufsbelehrung
- Wann benötigt ein Online-Shop eine Widerrufsbelehrung?
- Ausnahmen vom Widerrufsrecht
- Wie sieht eine ordnungsgemäße Widerrufsbelehrung aus?
- 1. Angabe zur Widerrufsfrist
- 2. Weitere Pflichtangaben
- 3. Rücksendekosten
- 4. Zusätzlich zur Widerrufsbelehrung: Widerrufsformular
- Einbindung der Widerrufsbelehrung in den Online-Shop
- Fazit
Widerrufsrecht: Sinn und Zweck
Hat ein Kunde einen Artikel im Internet bestellt, steht ihm grundsätzlich ein 14-tägiges Widerrufsrecht zu.
Das Widerrufsrecht im Fernabsatz soll die Nachteile gegenüber dem stationären Handel ausgleichen und dem Verbraucher ermöglichen, die von ihm bestellte Ware einer „Prüfung“ zu unterziehen, um dann zu entscheiden, ob er sie zurückgeben oder behalten möchte.
Shop-Betreiber müssen Verbraucher hierüber umfassend informieren – und zwar durch eine rechtlich korrekt eingebundene und vollständige Widerrufsbelehrung.
Widerrufsbelehrung und Haftung
Eine fehlende oder fehlerhafte Widerrufsbelehrung gehört weiterhin zu den häufigsten Abmahngründen im E-Commerce.
Wann müssen Händler besonders wachsam sein? Und wann drohen wettbewerbsrechtliche Abmahnungen?
1. Die Widerrufsbelehrung fehlt völlig
Der „Worst Case“: Die Widerrufsbelehrung ist im Online-Shop überhaupt nicht vorhanden.
Wird der Verbraucher nicht über sein gesetzliches Widerrufsrecht informiert, kann dies dazu führen, dass er sein Widerrufsrecht nicht ausübt. Das verschafft dem Händler einen unzulässigen Wettbewerbsvorteil – und ist abmahnfähig nach dem Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb (UWG).
2. Unzureichende Widerrufsbelehrung
Das Widerrufsrecht wurde in der Vergangenheit mehrfach reformiert.
Die maßgebliche Neuregelung erfolgte im Jahr 2014. Händler, die ihre Belehrung nicht fortlaufend anpassen, riskieren schnell, mit veralteten oder unvollständigen Angaben zu arbeiten.
- Telefonnummer verpflichtend: Seit dem 13.06.2014 muss die Telefonnummer zwingend in der Widerrufsbelehrung angegeben werden. Fehlt sie, ist die Belehrung abmahnfähig (OLG Hamm, Urteil v. 24.03.2015, 4 U 30/15).
- Beginn der Widerrufsfrist: Der Händler muss eindeutig erklären, wann die Widerrufsfrist beginnt. Es ist unzulässig, mehrere Varianten aus dem Muster nebeneinander zu übernehmen, wenn dies den Verbraucher im Unklaren lässt (LG Frankfurt a.M., Beschluss v. 21.05.2015, 2-06 O 203/15).
Händler sollten daher auf Nummer sicher gehen und bereits mit Freischaltung des Online-Shops für eine rechtssichere Widerrufsbelehrung sorgen.
Wann benötigt ein Online-Shop eine Widerrufsbelehrung?
Gemäß § 312g Abs. 1 BGB steht Verbrauchern bei Fernabsatzverträgen ein Widerrufsrecht nach § 355 BGB zu.
Zu den Fernabsatzverträgen gehören nach § 312b Abs. 1 BGB Verträge über die Lieferung von Waren oder über die Erbringung von Dienstleistungen, die
- zwischen einem Unternehmer und
- einem Verbraucher
- unter ausschließlicher Verwendung von Fernkommunikationsmitteln
abgeschlossen werden.
„Fernkommunikationsmittel“ sind hierbei Kommunikationsmittel, die zur Anbahnung oder zum Abschluss eines Vertrags zwischen einem Verbraucher und einem Unternehmer ohne gleichzeitige körperliche Anwesenheit der Vertragsparteien eingesetzt werden können.
Zu den Fernkommunikationsmitteln zählen unter anderem
- Telefon
- Briefe
- Kataloge
- Faxe.
Daraus folgt für Shop-Betreiber:
Sobald Verbraucher über den Shop oder über Marktplätze wie Amazon oder eBay bestellen können, muss eine Widerrufsbelehrung bereitgestellt werden.
Ausnahmen vom Widerrufsrecht
Das Gesetz kennt zahlreiche Ausnahmen vom gesetzlichen Widerrufsrecht. Besonders relevant für Online-Händler sind folgende Fälle:
- Maßanfertigungen und personalisierte Waren (§ 312g Abs. 2 Nr. 1 BGB) : Kein Widerrufsrecht, wenn die Ware individuell für den Kunden hergestellt oder eindeutig auf dessen Bedürfnisse zugeschnitten ist.
- Schnell verderbliche Waren: Kein Widerrufsrecht bei Produkten, die rasch verderben oder deren Haltbarkeit schnell überschritten würde (z. B. Lebensmittel, Schnittblumen).
- Versiegelte Hygiene- und Gesundheitsartikel (§ 312g Abs. 2 Nr. 3 BGB) : Wird die Versiegelung nach der Lieferung entfernt, besteht kein Widerrufsrecht mehr (z. B. Arzneimittel, benutzte Hygieneartikel, bestimmte Kosmetika).
- Versiegelte Audio-, Video- oder Softwareprodukte (§ 312g Abs. 2 Nr. 6 BGB) : Öffnet der Kunde die Versiegelung, entfällt das Widerrufsrecht, um Missbrauch durch Kopieren zu verhindern.
Wie sieht eine ordnungsgemäße Widerrufsbelehrung aus?
Seit dem 13.06.2014 gilt ein einheitliches gesetzliches Muster für die Widerrufsbelehrung (Anlage 1 zu Art. 246a § 1 Abs. 2 S. 2 EGBGB) .
Es ist zwar nicht zwingend zu verwenden, wird aber aus Gründen der Rechtssicherheit dringend empfohlen.
Eine entsprechende Muster-Widerrufsbelehrung findet sich in Anlage 1 zu Artikel 246a (1) Abs. 2 S. 2 EGBGB. Diese gilt nun einheitlich in sämtlichen EU-Mitgliedstaaten.
Shop-Betreiber stellt die neue Muster-Widerrufsbelehrung vor eine große Herausforderung: Jeder Händler muss die Belehrung an zahlreichen Stellen auf den eigenen Shop individuell anpassen.
1. Angabe zur Widerrufsfrist
Eine besonders hohe Hürde müssen Shop-Betreiber bei der Belehrung über den Beginn der Widerrufsfrist nehmen.
a. Bestell- und Liefersituation ist maßgeblich für den Beginn der Widerrufsfrist
Das für Online-Händler amtliche Muster für die Widerrufsbelehrung sieht bei Fernabsatzverträgen über Waren unterschiedliche Belehrungsmöglichkeiten für den Fristbeginn vor, je nachdem, ob
- nur eine Ware oder
- mehrere Waren geliefert werden,
- die Ware in mehreren Teillieferungen geliefert wird oder
- es sich um eine einmalige oder um eine dauerhafte Warenlieferung handelt.
Daraus folgt für Shop-Betreiber: Die zu erteilende Widerrufsbelehrung muss wegen des unterschiedlichen Fristbeginns jeweils auf die einschlägige Bestellsituation zugeschnitten sein.
b. Probleme bei der Berechnung des Fristbeginns
Problematisch ist dabei der Fall, in dem der Verbraucher einheitlich mehrere Waren bestellt. Denn der Unternehmer müsste hier schon im Bestellzeitpunkt wissen, ob er diese Waren in einer Lieferung verschicken kann oder ob eine Teillieferung erforderlich werden wird, was er jedoch regelmäßig zu diesem Zeitpunkt noch gar nicht wissen kann.
Letzteres hängt zum einen davon ab, wie es um die Verfügbarkeit der Waren steht, und zum anderen davon, wie sich das „Sammeln“ mehrerer Waren auf die Versandlogistik auswirkt (z.B. Überschreitung von Höchstmaß bzw. -gewicht des Frachtführers, so dass mehrere Sendungen erforderlich werden).
c. Lösung des Problems
Teilweise wird daher empfohlen, in die Widerrufsbelehrung schlicht mehrere für den Fristbeginn relevante Varianten aus dem gesetzlichen Muster nebeneinander zu übernehmen. Diese Praxis widerspricht jedoch ganz klar dem gesetzgeberischen Gedanken, der darauf abzielt, immer nur eine Variante darzustellen.
Die andere Lösung besteht darin, nur eine Variante zu verwenden, und zwar diejenige, die vom Sinn her im Grunde auf alle denkbaren Konstellationen zutrifft: So wird für den Fristbeginn dann schlicht immer darauf abgestellt, wann die „letzte Ware“ in Besitz genommen wurde.
Die Entscheidung über den „richtigen“ Lösungsweg hat das LG Frankfurt a.M. getroffen (Beschluss vom 21.05.2015, Az.: 2-06 O 203/15). Die Richter hatten in dem Beschluss über eine Widerrufsbelehrung zu entscheiden, die dem oben geschilderten, ersten Lösungsweg mit der Darstellung mehrerer Varianten folgt. Sie stellten fest, dass eine derartige Widerrufsbelehrung, die für den Verbraucher den Eindruck erweckt, mehrere Alternativen könnten gleichzeitig eingreifen, unzulässig ist.
Shop-Betreiber stehen nun also vor der Qual der Wahl: Sie haben einerseits die Möglichkeit, mit einer „dynamischen“ Widerrufsbelehrung zu arbeiten. Eine solche dynamische Widerrufsbelehrung generiert den Textbaustein zum Widerrufsbeginn individuell anhand der jeweiligen „Warenkorbsituation“ in Echtzeit und bringt ausschließlich diese dem Verbraucher zur Anzeige. Solche lassen sich jedoch häufig nur mit viel (Zeit- und Kosten-)Aufwand implementieren.
Shop-Betreiber sollten daher möglichst – und dies ist die zweite Möglichkeit, die ihnen nach dem Gesetz zusteht – mit einer statischen Widerrufsbelehrung arbeiten. Dabei sollte die Variante gewählt werden, die praktisch die meisten relevanten Fallgestaltungen bei der Bestellung abdeckt, sprich auf den Erhalt der letzten Ware abstellt. Allerdings ist auch diese Variante unpassend, wenn es sich um einen Vertrag über eine dauerhafte Lieferung von Waren („Abonnementvertrag“) handelt.
Gerade in Fällen, in denen Online-Händler sowohl Einmallieferungen als auch dauerhafte Lieferungen anbieten, lässt sich praktisch nur mit einer Widerrufsbelehrung arbeiten, die für beide Fälle jeweils eine gesonderte Belehrung über den Beginn der Widerrufsfrist vorsieht.
2. Weitere Pflichtangaben
Des Weiteren müssen Shop-Betreiber in der Muster-Widerrufsbelehrung ihren Namen, ihre Anschrift und „soweit verfügbar“ auch Telefonnummer, Telefaxnummer und E-Mail-Adresse angeben.
Wie bereits dargestellt ist die fehlende Angabe einer Telefonnummer in der Widerrufsbelehrung ein abmahnfähiger Wettbewerbsverstoß.
3. Rücksendekosten
Grundsätzlich haben Online-Händler die Möglichkeit, dem Verbraucher die Rücksendekosten aufzuerlegen. Problematisch ist das Abwälzen der Rücksendekosten auf den Verbraucher jedoch bei nicht paketversandfähiger Speditionsware. In einem solchen Fall müssen die Kosten der Rücksendung der Ware vom Unternehmer geschätzt und in der Widerrufsbelehrung angegeben werden.
Eine entsprechende Widerrufsbelehrung müsste sich daher in ausgefeilter Form mit der Art der bestellten Ware beschäftigen. Inwieweit die entsprechenden Informationsalternativen in eine Belehrung mit aufgenommen werden können, halten wir zum jetzigen Zeitpunkt noch für vollkommen ungeklärt.
4. Zusätzlich zur Widerrufsbelehrung: Widerrufsformular
Zusätzlich zur Widerrufsbelehrung müssen Shop-Betreiber für den Verbraucher ein Widerrufsformular bereitstellen. Dieses soll dem Verbraucher die Möglichkeit geben, seinen Widerruf möglichst einfach mit Hilfe des bereitgestellten Formulars zu erklären. Auch beim Widerrufsformular steckt jedoch der Teufel im Detail: Shop-Betreiber müssen einiges beachten, damit das Widerrufsformular rechtssicher in den Online-Shop implementiert wird.
Wir haben in unseren FAQ zu dem Widerrufsformular alle notwendigen Informationen zusammengestellt.ΩΩZ
Einbindung der Widerrufsbelehrung in den Online-Shop
Genauso wichtig wie der korrekte Inhalt der Widerrufsbelehrung ist die rechtssichere Einbindung der Widerrufsbelehrung in das Shop-System.
Doch wann und wo muss der Shop-Betreiber den Verbraucher über das Widerrufsrecht belehren?
Eine Antwort auf diese Frage gibt Art. 246a, § 4 Abs. 1 EGBGB n.F. Danach sind die Informationen über das Widerrufsrecht „vor Abgabe der Vertragserklärung des Verbrauchers in klarer und verständlicher Form zu erteilen“. Zudem stellt das Gesetz in Art. 246a, § 4 Abs. 3 Satz 1 EGBGB n.F. die Anforderung auf, dass die Informationen zum Widerrufsrecht in einer dem benutzten Fernkommunikationsmittel angepassten Weise zur Verfügung zu stellen sind, z.B. durch Hinterlegung auf einer eindeutig bezeichneten (und verlinkten) Informationsseite.
Aus § 312d Abs. 1 Satz 1, 2 n.F., § 312f Abs. 2 n.F. i.V.m. Art. 246a EGBGB n.F. ergibt sich zudem die nachvertragliche Pflicht zur Überlassung der Informationspflichten (inkl. der Widerrufsbelehrung) auf einem dauerhaften Datenträger, mithin als Email-Text, PDF-Dokument oder in Papierform.
Das Widerrufsformular sollte sich ebenfalls auf der Onlineshop-Seite, bestenfalls in unmittelbarer räumlicher Nähe zur Widerrufsbelehrung befinden.
Fazit
Abmahnungen wegen fehlender oder unzureichender Widerrufsbelehrungen sind hierzulande ein Dauerbrenner.
Shop-Betreiber sollten daher auf Nummer sicher gehen und sich rechtzeitig mit dem Thema Widerrufsbelehrung auseinander setzen.
Fragen zum Beitrag? Diskutieren Sie hierzu gerne mit uns in der Unternehmergruppe der IT-Recht Kanzlei auf Facebook.
Link kopieren
Als PDF exportieren
Per E-Mail verschicken
Zum Facebook-Account der Kanzlei
Zum Instagram-Account der Kanzlei

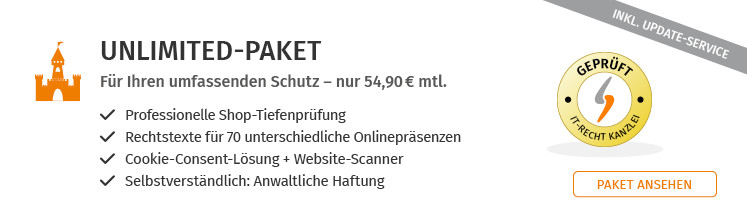




0 Kommentare