Rechtliche Vorgaben für den Online-Vertrieb verschreibungspflichtiger Arzneimittel

Der Versandhandel mit verschreibungspflichtigen Arzneimitteln in Deutschland ist stark reguliert und setzt die Kenntnis einiger rechtlicher Sondervorschriften voraus. Wir geben hierzu einen Überblick.
Inhaltsverzeichnis
- Rechtliche Grundlagen
- Zulässigkeitsvoraussetzungen
- 1. Erlaubnispflicht und Nachweis eines Qualitätssicherungssystems
- 2. Registrierung im Versandhandelsregister und Sicherheitslogo
- Das E-Rezept
- 1. Verpflichtende Anbindung an die Telematikinfrastruktur (TI)
- 2. Korrekte Abwicklung der E-Rezept-Einlösung
- 3. Prüf-, Abwicklungs- und Archivierungspflichten
- Qualitätssicherung
- 1. Anforderungen an Lagerung und Kommissionierung
- 2. Transport
- 3. Dokumentations- und Nachweispflichten
- Fälschungsschutz
- 1. Umsetzung der EU-Fälschungsrichtlinie (FMD)
- 2. Verifizierung und Ausbuchung
- 3. Umgang mit Systemausfällen und Alarmmeldungen
- Pharmazeutische Beratung und Telepharmazie
- Werbe- und Preisrechtliche Vorgaben
- 1. Publikumswerbeverbot
- 2. Zuwendungsverbot
- 3. Preisbindung
- Datenschutzrechtliche Anforderungen
- 1. Verarbeitung besonderer Kategorien personenbezogener Daten
- 2. Pflicht zur Bestellung eines Datenschutzbeauftragten
- 3. IT-Sicherheit und Patientendaten-Schutz-Gesetz (PDSG)
- Besondere Pflichten für den Online-Handel
- 1. Fernabsatzrechtliche Informationspflichten
- 2. Verwendung angepasster AGB
- 3. Widerrufsrecht für Verbraucher
- 4. Preisangaben
- Rechtsfolgen bei Nichteinhaltung
- 1. Wettbewerbsrechtliche Sanktionen
- 2. Bußgeld- und Straftatbestände nach AMG und HWG
- 3. Risiko des Widerrufs der Versandhandelserlaubnis
- Checkliste für den Online-Handel
Rechtliche Grundlagen
Die rechtliche Grundlage für den Verkehr mit verschreibungspflichtigen Arzneimitteln in Deutschland wird primär durch
- das Arzneimittelgesetz (AMG),
- das Apothekengesetz (ApoG),
- die Apothekenbetriebsordnung (ApBetrO),
- das Heilmittelwerbegesetz (HWG) sowie
- die Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) definiert.
Für den Fernabsatz sind darüber hinaus besondere Vorschriften aus dem BGB sowie dem EGBGB zu beachten, die in erster Linie dem Verbraucherschutz dienen.
Zulässigkeitsvoraussetzungen
Der Betrieb eines Online-Shops für verschreibungspflichtige Arzneimittel ist untrennbar mit der Existenz und der Compliance einer dahinterstehenden Präsenzapotheke verbunden. Die Versandhandelserlaubnis ist akzessorisch zur Betriebserlaubnis einer stationären Apotheke. Dies bedeutet, dass jeder Versandhändler physisch über eine voll ausgestattete stationäre Apotheke verfügen muss, die den Anforderungen der Apothekenbetriebsordnung (ApBetrO) genügt.
1. Erlaubnispflicht und Nachweis eines Qualitätssicherungssystems
Für den Versandhandel mit verschreibungspflichtigen Arzneimitteln ist eine gesonderte Erlaubnis nach dem Apothekengesetz erforderlich, welche die Sicherstellung eines Qualitätssicherungssystems voraussetzt.
Konkret regelt § 11a ApoG hierzu Folgendes:
Die Erlaubnis zum Versand von apothekenpflichtigen Arzneimitteln gemäß § 43 Abs. 1 Satz 1 des Arzneimittelgesetzes ist dem Inhaber einer Erlaubnis nach § 2 auf Antrag zu erteilen, wenn er schriftlich oder elektronisch versichert, dass er im Falle der Erteilung der Erlaubnis folgende Anforderungen erfüllen wird:
1. Der Versand wird aus einer öffentlichen Apotheke zusätzlich zu dem üblichen Apothekenbetrieb und nach den dafür geltenden Vorschriften erfolgen, soweit für den Versandhandel keine gesonderten Vorschriften bestehen.
2. Mit einem Qualitätssicherungssystem wird sichergestellt, dass
a) das zu versendende Arzneimittel so verpackt, transportiert und ausgeliefert wird, dass seine Qualität und Wirksamkeit erhalten bleibt,
b) das versandte Arzneimittel der Person ausgeliefert wird, die von dem Auftraggeber der Bestellung der Apotheke mitgeteilt wird. Diese Festlegung kann insbesondere die Aushändigung an eine namentlich benannte natürliche Person oder einen benannten Personenkreis beinhalten,
c) die Patientin oder der Patient auf das Erfordernis hingewiesen wird, mit dem behandelnden Arzt Kontakt aufzunehmen, sofern Probleme bei der Medikation auftreten und
d) die Beratung durch pharmazeutisches Personal in deutscher Sprache erfolgen wird.
3. Es wird sichergestellt, dass
a) innerhalb von zwei Arbeitstagen nach Eingang der Bestellung das bestellte Arzneimittel versandt wird, soweit das Arzneimittel in dieser Zeit zur Verfügung steht, es sei denn, es wurde eine andere Absprache mit der Person getroffen, die das Arzneimittel bestellt hat; soweit erkennbar ist, dass das bestellte Arzneimittel nicht innerhalb der in Satz 1 genannten Frist versendet werden kann, ist der Besteller in geeigneter Weise davon zu unterrichten,
b) alle bestellten Arzneimittel geliefert werden, soweit sie im Geltungsbereich des Arzneimittelgesetzes in den Verkehr gebracht werden dürfen und verfügbar sind,
c) für den Fall von bekannt gewordenen Risiken bei Arzneimitteln ein geeignetes System zur Meldung solcher Risiken durch Kunden, zur Information der Kunden über solche Risiken und zu innerbetrieblichen Abwehrmaßnahmen zur Verfügung steht,
d) eine kostenfreie Zweitzustellung veranlasst wird,
e) ein System zur Sendungsverfolgung unterhalten wird und
f) eine Transportversicherung abgeschlossen wird.
Im Falle des elektronischen Handels mit apothekenpflichtigen Arzneimitteln gilt Satz 1 mit der Maßgabe, dass die Apotheke auch über die dafür geeigneten Einrichtungen und Geräte verfügen wird.
Zur Konkretisierung der Anforderungen an das Qualitätssicherungssystem kann die Leitlinie der Bundesapothekerkammer zur Qualitätssicherung herangezogen werden. Diese enthält Empfehlungen für apothekerliches Handeln in charakteristischen Situationen und gibt eine Hilfestellung bei der Formulierung der betriebsspezifischen Prozesse im Rahmen des Qualitätssicherungssystems nach § 2a ApBetrO.
Das Qualitätssicherungssystem muss alle Schritte von der Bestellung bis zur Auslieferung des Arzneimittels an den Patienten abdecken. Die zuständigen Behörden (Apothekerkammern oder Landesbehörden) überprüfen die Einhaltung der Bestimmungen des Apothekengesetzes routinemäßig durch amtliche Besichtigungen. Das Fehlen oder die mangelhafte Ausgestaltung des Qualitätssicherungssystems kann gemäß § 11b ApoG zum Widerruf der Erlaubnis führen.
2. Registrierung im Versandhandelsregister und Sicherheitslogo
Jede Apotheke, die am Versandhandel teilnimmt, ist verpflichtet, sich im nationalen Versandhandelsregister des Bundesinstituts für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM) registrieren zu lassen. Diese Registrierungspflicht dient der Transparenz und der Überwachung und ermöglicht es Verbrauchern, die Legalität des jeweiligen Anbieters zu überprüfen.
Darüber hinaus müssen registrierte Versandapotheken das EU-Sicherheitslogo auf ihrer Website führen, das auf ihren Eintrag im nationalen Register verlinkt.
Das Logo muss auf jeder Seite des Webshops eingebunden sein, auf der Arzneimittel angeboten werden. Es darf kein statisches Bild sein. Es muss technisch so verlinkt sein, dass ein Klick direkt auf den Registereintrag der spezifischen Apotheke beim BfArM führt. Ein "toter Link" oder ein statisches Bild können als Irreführung der Verbraucher und Verstoß gegen § 11a ApoG kostenpflichtig abgemahnt werden.
Das E-Rezept
Die flächendeckende Einführung des elektronischen Rezepts (E-Rezept), welches das herkömmliche Papierrezept für verschreibungspflichtige Arzneimittel abgelöst hat, stellt die Versandapotheken vor neue juristische und technische Anforderungen.
1. Verpflichtende Anbindung an die Telematikinfrastruktur (TI)
Apotheken sind durch das Digitale-Versorgung-Gesetz (DVG) verpflichtet, sich an die Telematikinfrastruktur (TI) des deutschen Gesundheitswesens anzuschließen. Dieser Anschluss ist die zwingende Voraussetzung, um E-Rezepte sicher und verschlüsselt verarbeiten zu können.
Die Abwicklung von E-Rezepten setzt zwingend den Einsatz eines Heilberufsausweises (HBA) zur Erzeugung einer qualifizierten elektronischen Signatur (QES) voraus. Der HBA ist dabei stets an die Person des Apothekers gebunden und nicht an die Institution Apotheke. Der Schutz der Patientendaten ist dabei das oberste Gebot.
2. Korrekte Abwicklung der E-Rezept-Einlösung
E-Rezepte können auf verschiedenen Wegen eingelöst werden:
- mittels der E-Rezept-App der Gematik (oder der Krankenkasse),
- durch Vorlage der elektronischen Gesundheitskarte (eGK) in der Apotheke, oder
- über einen vom Arzt ausgestellten Papierausdruck mit QR-Code.
Für den Versandhandel ist die Methode über „eHealth-CardLink“ von besonderer Bedeutung. Diese Technologie erlaubt die Einlösung des E-Rezepts in den Apps der Versandapotheken unter Nutzung der kontaktlosen eGK, ohne dass eine PIN benötigt wird.
Das Card-Link-Verfahren hat sich inzwischen als der Standard für den Fernabsatz etabliert. Es erlaubt Apotheken, über ihre eigenen Apps die eGK des Patienten auszulesen, um den E-Rezept-Token aus der Telematikinfrastruktur (TI) abzurufen, ohne dass der Patient eine PIN benötigt.
3. Prüf-, Abwicklungs- und Archivierungspflichten
Vor der Abgabe des Arzneimittels muss die Versandapotheke die Gültigkeit und die ordnungsgemäße Ausstellung der Verordnung über die Telematikinfrastruktur prüfen. Dies entspricht der gesetzlichen Pflicht zur Prüfung der ärztlichen Verschreibung, wie sie die ApBetrO verlangt. Das Arzneimittel darf nur bei erfolgreicher Prüfung abgegeben werden. Im Falle von Abweichungen von der ärztlichen Verordnung, etwa bei der Packungsgröße oder -anzahl aufgrund von Nichtlieferbarkeit, ist dem Apotheker ein Spielraum eingeräumt, sofern die verordnete Gesamtmenge des Wirkstoffs nicht überschritten wird.
Die digitalen Verordnungsdaten müssen revisionssicher archiviert werden. Die Apotheke muss die relevanten Unterlagen, einschließlich der Archivierung des E-Rezepts, mindestens bis ein Jahr nach Ablauf des Verfalldatums des abgegebenen Arzneimittels, jedoch nicht weniger als fünf Jahre lang, in der Apotheke aufbewahren (§ 22 Abs. 1 ApBetrO). Die Dokumentation muss alle notwendigen Patientendaten (Name, Geburtsdatum, Adresse) und die Daten des verschreibenden Arztes enthalten.
Qualitätssicherung
Versandapotheken müssen einige Maßnahmen zur Qualitätssicherung ergreifen, um die Qualität und Wirksamkeit der Produkte während des gesamten Vertriebsprozesses zu garantieren.
1. Anforderungen an Lagerung und Kommissionierung
Die Vorratsbehältnisse für Arzneimittel und Ausgangsstoffe müssen so beschaffen sein, dass eine Beeinträchtigung der Inhaltsqualität ausgeschlossen ist. Die Behältnisse müssen dauerhaft und gut lesbar mit einer gebräuchlichen wissenschaftlichen Bezeichnung, dem Verfalldatum (oder Nachprüfdatum) und der Chargenbezeichnung gekennzeichnet sein (§ 16 ApBetrO).
Vor der Abgabe muss die Apotheke die Angaben auf den Fertigarzneimitteln, einschließlich der Zulassungsnummer, der Chargenbezeichnung und der korrekten Bezeichnung, sorgfältig prüfen und protokollieren (§ 12 ApBetrO).
2. Transport
Der Transport von Arzneimitteln durch Versandapotheken muss den hohen Standards gemäß den GDP-Leitlinien der Europäischen Kommission) entsprechen, um den Erhalt der Arzneimittelqualität bis zum Patienten sicherzustellen.
Die GDP-Leitlinien der Europäischen Kommission (Good Distribution Practice) sind Vorschriften für den Großhandelsvertrieb von Humanarzneimitteln, die seit dem 5. November 2013 gelten und die Qualität sowie die Sicherheit von Arzneimitteln in der gesamten Lieferkette sicherstellen sollen. Die Hauptziele sind, das Eindringen von Fälschungen zu verhindern und sicherzustellen, dass Arzneimittel während des Transports nicht beeinträchtigt werden. Diese Leitlinien sind für alle an der Distribution Beteiligten bindend, darunter Hersteller, Großhändler, Logistikunternehmen und Apotheken.
Die Einhaltung der GDP-Anforderungen ist nicht nur eine regulatorische Pflicht, sondern eine Frage der Haftung. Ein mangelhafter Transport, der zu einer Unterbrechung der Kühlkette führt, kann die Qualität des Arzneimittels beeinträchtigen. Die Versandapotheke haftet für die Qualität des Produkts bis zur Übergabe an den Patienten. Ein Verstoß kann schwerwiegende Konsequenzen, einschließlich Bußgelder nach dem AMG und zivilrechtliche Haftungsansprüche, nach sich ziehen.
3. Dokumentations- und Nachweispflichten
Die Versandapotheke ist zu einer umfassenden Dokumentation des gesamten Versandvorgangs verpflichtet. Dazu gehört die schriftliche oder digitale Dokumentation der Prüfung der Bestellung gegen die ärztliche Verschreibung sowie der Details zur Verpackung und zum eigentlichen Versand für jede einzelne Sendung.
Der juristisch zwingende Nachweis erstreckt sich auch auf die Überwachungsprotokolle der Kühlkette (Log-Files oder Temperaturbescheinigungen), die bestätigen, dass die Produkte unter angemessenen Temperaturbedingungen transportiert wurden. Diese Dokumentation muss gemäß § 22 Abs. 1 ApBetrO revisionssicher aufbewahrt werden.
Fälschungsschutz
Die Umsetzung der EU-Fälschungsrichtlinie (Falsified Medicines Directive, FMD) und die damit verbundene Pflicht zur Echtheitsprüfung über das securPharm-System sind zentrale Compliance-Anforderungen im Versandhandel mit verschreibungspflichtigen Arzneimitteln.
1. Umsetzung der EU-Fälschungsrichtlinie (FMD)
Die Fälschungsrichtlinie schreibt vor, dass die meisten verschreibungspflichtigen Humanarzneimittel mit individuellen Sicherheitsmerkmalen, bestehend aus einem individuellen Erkennungsmerkmal und einem Erstöffnungsschutz (z. B. Klebesiegel), ausgestattet sein müssen. Das individuelle Erkennungsmerkmal besteht aus Produktcode (PC), einer individuellen Seriennummer (SN) sowie Chargenbezeichnung (LOT) und Verfalldatum (EXP). Es wird in zwei Formen auf der Packung aufgebracht: Klarschriftlich und in einem zweidimensionalen Data Matrix Code (2D-Code).
Apotheken müssen sich an das nationale Verifizierungssystem securPharm anschließen. securPharm ist ein System zur Überprüfung der Echtheit von Arzneimitteln beim Großhandel, im Krankenhaus und in der Apotheke. Das securPharm-System wird vom gleichnamigen Verein securPharm e.V. betrieben.
2. Verifizierung und Ausbuchung
Arzneimittel, die der Verifizierungspflicht unterliegen und die ab dem 9. Februar 2019 für den Verkehr freigegeben wurden, dürfen nur nach erfolgreicher Echtheitsprüfung und anschließender Ausbuchung (Decommissioning) abgegeben werden.
Der Prozess beinhaltet das Scannen des Data Matrix Codes, wodurch die Seriennummer gegen das zentrale System abgeglichen wird. Die Apothekensoftware muss die Verifizierungspflicht automatisch erkennen. Die erfolgreiche Ausbuchung bestätigt die Echtheit und markiert die Packung als aus der legalen Lieferkette entnommen.
3. Umgang mit Systemausfällen und Alarmmeldungen
Die rechtlichen Vorgaben sehen auch Notfallszenarien vor: Bei vorübergehenden technischen Störungen zum Zeitpunkt der Abgabe (z.B. Internet- oder Stromausfall) ist es gemäß Artikel 29 DVO gestattet, Arzneimittel abzugeben. Jedoch besteht die unbedingte Pflicht, die Verifizierung und Ausbuchung nachträglich durchzuführen, sobald die Störungen behoben sind. Hierzu muss die Seriennummer bei der Abgabe notiert oder der Data Matrix Code abfotografiert werden, um die Packung später manuell auszubuchen.
Ein Fälschungsalarm stellt einen Compliance-kritischen Moment dar. Er begründet den Verdacht einer Fälschung. Die Apotheke ist aufgrund des Arzneimittelgesetzes verpflichtet, das Inverkehrbringen des Arzneimittels umgehend zu unterbinden. Die Packung darf in diesem Fall keinesfalls an den Kunden versendet werden. Die korrekte Verfahrensanweisung der Apotheke muss die sofortige Information der zuständigen Behörde umfassen. Die Abgabe eines Arzneimittels trotz Fälschungsalarm oder der Verstoß gegen die Verifizierungspflicht sind schwerwiegende Ordnungswidrigkeiten und können den Entzug der Betriebserlaubnis zur Folge haben, da die unmittelbare Patientensicherheit betroffen ist.
Pharmazeutische Beratung und Telepharmazie
§ 17 der Apothekenbetriebsordnung (ApBetrO) schreibt vor, dass die pharmazeutische Beratung auch im Distanzhandel sichergestellt sein muss.
Die Versandapotheke muss sicherstellen, dass Patienten eine Beratung durch pharmazeutisches Personal (Apotheker, PTA) in Anspruch nehmen können. Hierzu muss eine Telefonnummer (keine Mehrwertrufnummer) angegeben werden, die zu üblichen Geschäftszeiten erreichbar ist.
Erkennt der Apotheker bei der Rezeptprüfung ein pharmazeutisches Problem (Interaktion, Kontraindikation, Überdosierung), muss er den Patienten aktiv kontaktieren, bevor die Ware versendet wird. Ein bloßer Beipackzettel reicht nicht aus. Die Lieferung muss im Zweifel zurückgehalten werden bis die Rücksprache mit Arzt oder Patient erfolgt ist.
Digitale Beratungsformen, wie Chat- oder Videotelefonie (Telepharmazie), können zur Erfüllung der Beratungspflicht genutzt werden, wobei die Verbindung sicher und verschlüsselt sein muss.
Werbe- und Preisrechtliche Vorgaben
Für den Handel mit Arzneimitteln gelten einige Sondervorschriften im Bereich der Werbung und der Preisgestaltung, die in der Praxis immer wieder zu Abmahnungen führen.
1. Publikumswerbeverbot
Gemäß § 10 Abs. 1 HWG gilt für verschreibungspflichtige Arzneimittel ein striktes Werbeverbot gegenüber dem Laienpublikum. Werbung ist nur bei Ärzten, Zahnärzten, Tierärzten, Apothekern und Personen zulässig, die erlaubterweise mit diesen Arzneimitteln Handel treiben (Fachkreise).
Der Begriff der Werbung wird von der Rechtsprechung extrem weit ausgelegt. Jede anpreisende, lobende oder hervorhebende Darstellung ist Werbung.
Beispiele:
- Farbliche Hervorhebungen ("Tipp!", "Bestseller").
- "Kunden kauften auch..."-Empfehlungen, die verschreibungspflichtige Arzneimittel anzeigen.
- Abbildung von glücklichen Patienten neben der Arzneimittel-Packung.
- Verwendung von "Disease Awareness"-Kampagnen, die zu stark auf ein bestimmtes Produkt hindeuten.
Im Kontext eines Online-Shops ist zu beachten, dass jede anpreisende oder über die neutrale, sachliche Beschreibung hinausgehende Information, die sich an Endverbraucher richtet, als unzulässige Publikumswerbung gewertet werden kann. Dies schließt auch optimierte SEO-Texte oder Bannerwerbung ein, die außerhalb des geschlossenen Fachbereichs präsentiert werden.
Auch der Einsatz von Influencern in Social Media ist in diesem Zusammenhang verboten.
2. Zuwendungsverbot
Gemäß § 7 Abs. 1 S. 1 HWG ist es bis auf wenige Ausnahmen unzulässig, im Zusammenhang mit dem Vertrieb von Arzneimitteln Zuwendungen und sonstige Werbegaben (Waren oder Leistungen) anzubieten, anzukündigen oder zu gewähren oder als Angehöriger der Fachkreise anzunehmen.
Selbst geringwertige Zugaben wie z. B. Fruchtgummis können unzulässig sein, wenn sie dazu geeignet sind, die Therapieentscheidung unsachlich zu beeinflussen oder den Kunden zur Bestellung zu locken.
3. Preisbindung
Inländische Apotheken sind an die arzneimittelrechtliche Preisbindung gebunden (§ 78 AMG, § 3 AMPreisV).
Der EuGH (Az.: C-148/ 15) erklärte im Jahr 2016 die deutsche Preisbindung für verschreibungspflichtige Arzneimittel für ausländische Versandapotheken für EU-rechtswidrig. Der EuGH entschied, dass die Preisbindung als Beschränkung des freien Warenverkehrs gegen EU-Recht verstößt und daher auf ausländische Anbieter nicht angewendet werden dürfe. Als Reaktion auf das Urteil führte die deutsche Bundesregierung im Jahr 2020 im "Gesetz für den Schutz der gesetzlich Versicherten" ein generelles Boniverbot für verschreibungspflichtige Medikamente ein.
Die Regelung gilt nur für gesetzlich Versicherte und verschreibungspflichtige Medikamente. Bei nicht-verschreibungspflichtigen Medikamenten und für Privatpatienten sind Boni weiterhin erlaubt.
Datenschutzrechtliche Anforderungen
Der Versandhandel mit Arzneimitteln beinhaltet die Verarbeitung von Gesundheitsdaten, die nach Art. 9 DSGVO als besondere Kategorien personenbezogener Daten den höchsten Schutz genießen.
1. Verarbeitung besonderer Kategorien personenbezogener Daten
Daten, die im Zusammenhang mit der Bestellung von Arzneimitteln entstehen, fallen unter die besonders schützenswerten Gesundheitsdaten im Sinne von Art. 9 DSGVO. Selbst wenn nur rezeptfreie Arzneimittel bestellt werden, können die Bestellhistorien Rückschlüsse auf den Gesundheitszustand erlauben.
Die Verarbeitung dieser sensiblen Daten ist grundsätzlich untersagt, es sei denn, es liegt eine spezifische Ausnahme vor, beispielsweise die ausdrückliche und informierte Einwilligung des Betroffenen.
Der BGH hat entschieden, dass die unzureichende Einholung einer solchen ausdrücklichen Einwilligung einen Datenschutzverstoß darstellt, der gleichzeitig wettbewerbsrechtlich abmahnbar ist. Die Einhaltung der DSGVO ist somit eine direkte Compliance-Anforderung im Wettbewerb.
2. Pflicht zur Bestellung eines Datenschutzbeauftragten
Aufgrund der regelmäßigen und systematischen Verarbeitung sensibler Patientendaten (Art. 9 DSGVO) besteht für viele Apotheken, insbesondere für Versandapotheken, die Pflicht zur Bestellung eines betrieblichen Datenschutzbeauftragten (bDSB) nach dem Bundesdatenschutzgesetz.
Die Verantwortung für die Gestaltung der EDV, die Informationsabläufe und die Abschottung gegen unberechtigte Kenntnisnahmen obliegt dem Apothekenleiter. Der bDSB unterstützt bei der Umsetzung der notwendigen technischen und organisatorischen Maßnahmen (TOMs).
3. IT-Sicherheit und Patientendaten-Schutz-Gesetz (PDSG)
Die Anbindung an die Telematikinfrastruktur (TI) und die Verarbeitung des E-Rezepts erfordern die Einhaltung höchster IT-Sicherheitsstandards, die im Patientendaten-Schutz-Gesetz (PDSG) verankert sind.
Das PDSG sorgt dafür, dass digitale Angebote wie das E-Rezept oder die elektronische Patientenakte genutzt werden können. Zugleich stellt es klare Regeln für den Datenschutz und die Datensicherheit auf.
Besondere Pflichten für den Online-Handel
Für den Vertrieb von verschreibungspflichtigen Arzneimitteln im Online-Handel sind weitere Besonderheiten zu beachten.
1. Fernabsatzrechtliche Informationspflichten
Gemäß Art. 246a § 1 EGBGB i. V. m. § 312d Abs. 1 BGB sind Unternehmer verpflichtet, Verbrauchern im Fernabsatz insbesondere Informationen zur Verfügung zu stellen
- zur Identität des Unternehmens,
- zu den Zahlungs-, Liefer- und Leistungsbedingungen,
- zum Bestehen eines gesetzlichen Mängelhaftungsrechts,
- gegebenenfalls, zu außergerichtlichen Beschwerde- und Rechtsbehelfsverfahren, die der Verbraucher nutzen kann,
- zum Bestehen oder Nichtbestehen eines gesetzlichen Widerrufsrechts.
Ferner müssen Unternehmer Verbraucher gemäß Art. 246c EGBGB im elektronischen Geschäftsverkehr zusätzlich unterrichten
- über die einzelnen technischen Schritte, die zu einem Vertragsschluss führen,
- darüber, ob der Vertragstext nach dem Vertragsschluss von dem Unternehmer gespeichert wird und ob er dem Kunden zugänglich ist,
- darüber, wie er mit den nach § 312i Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 des Bürgerlichen Gesetzbuchs zur Verfügung gestellten technischen Mitteln Eingabefehler vor Abgabe der Vertragserklärung erkennen und berichtigen kann,
- über die für den Vertragsschluss zur Verfügung stehenden Sprachen und
- über sämtliche einschlägigen Verhaltenskodizes, denen sich der Unternehmer unterwirft, sowie über die Möglichkeit eines elektronischen Zugangs zu diesen Regelwerken.
2. Verwendung angepasster AGB
Die Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) des Online-Shops müssen die Besonderheiten des Arzneimittelvertriebs abbilden. Insbesondere darf die Produktdarstellung im Online-Katalog grundsätzlich nur einen unverbindlichen Online-Katalog und kein rechtlich bindendes Angebot der Apotheke darstellen. Die Apotheke muss sich die letzte Prüfung und Entscheidung über die Abgabe der verschreibungspflichtigen Arzneimittel vorbehalten.
Zudem sind bei den Regelungen zur Lieferzeit die rechtlichen Vorgaben des § 11a S. 1 Nr. 3a ApoG zu beachten, wonach sicherzustellen ist, dass innerhalb von zwei Arbeitstagen nach Eingang der Bestellung das bestellte Arzneimittel versandt wird, soweit das Arzneimittel in dieser Zeit zur Verfügung steht, es sei denn, es wurde eine andere Absprache mit der Person getroffen, die das Arzneimittel bestellt hat.
3. Widerrufsrecht für Verbraucher
Verbraucher müssen über das Bestehen oder Nichtbestehen eines gesetzlichen Widerrufsrechts informiert werden. Da es sich bei Arzneimitteln in der Regel um Hygieneartikel im Sinne des § 312g Abs. 2 Nr. 3 BGB handelt, für die das Widerrufsrecht unter bestimmten Voraussetzungen ausgeschlossen ist, muss die Versandapotheke ggf. über den Ausschluss des Widerrufsrechts informieren.
Das Widerrufsrecht besteht, soweit die Parteien nichts anderes vereinbart haben, nicht bei Verträgen zur Lieferung versiegelter Waren, die aus Gründen des Gesundheitsschutzes oder der Hygiene nicht zur Rückgabe geeignet sind, wenn ihre Versiegelung nach der Lieferung entfernt wurde.
Damit der Ausschluss des Widerrufsrechts greift, müssen kumulativ drei Voraussetzungen vorliegen:
- Der Artikel muss mit einer Versiegelung an den Verbraucher geliefert werden.
- Die Versiegelung muss nach der Lieferung entfernt worden sein.
- Der Artikel darf aus Gründen des Gesundheitsschutzes oder der Hygiene nicht zur Rückgabe geeignet sein.
Gerade im Hinblick auf die dritte Voraussetzung gibt es in der Praxis immer wieder Fehleinschätzungen von Seiten der Unternehmer. So fallen längst nicht alle Produkte, von denen man es erwarten könnte, in diese Kategorie. Dies zeigen einige Beispiele aus der Rechtsprechung, die wir in diesem Beitrag behandeln.
4. Preisangaben
Hinsichtlich der Preisangaben ist zu beachten, dass die Preisangabenverordnung (PAngV) keine Anwendung auf verschreibungspflichtige Arzneimittel findet. Der Grund hierfür liegt in dem umfassenden Publikumswerbeverbot nach dem Heilmittelwerbegesetz (HWG), das eine Preiswerbung für diese Produkte untersagt (siehe oben).
Rechtsfolgen bei Nichteinhaltung
1. Wettbewerbsrechtliche Sanktionen
Verstöße gegen die Werbebeschränkungen (§ 10 HWG), das Zugabenverbot (AMPreisV), die Datenschutzanforderungen (DSGVO) und/oder die fernabsatzrechtlichen Informationspflichten (EGBGB) können in der Praxis zu wettbewerbsrechtlichen Abmahnungen, primär durch Mitbewerber oder Industrieverbände führen. Die Rechtsfolgen umfassen die Abgabe strafbewehrter Unterlassungserklärungen, die Zahlung von Anwaltskosten und das Risiko von Vertragsstrafen.
2. Bußgeld- und Straftatbestände nach AMG und HWG
Schwerwiegende Verstöße gegen die heilmittelrechtlichen Vorschriften können als Ordnungswidrigkeiten oder Straftatbestände sanktioniert werden. Unzulässige Werbung für verschreibungspflichtige Arzneimittel (§ 10 HWG) gilt als Ordnungswidrigkeit. Ebenso können Verstöße gegen das Verbringungsverbot (§ 73 AMG) oder die Pflichten zur Fälschungssicherheit mit Bußgeldern und in schweren Fällen mit strafrechtlichen Sanktionen belegt werden.
3. Risiko des Widerrufs der Versandhandelserlaubnis
Die schwerwiegendste administrative Sanktion ist der Widerruf der Versandhandelserlaubnis gemäß § 11b ApoG. Dieser droht bei massiven und wiederholten Verstößen gegen die Einhaltung der ApBetrO und des ApoG, insbesondere bei schwerwiegenden Mängeln im Qualitätssicherungssystem (z.B. bei der Nichteinhaltung der Kühlkette oder der mangelhaften pharmazeutischen Beratung). Wird die Versandhandelserlaubnis widerrufen, darf kein Versandhandel mit verschreibungspflichtigen Arzneimitteln mehr betrieben werden.
Checkliste für den Online-Handel
Apotheken sollten vor der Aufnahme des Online-Handels mit verschreibungspflichtigen Arzneimitteln insbesondere folgende Punkte beachten:
1) Liegt eine gültige Versandhandelserlaubnis vor, und ist der Shop im nationalen Versandhandels-Register des Bundesinstituts für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM) korrekt gelistet und über das EU-Logo verlinkt?
2) Ist das Qualitätssicherungssystem nach BAK-Leitlinie implementiert, und wird die Kühlkette (Temperaturprotokolle, qualifizierte Verpackung) lückenlos dokumentiert?
3) Ist die Anbindung an die Telematikinfrastruktur nach DVG/PDSG sichergestellt?
4) Wird die kostenlose, pharmazeutische Beratung vor Abgabe angeboten und kann diese auch technisch durchgeführt werden?
5) Erfolgt die Verifizierung und Ausbuchung über securPharm zwingend vor Abgabe, und existieren Notfallprozeduren für Systemausfälle?
6) Wird strikt auf Publikumswerbung (§ 10 HWG) und die Gewährung jeglicher Zugaben oder Boni (AMPreisV) verzichtet?
7) Erfolgt die Verarbeitung von Gesundheitsdaten nur auf Basis einer wirksamen Rechtsgrundlage (z.B. ausdrückliche Einwilligung), und sind die TOMs entsprechend dem PDSG auf dem höchsten Stand der Technik?
8) Ist der Online-Shop so gestaltet, dass er den fernabsatzrechtlichen Anforderungen genügt und alle Informationen und Rechtstexte (Impressum, AGB, Widerrufsbelehrung, Datenschutzerklärung) enthält, die für den Online-Handel erforderlich sind.
Fragen zum Beitrag? Diskutieren Sie hierzu gerne mit uns in der Unternehmergruppe der IT-Recht Kanzlei auf Facebook.
Link kopieren
Als PDF exportieren
Per E-Mail verschicken
Zum Facebook-Account der Kanzlei
Zum Instagram-Account der Kanzlei

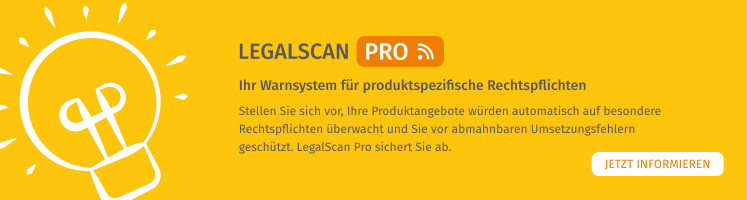




0 Kommentare