Bei Anruf Fax - BPatG verneint Verwechslungsgefahr von „TelDaFax“ und „TelDaKom“

Das Bundespatentgericht hat in seinem Beschluss vom 23. Januar 2013 (Az.: 26 W (pat) 554/10) entschieden, dass zwischen den Wortmarken „TelDaFax“ und „TelDaKom“ weder eine unmittelbare noch eine gedankliche Verwechslungsgefahr im Sinne des § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG besteht.
Fall
Die prioritätsältere Marke „TelDaFax“, eingetragen für die Dienstleistung Telekommunikation, sah sich durch die Wortähnlichkeit der Wortmarke „TelDaKom“, welche für dieselbe Dienstleistung eingetragen wurde, in ihren Rechten verletzt und erhob daher Widerspruch bei der Markenstelle des Deutschen Patent- und Markenamts (DPMA).
Das DPMA hat daraufhin am 4. August 2010 auf Grund der Annahme einer Verwechslungsgefahr nach § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG die Löschung der angegriffenen Marke „TelDaKom“ beschlossen.
Die Markenstelle lehnte zwar auf Grund der Abweichungen in den Zeichenendungen „Kom“ und „Fax“ eine unmittelbare Markenverwechslung ab, sah jedoch die Gefahr, dass die Marken gedanklich in Verbindung gebracht würden als gegeben an.
Dagegen wendete sich die Markeninhaberin von „TelDaKom“ mit ihrer Beschwerde an das Bundespatentgericht. Ihrer Ansicht nach könne der übereinstimmende Bestandteil „TelDa“ keine Verwechslungsgefahr begründen, da dieser den Gesamteindruck der Marken nicht präge und in diesen auch keine selbstständig kennzeichnende Stellung innehabe.
Entscheidung
Das BPatG schloss sich den Ausführungen der Beschwerdeführerin an und gab der Beschwerde auf Grund mangelnder Verwechslungsgefahr im Sinne des § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG statt.
Die Beurteilung der Verwechslungsgefahr ist unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalles, insbesondere der Ähnlichkeit der Zeichen und der mit ihnen gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen sowie der Kennzeichnungskraft des klägerischen Zeichens vorzunehmen.
Dabei ist hinsichtlich der Ähnlichkeit der Marken im Bild, im Klang oder in der Bedeutung auf den Gesamteindruck abzustellen, den die Marken hervorrufen, wobei insbesondere die sie unterscheidenden und dominierenden Elemente zu berücksichtigen sind. Es kommt also vor allem darauf an, wie die Marke auf den Durchschnittsverbraucher, der die Marke regelmäßig als Ganzes wahrnimmt und weniger auf Einzelheiten achtet, wirkt.
Das Gericht kam im vorliegenden Fall zu dem Ergebnis, dass obwohl die sich gegenüberstehenden Markenwörter teilweise schriftbildlich und klanglich übereinstimmen, eine Verwechslungsgefahr auf Grund der unterschiedlichen Schlusssilben „Fax“ und „Kom“ ausgeschlossen werde.
"Diese begrifflichen Unterschiede werden von einem normal informierten und angemessen aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbraucher der hier maßgeblichen Telekommunikationsdienstleistungen nicht überhört und übersehen werden, da es sich bei den beiderseitigen Marken nicht um besonders lange Markenwörter handelt und weil die einzelnen begrifflichen Bestandteile der beiderseitigen Marken durch die Binnengroßschreibung ihrer Anfangsbuchstaben deutlich hervortreten."
Auch eine Verwechslungsgefahr durch gedankliche Verbindung im Sinne des § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG läge nach Ansicht der Richter nicht vor, da eine solche setze voraus, dass der Durchschnittsverbraucher zwar die Unterschiede zwischen den Marken erkennt, jedoch trotzdem annimmt, dass diese zusammengehören.
"Die Benutzung einer Serie von Marken mit dem hier als Stammbestandteil in Betracht kommenden, den beiderseitigen Marken gemeinsamen Zeichenbestandteil "TelDa" hat die Widersprechende nicht dargetan. Sie hat zwar vorgetragen, dass für sie die beiden weiteren Marken "TelDa0800" und "TelDa.Net" eingetragen sind. Eine Benutzung dieser Marken im inländischen Geschäftsverkehr hat sie jedoch weder glaubhaft gemacht noch behauptet. Somit fehlt es an ausreichenden Anhaltspunkten dafür, dass der inländische Verkehr den Wortanfang "TelDa" der Widerspruchsmarke auch bei einer Verbindung mit anderen Wortbestandteilen als dem in der Widerspruchsmarke enthaltenen Begriff "Fax" als Hinweis auf die Herkunft von Telekommunikationsdienstleistungen aus dem Unternehmen der insolventen Widersprechenden verstehen wird."
Eine gedankliche Verwechslungsgefahr könne auch nicht damit begründet werden, dass es sich bei der Anfangssilbe „TelDa“ der Widerspruchsmarke um einen besonders charakteristisch hervorstechenden Markenbestandteil handelt. Im Gegensatz zu der Ansicht des DPMA, welches den übereinstimmenden Bestandteil „TelDa“ der Vergleichsmarken als einen solchen charakteristisch hervorstechenden Bestandteil einstufte, sah das BPatG den Bestandteil „TelDa“ mit der Abkürzung „Tel“ als eine für Telekommunikationsdienstleistungen lediglich beschreibende Angabe.
"Unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalls hat der angesprochene Verkehr daher keine Veranlassung, die angegriffene Marke allein auf Grund ihrer Übereinstimmung mit der Widerspruchsmarke in zwei von drei Silben ebenfalls dem Herkunfts- und Verantwortungsbereich der Widersprechenden zuzurechnen."
Fazit
Die Feststellung einer gedanklichen Verwechslungsgefahr im Sinne des § 9 Abs. 1 Nr. 2 Alt. 2 MarkenG bedarf also einer äußerst genauen rechtlichen Prüfung.
Grundsätzlich ist zu beachten, dass diese Art der Verwechslungsgefahr erst zu prüfen ist, wenn die einander gegenüberstehenden Zeichen nicht schon nach ihrem Gesamteindruck unmittelbar miteinander verwechselbar sind.
Eine gedankliche Verwechslungsgefahr wird nämlich dann angenommen, wenn der Verkehr die Abweichungen zwischen den Zeichen durchaus erkennt, aber auf Grund der Umstände des Einzelfalles eine gedankliche Verbindung zwischen den Zeichen knüpft, deshalb einen falschen Schluss zieht und die jüngere Marke irrtümlich der Inhaberin der älteren Marke zuordnet.
Tipp: Fragen zum Beitrag? Diskutieren Sie hierzu gerne mit uns in der Unternehmergruppe der IT-Recht Kanzlei auf Facebook .
Link kopieren
Als PDF exportieren
Per E-Mail verschicken
Zum Facebook-Account der Kanzlei
Zum Instagram-Account der Kanzlei
Beiträge zum Thema
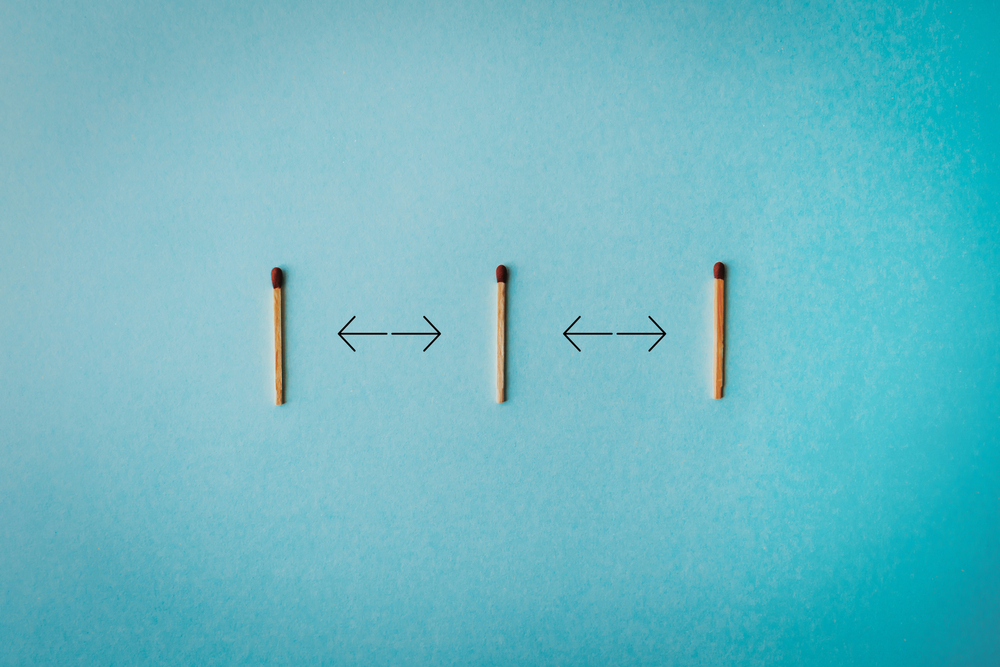






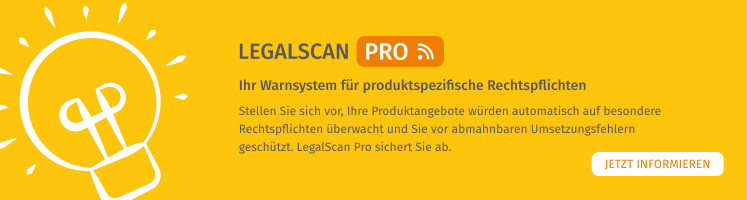


0 Kommentare