Verbraucher behauptet nach geraumer Zeit Nichtzustellung - was gilt nun?

Im Online-Handel kann es vereinzelt vorkommen, dass Sendungen beim Transportunternehmen verloren gehen. In der Regel werden solche Nichtlieferungen dann zeitnah vom Besteller reklamiert. Verdächtig erscheint es jedoch, wenn ein Verbraucher den Nichterhalt einer Sendung erst nach einer erheblichen Zeitspanne behauptet. Wer muss hier was beweisen?
Rechte des Verbrauchers bei Nichterhalt einer Sendung
Ist ein Paket auf dem Versandweg verloren gegangen und daher dem Verbraucher tatsächlich nicht zugestellt worden, ist der Händler entgegen einer weit verbreiteten Meinung grundsätzlich nicht zur erneuten Lieferung verpflichtet.
Hintergrund ist, dass der Online-Händler in Kaufverträgen grundsätzlich nur die Übergabe und Übereignung eines Produktes einer bestimmten Gattung schuldet, § 243 Abs. 1 BGB.
Gemäß § 243 Abs. 2 BGB konkretisiert sich die Gattungsschuld aber zu einer Stückschuld und die Verschaffungspflicht begrenzt sich auf die konkret auszusondernde Ware, wenn der Händler alles zur Leistung Erforderliche getan hat.
Im Online-Handel trifft den Händler grundsätzlich eine Schickschuld (Versendungsschuld).
Er tut dann alles Erforderliche, wenn er die Ware aussondert und sie an ein Transportunternehmen übergibt. Ab den Moment der Übergabe an das Transportunternehmen beschränkt sich die Gattungsschuld auf die Pflicht, die konkret auf den Weg gebrachte Bestellung zu übergeben und zu übereignen.
Geht diese Bestellung sodann auf dem Versandweg unter, kann sich der Händler gemäß § 275 Abs. 1 BGB auf Lieferunmöglichkeit berufen (er schuldet nur die konkret ausgesonderte Ware, deren Lieferung wegen des Untergangs nun nicht mehr möglich ist).
Infolge der Unmöglichkeit erlischt die Lieferpflicht des Händlers.
Im Gegenzug dazu erlischt aber auch die Zahlungspflicht des Verbrauchers.
Wird der Händler nach § 275 Abs. 1 BGB von der Leistung frei, entfällt für den Verbraucher bei einem Verbrauchsgüterkauf nach § 326 Abs. 1 BGB die Kaufpreiszahlungspflicht.
Ist der Kaufpreis bereits gezahlt worden, muss ihn der Händler nach § 326 Abs. 4 BGB i.V.m. § 346 BGB zurückerstatten.
Seinen Schaden muss der Händler, der einerseits um die Ware und andererseits um den Kaufpreis gebracht wurde, sodann grundsätzlich beim Transportunternehmen geltend machen.
Beweislast für die Zustellung unabhängig von Zeitlauf
Behauptet ein Verbraucher, bestellte Ware tatsächlich nicht erhalten zu haben, ist der Händler gehalten, das Gegenteil zu beweisen.
Hintergrund ist, dass der Händler dem Verbraucher mit der Lieferung Eigentum und Besitz an der bestellten Ware verschafft und durch die Übergabe seine vertragliche Lieferplficht aus § 433 Abs. 1 Satz 1 BGB erfüllt.
Nach den geltenden Grundsätzen der Beweisverteilung (sog. „Günstigkeitsprinzip“) muss derjenige, der eine für ihn günstige Tatsache geltend machen, diese auch beweisen.
Will ein Händler die kaufvertragliche Erfüllung per Lieferung geltend machen, hat er also die Zustellung zu beweisen.
Etwas anderes ergibt sich bei Verbrauchsgüterkäufen (also B2C-Geschäften) auch nicht aus Gefahrübergangsregeln. Zwar geht nach § 447 BGB bei Versendungskäufen die Gefahr zufälliger (also unverschuldeter) Untergänge und Verluste grundsätzlich mit der Übergabe der Ware durch den Händler an das Transportunternehmen auf den Käufer über. Für Zustellungsmängel wegen eines zufälligen Verlustiggehens in der Sphäre des Transportunternehmens hat der Händler danach eigentlich nicht einzustehen.
§ 447 ist nach § 475 Abs. 2 BGB bei Verbrauchsgüterkäufen aber regelmäßig nicht anwendbar. Stattdessen gilt § 446 BGB, nach dem der Händler bis zur Übergabe die Gefahr zufälliger Untergänge oder Verschlechterungen auf dem Transportweg trifft.
Die Beweispflicht des Händlers für eine Zustellung der bestellten Ware beim Verbraucher ist nun auch grundsätzlich unabhängig vom Zeitlauf.
Es findet also keine Beweislastumkehr statt, nur weil ein Verbraucher den Nichterhalt einer Bestellung reichlich spät behauptet und sich für eine entsprechende Reklamation beim Händler übermäßig Zeit lässt.
Es gilt mithin der Grundsatz: Der Händler muss bei vermeintlichen Nichterhalt von Sendungen unabhängig von der vergangenen Zeit zwischen planmäßiger Lieferung und Meldung des Verbrauchers aktiv beweisen, dass die Sendung tatsächlich zugestellt wurde.
Ob für einen solchen Beweis ein Sendungsverfolgungsnachweis (etwa eine Kopie bzw. ein Ausdruck eines Zustellnachweises aus einem Online-Tracking-Vorgang) ausreicht, wird von den Gerichten unterschiedlich beurteilt. Teilweise werten Gerichte eine vorgelegte Sendungsverfolgung nicht als hinreichenden Beweis, weil eine erfolgreiche Zustellung dort vom zuständigen Transportpersonal selbst und beliebig vermerkt werden könne und es mithin an einer Beweiskraft dafür fehle, dass das Personal auch tatsächlich ordnungsgemäß zugestellt habe. Einigen Gerichten kommt es insofern gerade auf eine persönliche Aussage der mit der Zustellung beauftragten Transportperson an.
Teils sehen Gerichte einen laut Sendungsverfolgung erfolgreichen Zustellvorgang aber im Gegenteil als hinreichendes Indiz für eine ordnungsgemäße Zustellung und lassen diese für einen Primärbeweis genügen. Dies hat dann zur Folge, dass dem Verbraucher die sekundäre Beweislast dafür auferlegt wird, nachzuweisen, dass ihm das Paket entgegen des Sendungsverfolgungsbelegs nicht zugestellt wurde.
Hinweis zur Zu-wenig-Lieferung:
Etwas anderes gilt, wenn der Verbraucher nicht das Fehlen einer gesamten Sendung, sondern nur einzelner Sendungsteile behauptet.
Dann wird eine Zu-wenig-Lieferung behauptet, die einen Sachmangel nach § 434 Abs. 3 BGB darstellt.
Im Bereich des Mängelrechts gilt eine andere Beweislastverteilung:
Innerhalb der ersten 6 Monate nach der Lieferung muss der Händler beweisen, dass die Ware dem Verbraucher tatsächlich vollständig übergeben worden ist. Zugunsten des Verbrauchers greift nämlich der § 477 BGB ein, nach welchem die mangelbedingende Sendungsunvollständigkeit bereits bei der Lieferung vermutet wird.
Will der Händler seiner Nachlieferungspflicht abwenden und die gesetzliche Vermutung widerlegen, müsste er aktiv nachweisen können, dass der Verbraucher die Lieferung tatsächlich vollständig erhalten hat.
Bei Reklamationen wegen Unvollständigkeit nach Ablauf von 6 Monaten seit der Lieferung greift § 477 BGB nicht mehr, dann müsste der Verbraucher aktiv nachweisen, dass Teile der Bestellung bei der Lieferung fehlten. Gelingt ihm der Nachweis nicht, könnte der Händler die Nachlieferung sowie sonstige Gewährleistungsrechte zurecht verweigern.
Weiterführende Informationen zur behaupteten Unvollständigkeit von Sendungen und Muster für Mandanten stellen wir hier bereit
Grenze: Verjährung
Die zeitliche Grenze für eine Beweispflicht des Händlers zur Abwendung von Rückzahlungsansprüchen (s. I.) sowie für eine Einstandspflicht ist der Ablauf der gesetzlichen Verjährungsfrist.
Ansprüche des Verbrauchers auf Rückzahlung des Kaufpreises als Substitut für eine wegen Unmöglichkeit erloschene Lieferpflicht verjähren innerhalb der regelmäßigen Verjährungsfrist von 3 Jahren gemäß § 195 BGB.
Die Verjährungsfrist beginnt um 24 Uhr am 31.12. des Jahres zu laufen, in dem der Rückzahlungsanspruch entstanden ist und der Verbraucher von der Nichtzustellung Kenntnis erlangt hat oder hätte erlangen müssen. Maßgeblich ist also das Jahr der planmäßigen Lieferung.
Die Verjährung des Anspruchs tritt zum Ablauf des 31.12. 3 Jahre später ein.
Wird eine Nichtzustellung erst 3 Jahre nach Schluss des Jahres der planmäßigen Lieferung geltend gemacht, kann der Händler also die Einrede der Verjährung erheben und unter Berufung hierauf ohne Notwendigkeit von Beweisen eine Einstandspflicht ablehnen.
Leitfaden und Muster der IT-Recht Kanzlei
Welche Rechte und Pflichten Händler bei der behaupteten Nichtzustellung von Sendungen gegenüber Verbrauchern und Transportunternehmen haben und wie sie diese bestmöglich durch- und umsetzen, zeigen wir (inkl. Musterformulierungen) in diesem Leitdaden.
Fazit
Behauptet ein Verbraucher den Nichterhalt einer Online-Bestellung, muss der Händler aktiv das Gegenteil und mithin die erfolgte Zustellung beweisen, um seine rechtliche Einstandspflicht abwenden zu können.
Für die Beweispflicht des Händlers ist es unbeachtlich, wann der Verbraucher den Nichterhalt reklamiert und ob zwischen planmäßiger Lieferung und Meldung des Verbrauchers bereits beträchtliche Zeit verstrichen ist. Die Beweislastumkehr wegen „Verdächtigkeit“ kennt das Gesetz nicht.
Zeitliche Grenze für eine Einstandspflicht des Händlers und mithin auch für eine Beweisplicht ist der Ablauf der gesetzlichen Verjährungsfrist 3 Jahre nach dem 31.12. des Jahres der planmäßigen Lieferung.
Fragen zum Beitrag? Diskutieren Sie hierzu gerne mit uns in der Unternehmergruppe der IT-Recht Kanzlei auf Facebook.
Link kopieren
Als PDF exportieren
Per E-Mail verschicken
Zum Facebook-Account der Kanzlei
Zum Instagram-Account der Kanzlei

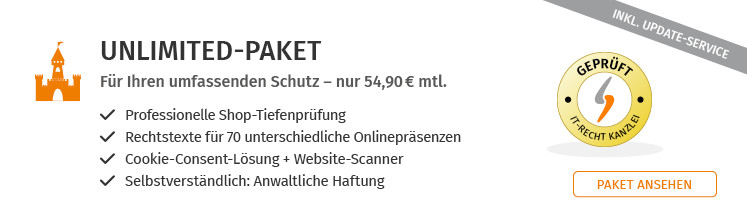

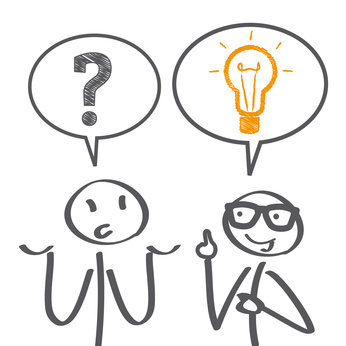


2 Kommentare
ich habe folgendes Problem,
Über einen Onlinehändler habe ich eine Konsole gekauft (188€) und diese innerhalb der Widerrufsfrist zurückgeschickt. Es kam vom Händler eine Nachricht, dass das Gerät angekommen sei aber ohne USB Ladekabel. Dies habe ich direkt hinterher geschickt und dafür leider die Sendungsnummer nicht mehr. Jetzt beharrt der Onlineshop auf die Sendungsnummer und will die Erstattung verweigern. Was kann ich tun? Vielen Dank
Der Kurierfahrer mißachtet jedoch die Zustellung am sicheren, vor Blicken und Zugriffen sicheren Ort auf Terrasse und legt die Sendung direkt vor der Haustür ab, die direkt am Gehweg und Straße liegt. Da der Hauseingang videouberwacht ist, ist die Zustellung an der Haustür als auch der nächtliche Diebstahl des Paketes durch eine vermummte Person bestätigt. Das Versandunternehmen schließt aufgrund der erteilten Absstellgenehmigung jegliche Haftung bzw. Nachlieferung aus. Das Versandunternehmen reagiert garnicht. Die Geschäftsbeziehung besteht zwischen Händler und Versandunternehmen, da der Händler das Versandunternehmen ausgesucht und beauftragt hat. Nach erfolgter Klage gegen den Händler ist der Kunde unterlegen. Das Versandunternehmen bestreitet, dass es sich bei der aufgezeichneten Zustellung um die angebliche Sendung handeln würde. Der Kunde ist in Revision gegangen. Entscheidung Juli 2023.