Anspruchsvoll: Nahrungsergänzungsmittel über das Internet rechtssicher bewerben und verkaufen!

Nahrungsergänzungsmittel in Deutschland zu bewerben und zu verkaufen ist in rechtlicher Hinsicht (extrem!) anspruchsvoll. Es bestehen Anzeige- wie auch diverse allgemeine und besondere Kennzeichnungspflichten, die wiederum in unterschiedlichen Gesetzen und Verordnungen - z.B. die Health-Claims-Verordnung oder die Verordnung über Nahrungsergänzungsmittel - geregelt sind. Die IT-Recht Kanzlei fasst in ihrem aktuellen Beitrag zusammen, welche rechtlichen Regeln existieren und was beim Inverkehrbringen, beim Verkauf sowie der Bewerbung von Nahrungsergänzungsmitteln zu beachten ist.
Allgemeine Fragen
Frage: In welcher Form dürfen Nahrungsergänzungsmittel in den Verkehr gebracht werden?
Gemäß § 2 NemV darf ein Nahrungsergänzungsmittel, das zur Abgabe an den Verbraucher bestimmt ist, gewerbsmäßig nur in einer Fertigpackung in den Verkehr gebracht werden. Ansonsten könne - so die amtliche Begründung - die notwendige Unterrichtung des Verbrauchers, die durch zusätzliche Kennzeichnungsangaben auf der Fertigpackung sichergestellt wird, nicht gewährleistet werden.
Dementsprechend ist eine Abgabe von Nahrungsergänzungsmitteln in loser Form an den Verbraucher nicht zulässig.
Frage: Welche Nährstoffe sind zulässig zur Herstellung von Nahrungsergänzungsmitteln?
Nährstoffe im Sinne der NemV sind Vitamine, Mineralstoffe und Spurenelemente. § 3 Abs. 1 NemV bestimmt, dass nur die Nährstoffe, die in der Anlage 1 NemV aufgeführt sind, als Vitamine und Mineralstoffe in Nahrungsergänzungsmitteln verwendet werden dürfen. In welcher Form diese Nährstoffe eingesetzt werden dürfen und die Anforderungen an die Reinheit dieser Stoffe, regelt Absatz 2. Die zulässigen Vitamin- und Mineralstoffverbindungen sind in Anlage 2 NemV aufgelistet.
Frage: Wer ist für die Verkehrsfähigkeit eines Nahrungsergänzungsmittels zuständig?
Es obliegt der Sorgfaltspflicht des Herstellers bzw. Inverkehrbringers, die Einhaltung der lebensmittelrechtlichen Vorschriften sicherzustellen.
Frage: Was ist beim Inverkehrbringen von Nahrungsergänzungsmitteln zu beachten?
Die Einfuhr und das Inverkehrbringen von Lebensmitteln ist in den allgemeinen lebensmittelrechtlichen Vorschriften und einigen spezifischen Rechtsvorschriften geregelt. Folgendes ist beim Inverkehrbringen von Nahrungsergänzungsmitteln sicherzustellen:
- Die Nahrungsergänzungsmittel müssen tatsächlich verkehrsfähig sein - dürfen also keine verbotenen Stoffe enthalten.
- Die Nahrungsergänzungsmittel müssen den rechtlichen Vorgaben entsprechend gekennzeichnet sein.
- Die Nahrungsergänzungsmittel müssen den rechtlichen Vorgaben entsprechend auch im Fernabsatz gekennzeichnet sein.
- Besonderheiten sind bei der gesundheitsbezogenen Werbung sind zu beachten.
- Werbebeschränkungen bzw. Werbeverbote sind einzuhalten.
- Beim Inverkehrbringen von Nahrungsergänzungsmitteln ist die Anzeigepflicht zu erfüllen.
- Beim Inverkehrbringen von Nahrungsergänzungsmitteln ist die Registrierungs- bzw. Meldepflicht zu beachten.
Frage: Unterliegen Nahrungsergänzungsmittel in Deutschland einer Zulassungspflicht?
Nahrungsergänzungsmittel unterliegen keiner Zulassungspflicht. Gemäß § 5 der Verordnung für Nahrungsergänzungsmittel (NemV) müssen Nahrungsergänzungsmittel beim Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit (BVL) angezeigt werden.
Frage: Dürfen Nahrungsergänzungsmittel, die nicht den deutschen lebensmittelrechtlichen Bestimmungen entsprechen, in den Verkehr gebracht werden?
Hierzu das Bundesinstitut für Risikobewertung:
„Wenn (Nahrungsergänzungsmittel) nicht den in der Bundesrepublik Deutschland geltenden lebensmittelrechtlichen Bestimmungen entsprechen, dürfen sie nicht in das Inland verbracht werden (§ 53 Abs. 1 Satz 1 des Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuches (LFGB)).
Abweichend hiervon kann für diese Lebensmittel eine Allgemeinverfügung nach § 54 LFBG erlassen bzw. eine Ausnahmegenehmigung nach § 68 LFGB erteilt werden.“
1. Zur Ausnahmegenehmigung
„Eine Ausnahmegenehmigung hat keine allgemeine Wirkung, sondern gilt nur im Einzelfall. Sie wird auf bestimmte Personen und bestimmte Erzeugnisse beschränkt. Daher hat jeder Betrieb, der dasselbe Produkt herstellen, behandeln oder in Verkehr bringen will, einen eigenen Antrag zu stellen. Er kann auch einem Antragsteller eine entsprechende Vollmacht erteilen.
Ausnahmen dürfen nur zugelassen werden, wenn eine Gefährdung der Gesundheit nicht zu erwarten ist. Dies ist vom BVL zu prüfen, das hierfür auch weitere Behörden einbezieht, wie das Bundesinstitut für Risikobewertung. Der Antragsteller muss alle notwendigen Unterlagen bereitstellen und die gesundheitliche Unbedenklichkeit seines Produktes beweisen.
Nachdem eine Ausnahmegenehmigung erteilt wurde, beobachten die Behörden des Bundeslandes, in dem der Antragsteller sitzt, das Herstellen, Behandeln und Inverkehrbringen des Produktes. Die Kosten hierfür trägt der Antragsteller. Geprüft werden die Etikettierung, die sachgemäßen Herstellung und das Einhalten der Auflagen, Höchstmengen und Rezeptur, die der Ausnahmegenehmigung zu Grunde liegt.“
2. Zur Allgemeinverfügung
„Allgemeinverfügungen werden vom BVL auf Antrag erlassen, wenn nicht zwingende Gründe des Gesundheitsschutzes entgegenstehen. Dies ist vom BVL, welches hierfür wissenschaftliche Bewertungen weiterer Behörden wie beispielsweise des Bundesinstituts für Risikobewertung einbezieht, zu prüfen. Vom Antragsteller sind dafür alle notwendigen Unterlagen bereitzustellen.
Im Unterschied zu den Ausnahmegenehmigungen wirken bekannt gemachte Allgemeinverfügungen zugunsten aller Einführer rezepturgleicher Erzeugnisse aus Mitgliedstaaten der Europäischen Union und Vertragsstaaten des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum. Dies setzt jedoch voraus, dass sich das jeweilige Erzeugnis in dem jeweiligen Herkunftsland auch rechtmäßig in Verkehr befindet oder dort rechtmäßig (d.h. im Einklang mit den im Herkunftsland geltenden Rechtsvorschriften) hergestellt wurde.“
Online-Kennzeichnung
Frage: Besteht eine allgemeine Online-Kennzeichnungspflicht von Nahrungsergänzungsmitteln?
Lange galten im Lebensmittelrecht keine allgemeinen Online-Informationspflichten für den Verkauf von Nahrungsergänzungsmitteln. Die bis 2017 wirksame Lebensmittelkennzeichnungsverordnung enthielt lediglich besondere Kennzeichnungspflichten für die Verpackung und Etikettierung von Nahrungsergänzungsmitteln. Diese Verordnung wurde jedoch am 13. Juli 2017 aufgehoben. Seitdem wird sie von der europäischen Lebensmittel-Informationsverodnung (LMIV) und ergänzend von der deutschen Lebensmittelinformations-Durchführungsverodnung (LMIDV) ersetzt. Diese schreiben nun seit 2014 diverse Informationspflichten bei Online-Verkäufen vor.
Zusätzlich enthält auch die ZZulV (Verordnung über die Zulassung von Zusatzstoffen zu Lebensmitteln zu technologischen Zwecken) besondere Vorschriften die in diesem Zusammenhang zu beachten sind.
Im Einzelnen gilt Folgendes:
I. Allgemeine Online-Informationspflichten bei Nahrungsergänzungsmitteln
Online-Händler, die vorverpackte Lebensmittel über das Internet zum Verkauf anbieten, haben gemäß Art. 14 LMIV i.V.m. Art. 9 LMIV folgende Pflichtinformationen auf ihrer Internetpräsenz darzustellen:
- die Bezeichnung des Lebensmittels;
- das Verzeichnis der Zutaten;
- alle in Anhang II aufgeführten Zutaten und Verarbeitungshilfsstoffe sowie Zutaten und Verarbeitungshilfsstoffe, die Derivate eines in Anhang II aufgeführten Stoffes oder Erzeugnisses sind, die bei der Herstellung oder Zubereitung eines Lebensmittels verwendet werden und — gegebenenfalls in veränderter Form — im Enderzeugnis vorhanden sind und die Allergien und Unverträglichkeiten auslösen;
- die Menge bestimmter Zutaten oder Klassen von Zutaten;
- die Nettofüllmenge des Lebensmittels;
- gegebenenfalls besondere Anweisungen für Aufbewahrung und/oder Anweisungen für die Verwendung;
- der Name oder die Firma und die Anschrift des Lebensmittelunternehmers nach Artikel 8 Absatz 1 LMIV;
- das Ursprungsland oder der Herkunftsort, wo dies nach Artikel 26 LMIV vorgesehen ist;
- eine Gebrauchsanleitung, falls es schwierig wäre, das Lebensmittel ohne eine solche angemessen zu verwenden;
- für Getränke mit einem Alkoholgehalt von mehr als 1,2 Volumenprozent die Angabe des vorhandenen Alkoholgehalts in Volumenprozent.
- eine Nährwertdeklaration
Zu keinem Zeitpunkt erforderlich ist dagegen die Angabe des Mindesthaltbarkeitsdatums oder des Verbrauchsdatums im Internet (vgl. Artikel 14 Absatz 1 lit. a i.V.m. Art. 9 I f der EU-Lebensmittelinformationsverordnung).
II. Spezielle Online-Informationspflichten bei Nahrungsergänzungsmitteln
Zusätzlich zu den in Artikel 9 Absatz 1 der EU-Lebensmittelinformationsverordnung aufgeführten allgemeinen Online-Informationspflichten (vgl. oben) sind bei bestimmten Arten oder Klassen von Lebensmitteln weitere Angaben verpflichtend, die sich wie folgt aus dem Anhang III der EU-Lebensmittelinformationsverordnung ergeben:
1. Lebensmittel, deren Haltbarkeit durch nach der Verordnung (EG) Nr. 1333/2008 zugelassenes Packgas verlängert wurde.
Spezielle Pflichtkennzeichnung (vgl. Anlage II der EU-Lebensmittelinformationsverordnung):
"unter Schutzatmosphäre verpackt“
2. Lebensmittel, die ein oder mehrere nach der Verordnung (EG) Nr. 1333/2008 zugelassene Süßungsmittel enthalten.
Spezielle Pflichtkennzeichnung (vgl. Anlage II der EU-Lebensmittelinformationsverordnung):
„mit Süßungsmittel(n)“ -> dieser Hinweis ist in Verbindung mit der Bezeichnung des Lebensmittels anzubringen
3. Lebensmittel, die sowohl einen Zuckerzusatz oder mehrere Zuckerzusätze als auch ein oder mehrere nach der Verordnung (EG) Nr. 1333/2008 zugelassene Süßungsmittel enthalten.
Spezielle Pflichtkennzeichnung (vgl. Anlage II der EU-Lebensmittelinformationsverordnung):
„mit Zucker(n) und Süßungsmittel(n)“; -> dieser Hinweis ist in Verbindung mit der Bezeichnung des Lebensmittels anzubringen
4. Lebensmittel, die nach der Verordnung (EG) Nr. 1333/2008 zugelassenes Aspartam/Aspartam-Acesulfamsalz enthalten.
Spezielle Pflichtkennzeichnung (vgl. Anlage II der EU-Lebensmittelinformationsverordnung):
- Der Hinweis „enthält Aspartam (eine Phenylalaninquelle)“ muss auf dem Etikett erscheinen, wenn das Aspartam/Aspartam-Acesulfamsalz in der Zutatenliste lediglich mit der E-Nummer aufgeführt ist.
- Der Hinweis „enthält eine Phenylalaninquelle“ muss auf dem Etikett erscheinen, wenn das Aspartam/Aspartam-Acesulfamsalz in der Zutatenliste mit seiner spezifischen Bezeichnung benannt ist."
5. Lebensmittel mit über 10 % zugesetzten, nach der Verordnung (EG) Nr. 1333/2008 zugelassenen mehrwertigen Alkoholen.
Spezielle Pflichtkennzeichnung (vgl. Anlage II der EU-Lebensmittelinformationsverordnung):
"kann bei übermäßigem Verzehr abführend wirken“
6. Süßwaren oder Getränke, die Glycyrrhizinsäure oder deren Ammoniumsalz durch Zusatz der Substanz(en) selbst oder der Süßholzpflanze Glycyrrhiza glabra in einer Konzentration von mindestens 100 mg/kg oder 10 mg/l enthalten.
Spezielle Pflichtkennzeichnung (vgl. Anlage II der EU-Lebensmittelinformationsverordnung):
Der Hinweis „enthält Süßholz“ ist unmittelbar nach der Zutatenliste anzufügen, es sei denn, der Begriff „Süßholz“ ist bereits im Zutatenverzeichnis oder in der Bezeichnung des Lebensmittels enthalten. Ist kein Zutatenverzeichnis vorgesehen, ist der Hinweis in Verbindung mit der Bezeichnung des Lebensmittels anzubringen.
7. Süßwaren, die Glycyrrhizinsäure oder ihr Ammoniumsalz durch Zusatz der Substanz(en) selbst oder der Süßholzpflanze Glycyrrhiza glabra in Konzentrationen von mindestens 4 g/kg enthalten.
Spezielle Pflichtkennzeichnung (vgl. Anlage II der EU-Lebensmittelinformationsverordnung):
Der Hinweis „enthält Süßholz — bei hohem Blutdruck sollte ein übermäßiger Verzehr dieses Erzeugnisses vermieden werden“ ist unmittelbar nach dem Zutatenverzeichnis anzufügen. Ist kein Zutatenverzeichnis vorgesehen, ist der Hinweis in Verbindung mit der Bezeichnung des Lebensmittels anzubringen.
8. Getränke, die Glycyrrhizinsäure oder ihr Ammoniumsalz durch Zusatz der Substanz(en) selbst oder der Süßholzpflanze Glycyrrhiza glabra in Konzentrationen von mindestens 50 mg/l oder mindestens 300 mg/l im Fall von Getränken enthalten, die einen Volumenanteil von mehr als 1,2 % Alkohol enthalten (1).
Spezielle Pflichtkennzeichnung (vgl. Anlage II der EU-Lebensmittelinformationsverordnung):
Der Hinweis „enthält Süßholz — bei hohem Blutdruck sollte ein übermäßiger Verzehr dieses Erzeugnisses vermieden werden“ ist unmittelbar nach dem Zutatenverzeichnis anzufügen. Ist kein Zutatenverzeichnis vorgesehen, ist der Hinweis in Verbindung mit der Bezeichnung des Lebensmittels anzubringen.
9. Getränke mit Ausnahme derjenigen, die auf Kaffee, Tee bzw. Kaffee- oder Teeextrakt basieren und bei denen der Begriff „Kaffee“ oder „Tee“ in der Bezeich¬nung vorkommt, die — zur Aufnahme in unverarbeitetem Zustand bestimmt sind und Koffein aus beliebiger Quelle in einer Menge enthalten, die 150 mg/l übersteigt, oder — konzentriert oder getrocknet sind und nach der Rekonstituierung Koffein aus beliebiger Quelle in einer Menge enthalten, die 150 mg/l übersteigt.
Spezielle Pflichtkennzeichnung (vgl. Anlage II der EU-Lebensmittelinformationsverordnung):
Der Hinweis „Erhöhter Koffeingehalt. Für Kinder und schwangere oder stillende Frauen nicht empfohlen“ muss im selben Sichtfeld wie die Bezeichnung des Getränks er¬scheinen, gefolgt von einem Hinweis in Klammern nach Artikel 13 Absatz 1 dieser Verordnung auf den Koffeingehalt, ausgedrückt in mg je 100 ml.
10. Andere Lebensmittel als Getränke, denen zu physiologischen Zwecken Koffein zugesetzt wird.
Spezielle Pflichtkennzeichnung (vgl. Anlage II der EU-Lebensmittelinformationsverordnung):
Der Hinweis „Enthält Koffein. Für Kinder und schwangere Frauen nicht empfohlen“ muss im selben Sichtfeld wie die Bezeichnung des Lebensmittels erscheinen, gefolgt von einem Hinweis in Klammern nach Artikel 13 Absatz 1 dieser Verordnung auf den Koffeingehalt, ausgedrückt in mg je 100 g/ml. Bei Nahrungsergänzungsmitteln ist der Koffeingehalt pro empfohlener täglicher Verzehrsmenge, die in der Kennzeichnung angegeben ist, anzugeben.
11. Lebensmittel oder Lebensmittelzutaten, denen Phytosterine, Phytosterinester, Phytostanole oder Phytostanolester zugesetzt sind
Spezielle Pflichtkennzeichnung (vgl. Anlage II der EU-Lebensmittelinformationsverordnung):
(1) „mit zugesetzten Pflanzensterinen“ bzw. „mit zugesetzten Pflanzenstanolen“ im selben Sichtfeld wie die Bezeichnung des Lebensmittels;
(2) die Menge an zugesetzten Phytosterinen, Phytosterinestern, Phytostanolen oder Phytostanolestern (Angabe in % oder g der freien Pflanzensterine/Pflanzenstanole je
100 g oder 100 ml des Lebensmittels) muss im Zutatenverzeichnis aufgeführt sein;
(3) Hinweis darauf, dass das Erzeugnis ausschließlich für Personen bestimmt ist, die ihren Cholesterinspiegel im Blut senken möchten;
(4) Hinweis darauf, dass Patienten, die Arzneimittel zur Senkung des Cholesterinspiegels einnehmen, das Erzeugnis nur unter ärztlicher Aufsicht zu sich nehmen
sollten;
(5) gut sichtbarer Hinweis darauf, dass das Erzeugnis für die Ernährung schwangerer und stillender Frauen sowie von Kindern unter fünf Jahren möglicherweise nicht
geeignet ist;
(6) Empfehlung, das Erzeugnis als Bestandteil einer ausgewogenen und abwechslungsreichen Ernährung zu verwenden, zu der auch zur Aufrechterhaltung des Carotinoid-Spiegels der regelmäßige Verzehr von Obst und Gemüse zählt;
(7) im selben Sichtfeld, das den unter Nummer 3 genannten Hinweis enthält, Hinweis darauf, dass die Aufnahme von mehr als 3 g/Tag an zugesetzten Pflanzens¬
terinen/Pflanzenstanolen vermieden werden sollte;
(8) Definition einer Portion des betreffenden Lebensmittels oder der Lebensmittelzutat (vorzugsweise in g oder ml) unter Angabe der Menge an Pflanzensterinen/Pflanzenstanolen, die in einer Portion enthalten ist.
12. Eingefrorenes Fleisch, eingefrorene Fleischzubereitungen und eingefrorene unverarbeitete Fischereierzeugnisse
Spezielle Pflichtkennzeichnung (vgl. Anlage II der EU-Lebensmittelinformationsverordnung):
gemäß Anhang X Nummer 3 das Datum des Einfrierens oder das Datum des ersten Einfrierens in Fällen, in denen das Produkt mehr als einmal eingefroren wurde
Frage: Wie sind die Angaben zur Lebensmittelkennzeichnung im Internet richtig zu platzieren?
Wie muss der Händler gesetzlich vorgeschriebene Pflichtinformationen zu Lebensmitteln auf seiner Internetpräsenz veröffentlichen, um sich nicht dem Risiko einer Abmahnung auszusetzen?
Artikel 14 Absatz 1 der EU-Lebensmittelinformationsverordnung bestimmt in dem Zusammenhang:
„(1) Unbeschadet der Informationspflichten, die sich aus Artikel 9 ergeben, gilt im Falle von vorverpackten Lebensmitteln, die durch Einsatz von Fernkommunikationstechniken zum Verkauf angeboten werden, Folgendes:
Verpflichtende Informationen über Lebensmittel mit Ausnahme der Angaben gemäß Artikel 9 Absatz 1 Buchstabe f müssen vor dem Abschluss des Kaufvertrags verfügbar sein und auf dem Trägermaterial des Fernabsatzgeschäfts erscheinen oder durch andere geeignete Mittel, die vom Lebensmittelunternehmer eindeutig anzugeben sind, bereitgestellt werden. Wird auf andere geeignete Mittel zurückgegriffen, so sind die verpflichtenden Informationen über Lebensmittel bereitzustellen, ohne dass der Lebensmittelunternehmer den Verbrauchern zusätzliche Kosten in Rechnung stellt.“
Nimmt man dies als Maßstab, so können die Pflichtinformationen zu Lebensmitteln wie folgt vorgehalten werden:
1. Die Pflichtinformationen stehen direkt neben oder unter dem Angebot, auf der Seite, auf der die Ware zum ersten Mal in den virtuellen Warenkorb gelegt werden kann.
2. Die Pflichtinformationen stehen räumlich etwas weiter entfernt auf derselben Seite, wie das Angebot, wobei von dem Angebot über einen deutlichen Sternchenhinweis auf die nachfolgenden Informationen verwiesen wird.
3. Die Pflichtinformationen stehen auf einer anderen Seite als das Angebot, wobei von der Angebotsseite über einen deutlich gestalteten so genannten sprechenden Link direkt auf die Seite mit den Pflichtinformationen verlinkt wird (Beispiel: „Informationen zur Lebensmittelkennzeichnung finden Sie hier (bitte anklicken)“).
4. Die Pflichtinformationen stehen auf einer der Angebotsseite nachgeordneten Seite, die der Verbraucher zwingend passieren muss, bevor er die Ware in den virtuellen Warenkorb legen kann.
Bei all diesen Varianten ist aus Sicht der IT-Recht Kanzlei sichergestellt, dass der Verbraucher die Pflichtinformationen zur Kenntnis nimmt, bevor er den elektronischen Bestellvorgang einleitet. Dies sollte für Sie als Händler der Maßstab sein. Letzte Sicherheit kann jedoch nur eine individuelle Prüfung im Einzelfall bieten.
Frage: Sind Zusatzstoffe in Online-Angeboten auszuweisen?
In der sog. ZZulV (Verordnung über die Zulassung von Zusatzstoffen zu Lebensmitteln zu technologischen Zwecken) geht bereits aus dem Wortlaut des § 9 Abs. 6 Nr. 4 hervor, dass die genannten Stoffe schon im Online-Angebot einsehbar sein müssen. Die vorgeschriebenen Angaben sind in leicht lesbarer Schrift an gut sichtbarer Stelle in der Artikelbeschreibung anzugeben; nicht zulässig ist es, sie allein in Fußnoten unterzubringen.
Diese Vorschrift dient dem Schutz des Verbrauchers vor Gesundheitsrisiken sowie vor Täuschung im Handelsverkehr mit Lebensmitteln. Dieser Schutz würde erheblich verkürzt, wenn der Kunde erst nach Lieferung der bestellten Waren erfahren würde, dass diese Zusatzstoffe erhalten, denen er sich nicht aussetzen möchte.
Insbesondere sind anzugeben (vgl. § 9 ZZulV) :
- Farbstoffe durch die Angabe „mit Farbstoff“
- Zusatzstoffe zur Konservierung durch die Angabe „mit Konservierungsstoff“ oder „konserviert“, ggf. auch „mit Nitritpökelsalz“ oder/und „mit Nitrat“
- Antioxidationsmittel durch die Angabe „mit Antioxidationsmittel“
- Geschmacksverstärker durch die Angabe „mit Geschmacksverstärker“
- Schwefel gem. Anlage 5 Teil B durch die Angabe „geschwefelt“
- Eisen-II-gluconat (E 579) oder Eisen-II-lactat (E 585) bei Oliven durch die Angabe "geschwärzt"
- Zusatzstoffe der Nummern E 901 bis E 904, E 912 oder E 914, die bei frischem Obst zur Oberflächenbehandlung verwendet werden, durch die Angabe "gewachst"
- Zusatzstoffe der Nummern E 338 bis E 341 sowie E 450 bis E 452, die bei der Herstellung von - Fleischerzeugnissen verwendet werden, durch die Angabe "mit Phosphat"
- sowie weitere Zusatzstoffe, die etwa zum Süßen von Lebensmitteln zugelassen sind, im Rahmen dieses Beitrags jedoch nicht näher behandelt werden können.
Das Sächsische Oberverwaltungsgericht (Beschluss vom 26.02.2008, Az. 3 BS 333/07) führt in diesem Zusammenhang aus:
"Gleiches gilt unabhängig von individuell bestehenden Gesundheitsgefahren auch dann, wenn der Gehalt an kenntlich zu machenden Zusatzstoffen die Erwerbsentscheidung des Verbrauchers aus sonstigen persönlichen Gründen beeinflusst. Denn der Gesetzgeber hat mit der generellen Pflicht zur Kenntlichmachung bestimmter Zusatzstoffe bei der Abgabe von Lebensmitteln an Verbraucher zum Ausdruck gebracht, dass diese Stoffe unabhängig von individuellen Gesundheitsgefahren geeignet sind, die Kaufentscheidung der Verbraucher zu beeinflussen, so dass es nicht darauf ankommt, aus welchen Gründen der Gehalt von Zusatzstoffen für den Erwerb des Lebensmittels durch den einzelnen Verbraucher relevant ist. Entscheidend ist vielmehr, dass das Gesetz dem Verbraucher ein Recht auf Information über die enthaltenen Zusatzstoffe einräumt und dass dieses Recht weitgehend leer laufen würde, falls der Verbraucher die nötige Information erst nach Erwerb des Lebensmittels erhält und so auf den unsicheren Weg einer gegebenenfalls nötigen Rückabwicklung verwiesen würde."
Frage: Was ist bei der Bewerbung gesundheitsbezogener Angaben im Fernabsatz zu beachten?
Gemäß Artikel 10 der EU-Verordnung Nr. 1924/2066 ("Health-Claims Verordnung) dürfen gesundheitsbezogene Angaben nur gemacht werden, wenn die Kennzeichnung oder, falls diese Kennzeichnung fehlt, die Aufmachung der Lebensmittel und die Lebensmittelwerbung folgende Informationen tragen:
a. Einen Hinweis auf die Bedeutung einer abwechslungsreichen und ausgewogenen Ernährung und einer gesunden Lebensweise.
Hierzu heißt es im Durchführungsbeschluss der EU-Kommission vom 24. Januar 2013 (2013/63/EU):
"Diese Bestimmung soll dem Verbraucher dabei helfen, die spezifische positive Wirkung des Lebensmittels zu verstehen, das mit der gesundheitsbezogenen Angabe versehen ist. Damit wird der Wunsch unterstrichen, die Verbraucher darauf hinzuweisen, dass der Verzehr dieses bestimmten Lebensmittels im Hinblick auf eine gesundheitsorientierte Ernährungsweise Teil einer abwechslungsreichen und ausgewogenen Ernährung sein sollte und dass das Lebensmittel nicht übermäßig oder entgegen der vernünftigen Ernährungsgewohnheiten verzehrt werden sollte (Erwägungsgrund 18) sowie dass der Verzehr des Lebensmittels, das mit der gesundheitsbezogenen Angabe versehen ist, im Rahmen einer abwechslungsreichen und ausgewogenen Ernährung nur ein Aspekt einer gesunden Lebensweise ist."
b. Informationen zur Menge des Lebensmittels und zum Verzehrmuster, die erforderlich sind, um die behauptete positive Wirkung zu erzielen.
Hierzu heißt es im Durchführungsbeschluss der EU-Kommission vom 24. Januar 2013 (2013/63/EU):
"Diese Bestimmung soll dem Verbraucher dabei helfen, die spezifische positive Wirkung des Lebensmittels zu verstehen, das mit der gesundheitsbezogenen Angabe versehen ist. Damit wird der Wunsch unterstrichen, die Verbraucher darauf hinzuweisen, dass der Verzehr dieses bestimmten Lebensmittels im Hinblick auf eine gesundheitsorientierte Ernährungsweise Teil einer abwechslungsreichen und ausgewogenen Ernährung sein sollte und dass das Lebensmittel nicht übermäßig oder entgegen der vernünftigen Ernährungsgewohnheiten verzehrt werden sollte (Erwägungsgrund 18) sowie dass der Verzehr des Lebensmittels, das mit der gesundheitsbezogenen Angabe versehen ist, im Rahmen einer abwechslungsreichen und ausgewogenen Ernährung nur ein Aspekt einer gesunden Lebensweise ist."
c. Gegebenenfalls einen Hinweis an Personen, die es vermeiden sollten, dieses Lebensmittel zu verzehren.
d. Einen geeigneten Warnhinweis bei Produkten, die bei übermäßigem Verzehr eine Gesundheitsgefahr darstellen könnten.
Hierzu heißt es im Durchführungsbeschluss der EU-Kommission vom 24. Januar 2013 (2013/63/EU):
"Einige Angaben können unter Anwendung von Verwendungsbeschränkungen zugelassen werden, bzw. für bestimmte Stoffe können gemäß sonstigen Bestimmungen für bestimmte Lebensmittelkategorien zusätzliche Kennzeichnungsanforderungen gelten. All diese Anforderungen sind kumulativ und die Unternehmer sollten sich an sämtliche Bestimmungen halten, die für Lebensmittel und Angaben gelten. Die Lebensmittelunternehmer sollten jedoch die ihnen aus dem allgemeinen Lebensmittelrecht erwachsende Verantwortung wahrnehmen und der grundlegenden Verpflichtung nachkommen, sichere, nicht gesundheitsschädliche Lebensmittel in Verkehr zu bringen, und entscheiden, ob sie die Verwendung entsprechender Aussagen verantworten können."
Gesondert hinzuweisen ist auf Artikel 14 der Verordnung (EU) Nr. 1169/2011 betreffend den Fernabsatz:
Demnach müssen die verpflichtenden Informationen dem Verbraucher vor dem Kauf zur Verfügung stehen, und beim Fernabsatz, wo die „Kennzeichnung“ nur beschränkt zugänglich ist, müssen die verpflichtenden Informationen in der Aufmachung und der Werbung für das Lebensmittel sowie auf dem Trägermaterial des Fernabsatzgeschäfts erscheinen, z. B. Website, Katalog, Broschüre, Schreiben o. Ä.
Anzeigepflicht beim Inverkehrbringen von Nahrungsergänzungsmitteln
Frage: Sind Nahrungsergänzungsmittel zulassungspflichtig?
Nein.
Frage: Besteht eine Anzeigepflicht bei Nahrungsergänzungsmitteln vor dem Inverkehrbringen?
In Deutschland besteht für Nahrungsergänzungsmittel eine Anzeigepflicht, die im § 5 NemV geregelt ist. So müssen gemäß § 5 NemV Hersteller oder Einführer, die ein Nahrungsergänzungsmittel in den Verkehr bringen wollen, dies spätestens beim ersten Inverkehrbringen in der Bundesrepublik Deutschland dem Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit (BVL) anzeigen.
Dabei ist für jedes Produkt eine gesonderte Anzeige unter Vorlage eines Musters des für das Erzeugnis verwendeten Etiketts erforderlich. Dies gilt auch für Nahrungsergänzungsmittel, die in unterschiedlichen Geschmacksrichtungen angeboten werden sollen.
Wird dagegen dasselbe Nahrungsergänzungsmittel in verschiedenen Verpackungsgrößen angeboten, so ist nicht erforderlich, dass diese im Einzelnen angezeigt werden. Auch eine Änderung des Produktnamens führt nicht zu einer neuen Anzeigepflicht des Herstellers, da es allein auf das in der Packung befindliche Nahrungsergänzungsmittel ankommt, nicht jedoch auf die Packung selbst.
Wichtiger Hinweis: Die Anzeige von Nahrungsergänzungsmitteln beim Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit (BVL) stellt den Hersteller/Einführer nicht frei von der selbstverantwortlichen Einhaltung der lebensmittelrechtlichen Bestimmungen. Der Inverkehrbringer muss dafür sorgen, dass sein Nahrungsergänzungsmittel den lebensmittelrechtlichen Vorschriften entspricht. In der Bundesrepublik Deutschland ist es ist Aufgabe der Bundesländer, die Einhaltung der lebensmittelrechtlichen Vorschriften zu überwachen.
Zu beachten ist noch, dass die Anzeigepflicht den Hersteller oder Einführer für sein jeweils eigenes Produkt trifft, so „dass das Inverkehrbringen eines Erzeugnisses mit identischer Rezeptur durch einen anderen die Anzeige des eigenen Produkts nicht entbehrlich macht“ (so Kügel/Hahn/Delewski/ Kommentar zum NemV, S. 242).
Frage: Wann muss die Anzeige spätestens erfolgen?
Die Anzeige muss spätestens beim ersten Inverkehrbringen unter Vorlage eines Musters des für das Erzeugnis verwendeten Etiketts erfolgen.
Frage: Bleibt Anzeige erforderlich, wenn das Produkt bereits in anderen EU-Mitgliedsstaaten angezeigt wurde?
Ja.
Frage: Was muss die Anzeige alles enthalten?
Neben dem Produktnamen und Anschrift ist das Etikett beizufügen, mit welchem das Nahrungsergänzungsmittel in Deutschland vertrieben werden soll. Auf dem Bild darf ausschließlich das angezeigte Erzeugnis abgebildet sein.
Wurde das Nahrungsergänzungsmittel bereits in einem anderen EU-Mitgliedstaat in den Verkehr gebracht und sieht das dortige Recht ein Anzeigeverfahren vor, so geben Sie bitte die entsprechende Behörde an, bei der das Erzeugnis zuerst angezeigt wurde. Der Anzeige nach § 5 NemV kann die Kopie der Erstanzeige in einem anderen EU-Mitgliedstaat und die Übersetzung ins Deutsche beigefügt werden.
Frage: Wie kann die Anzeige vorgenommen werden?
Auf den Seiten des BVL steht ein Dokument zum Herunterladen zur Verfügung. Dieses Dokument ist am Computer auszufüllen und dem Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit (BVL) zuzusenden.
Das Muster muss nicht zwingend verwendet werden (es besteht Formfreiheit).
Alternativ kann hier das Nahrungsergänzungsmittel auch direkt online angezeigt werden.
Frage: Kann auch ein Dritter die Anzeige vornehmen?
Soll die Anzeige des Nahrungsergänzungsmittels durch einen Dritten erfolgen, der weder Importeur noch Hersteller ist, so ist dies nur unter Vorlage einer Vollmacht möglich.
Frage: Ist Bestätigung des Eingangs durch das BVL vor Inverkehrbringen des Produkts erforderlich?
Nein, dies ist nicht erforderlich.
Produktkennzeichnung
Frage: Wo ist die allgemeine Kennzeichnung von Nahrungsergänzungsmitteln geregelt?
Die allgemeine Kennzeichnung von Nahrungsergänzungsmitteln richtete sich bis 2017 nach der Lebensmittel-Kennzeichnungsverordnung (LMKV). Diese Verordnung wurde jedoch am 13. Juli 2017 aufgehoben. Seitdem wird sie von der europäischen Lebensmittel-Informationsverordnung (LMIV, EU Nr. 1169/2011) und ergänzend von der deutschen Lebensmittelinformations-Durchführungsverordnung (LMIDV) ersetzt. Weitere Vorschriften zur Kennzeichnungspflicht finden sich ferner in der der Loskennzeichnungsverordnung (LKV), dem Mess- und Eichgesetz (MessEG) und der Fertigpackungsverordnung (FPVO) und in der Verordnung Nr. 1333/2008 über Zusatzstoffe.
Frage: Welche besonderen Kennzeichnungsvorgaben sind bei Nahrungsergänzungsmitteln zu beachten?
Erforderlich sind insbesondere die Verkehrsbezeichnung, das Zutatenverzeichnis, das Mindesthaltbarkeitsdatum, der Lebensmittelunternehmer mit Anschrift in der EU, die Füllmenge (je nach Art des Erzeugnisses in Volumen oder Gewichtseinheit).
I. Bezeichnung „Nahrungsergänzungsmittel“ als festgelegte Verkehrsbezeichnung
§ 4 Abs.1 NemV legt fest, dass die Bezeichnung „Nahrungsergänzungsmittel“ die festgelegte Verkehrsbezeichnung nach der Lebensmittel-Informationsverordnung ist. Nahrungsergänzungsmittel dürfen nur mit dieser Bezeichnung in den Verkehr gebracht werden. Es ist die einzig erlaubte und vorgeschriebene Verkehrszeichnung. Bisher gebräuchliche Angaben in der Art wie „Vitaminkapseln zur Nahrungsergänzung“ sind als Verkehrsbezeichnung nicht zulässig und können die vorgeschriebene Angabe nicht ersetzen.
Natürlich sind wahrheitsgemäße und nicht irreführende Angaben als zusätzliche Beschreibungen weiterhin zulässig.
II. Vorgeschriebene Pflichtangaben auf Fertigpackung
Gemäß § 4 Abs. 2 NemV darf ein Nahrungsergänzungsmittel nur in den Verkehr gebracht werden, wenn auf der Fertigpackung zusätzlich zu den durch die Lebensmittel-Kennzeichnungsverordnung vorgeschriebenen Angaben angegeben sind:
1. Die Namen der Kategorien von Nährstoffen oder sonstigen Stoffen, die für das Erzeugnis kennzeichnend sind, oder eine Angabe zur Charakterisierung dieser Nährstoffe oder sonstigen Stoffe.
Unklar ist, welche Kategorien gemeint sind und nach welchem Ordnungskriterium Stoffe zu „Kategorien“
zusammengefasst werden sollen. Hierzu heißt es im Leitfaden "Nahrungsergänzungsmittel-Verordnung des BLL:
"Denkbar ist hier eine Bezugnahme auf den Erwägungsgrund 6 der Richtlinie, der Vitamine, Mineralstoffe, Aminosäuren, essenzielle Fettsäuren, Ballaststoffe sowie Pflanzen und Kräuterextrakte nennt, die in Nahrungsergänzungsmitteln enthalten sein können. Die Auslegung des Abs. 2 Nr.1 lässt dem Hersteller sicherlich eine gewisse Freiheit; dies verdeutlicht vor allem der Zusatz „oder eine Angabe zur Charakterisierung der Nährstoffe oder sonstigen Stoffe“. Mit Verweis auf die amtliche Begründung ist des Weiteren entscheidend, dass der Verbraucher die für die Auswahl notwendigen Informationen erhält. Wichtig erscheint also letztlich, dass die Angabe dem Verbraucher eine korrekte, nicht irreführende Beschreibung des Produkts vermittelt. Angesichts des Wortlautes des § 4 Abs. 2 Nr. 1, der einen gewissen Spielraum bei der Angabe der Verkehrsbezeichnung eröffnet, und der Möglichkeit des Verbrauchers, genaue Informationen über die Zusammensetzung des Lebensmittels aus dem Zutatenverzeichnis zu beziehen, dürfte die Handhabung dieser Vorschrift in der Praxis keine Schwierigkeiten aufwerfen."
2. Die empfohlene tägliche Verzehrsmenge in Portionen des Erzeugnisses.
Die Angabe der empfohlenen Tagesverzehrsmenge, z.B. eine Kapsel pro Tag, und der Warnhinweis, diese empfohlene Tagesverzehrsmenge nicht zu überschreiten, sind laut amtlicher Begründung notwendig, um unmissverständlich klar zu machen, dass es sich dabei um eine Verzehrsempfehlung im Sinne einer Maximaldosierung handelt und um eine Überdosierung der Erzeugnisse zu vermeiden, da eine zu hohe Zufuhr von bestimmten Vitaminen und Mineralstoffen nachteilige Wirkungen für die Gesundheit haben kann.
3. Der Warnhinweis "Die angegebene empfohlene tägliche Verzehrsmenge darf nicht überschritten werden.
Zulässig ist gem. § 4 Abs. 2 Satz 2 NemV auch ein gleichsinniger Warnhinweis. Zudem ist die Verwendung der Begriffe „Warnhinweis“ oder „Hinweis“ nicht verpflichtend. Statt „tägliche Verzehrsmenge“ können auch „Tagesdosis“ oder ähnliche Begriffe verwendet werden.
Hinweis: Unabhängig davon, ob bei einer Überdosierung gesundheitliche Gefahren bestehen, hat der Warnhinweis in jedem Falle zu erfolgen, denn eine entsprechende Möglichkeit, vom Hinweis abzusehen, sieht die NemV nicht vor.
4. Ein Hinweis darauf, dass Nahrungsergänzungsmittel nicht als Ersatz für eine ausgewogene und abwechslungsreiche Ernährung verwendet werden sollten.
Der Verbraucher muss auf dem Etikett auch darüber unterrichtet werden, dass Nahrungsergänzungsmittel nicht als Ersatz für eine abwechslungsreiche Ernährung verwendet werden sollten. In der Regel bietet eine ausgewogene und abwechslungsreiche Ernährung laut amtlicher Begründung alle für eine normale Entwicklung und die Erhaltung einer guten Gesundheit erforderlichen Nährstoffe in den Mengen, die auf der Grundlage allgemein anerkannter wissenschaftlicher Daten ermittelt und empfohlen wurden.
5. Ein Hinweis darauf, dass die Produkte außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern zu lagern sind.
Der Hinweis muss auch dann angebracht werden, wenn das Produkt (auch) für Kinder bestimmt ist. Damit soll sichergestellt werden, dass der Verbraucher die für die Auswahl der Erzeugnisse notwendigen Informationen enthält.
III. Kennzeichnung der Nährstoffe
Gemäß § 4 III NemV darf ein Nahrungsergänzungsmittel gewerbsmäßig nur in den Verkehr gebracht werden, wenn auf der Fertigpackung zusätzlich die Menge der Nährstoffe (z.B. Calcium, und nicht die Menge der eingesetzten Verbindung, z.B. Calciumcarbonat) oder sonstigen Stoffe mit ernährungsspezifischer oder physiologischer Wirkung im Nahrungsergänzungsmittel, bezogen auf die auf dem Etikett angegebene empfohlene tägliche Verzehrsmenge in den in Anlage 1 der Richtlinie 202/46/EG jeweils genannten Maßeinheiten als Durchschnittswerte, die auf der Analyse des Erzeugnisses durch den Hersteller beruhen, angegeben ist.
Die Nährstoffgehalte sind bezogen auf die empfohlene Tagesverzehrsmenge, die auf dem Etikett angegeben ist, zu kennzeichnen. Um einheitliche Angaben zu gewährleisten, die es dem Verbraucher ermöglichen, die Nährstoffgehalte der angebotenen Erzeugnisse zu vergleichen, sind die Nährstoffe mit den Maßeinheiten anzugeben, die den Nährstoffen in Anlage 1 jeweils angefügt sind.
Zusätzlich sind die in dem Nahrungsergänzungsmittel enthaltenen Vitamine und Mineralstoffe jeweils als Prozentsatz der Anhang XIII Teil A der Verordnung (EU) Nr. 1169/2011 angegebenen Referenzwerte anzugeben. Dies gilt allerdings nur für die Nährstoffe, für die Referenzwerte festgelegt sind. Für die meisten Mineralstoffe, die in Anhang XIII aufgelistet sind, fehlen solche Referenzwerte. Diese Prozentangaben können in numerischer oder in grafischer Form auf dem Etikett angebracht werden. Unter „grafischer Form“ sind z.B. Diagramme in Kreis- oder Balkenform zu verstehen.
Im Rahmen des § 4 Abs. 3 NEMV ist zu klären, ob nur die Menge der (isoliert) zugesetzten Nährstoffe und sonstigen Stoffe oder ob die insgesamt im Nahrungsergänzungsmittel enthaltene Menge dargestellt werden muss.
Gemäß dem Bund für Lebensmittelrecht und Lebensmittelkunde e. V. ("BLL") sind in dem Zusammenhang folgende drei Fallgruppen zu unterscheiden:
- Mengenangabe, wenn ein in den Anlagen aufgeführter Nährstoff in isolierter Form zugesetzt ist
- Mengenangabe, wenn eine Zutat zugesetzt ist, die ihrerseits in der Anlage aufgeführte Nährstoffe beinhaltet
- Mengenangabe, wenn eine Zutat einen sonstigen Stoff mit ernährungsspezifischer oder physiologischer Wirkung enthält.
Der Leitfaden "Nahrungsergänzungsmittel-Verordnung" des BLL setzt sich ausführlich mit den drei genannten Fallgruppen auseinander.
IV. Kennzeichnung von Lebensmittelzusatzstoffen, die für Verkauf an Endverbraucher bestimmt sind
Vorab: Die in Artikel 23 Abs. 2 der EU-Verordnung Nr. 1333/2008 geregelten Kennzeichnungspflichten gelten nicht für das Internet ("ihre Verpackungen", vgl. Artikel 23 Abs. 2.)
Gemäß Artikel 23 Abs. 2 der EU-Verordnung Nr. 1333/2008 dürfen zum Verkauf an den Endverbraucher bestimmte Lebensmittelzusatzstoffe, die einzeln oder gemischt mit anderen Zusatzstoffen und/oder anderen Zutaten angeboten werden, nur in den Verkehr gebracht werden, wenn ihre Verpackungen folgende Angaben aufweisen:
- die Bezeichnung und die E-Nummer jedes Lebensmittelzusatzstoffs gemäß dieser Verordnung oder eine die Bezeichnung und die E-Nummer jedes Lebensmittelzusatzstoffs beinhaltende Verkehrsbezeichnung.
Abweichend hiervon muss die Verkehrsbezeichnung von Tafelsüßen mit dem Hinweis versehen sein „Tafelsüße auf der Grundlage von …“, ergänzt durch den bzw. die Namen der für die Rezeptur der Tafelsüße verwendeten Süßungsmittel … ergänzt durch den bzw. die Namen der für die Rezeptur der Tafelsüße verwendeten Süßungsmittel.
- die Angabe „für Lebensmittel“ oder die Angabe „für Lebensmittel, begrenzte Verwendung“ oder einen genaueren Hinweis auf die vorgesehene Verwendung in Lebensmitteln.
Gemäß Artikel 23 Abs. 3 der EU-Verordnung Nr. 1333/2008 muss die Kennzeichnung von Tafelsüßen, die Polyole und/oder Aspartam enthalten, folgenden Warnhinweise umfassen:
a) Polyole: „Kann bei übermäßigem Verzehr abführend wirken“;
b) Aspartam/Aspartam-Acesulfamsalz: „Enthält eine Phenylalaninquelle“.
Hinweis: Die Kennzeichnung von Lebensmittelzusatzstoffen, die nicht für den Verkauf an den Endverbraucher bestimmt sind, wird im Rahmen dieses Beitrags nicht behandelt.
V. Anforderungen an die Kennzeichnung von Lebensmitteln, die bestimmte Lebensmittelfarbstoffe enthalten
Lebensmittel, die bestimmte Azofarbstoffe enthalten, müssen seit dem 02.07.2010 gemäß Artikel 24 der EU-Verordnung Nr. 1333/2008 mit der Angabe
"Kann Aktivität und Aufmerksamkeit bei Kindern beinträchtigen"
gekennzeichnet sein.
Es handelt sich um die Farbstoffe
- E 102 Tartrazin (enthalten u.a. in Getränken, insbesondere Likören und Obstweinen, Süßwaren, Desserts, Backwaren, Senf, Käse, Fisch-/Krebspasten, Kunstdärmen)
- E 104 Chinolingelb (enthalten u.a. in Getränken, Süßwaren, Desserts, Speiseeis, Kaugummi, Räucherfisch)
- E 110 Gelborange S (enthalten u.a. in Asia Snacks, Fertignahrung, Süßwaren, Desserts, Käse, Joghurt)
- E 122 Azorubin (enthalten u.a. in Getränken, Süßwaren, Desserts, Marzipan, Fertiggerichten, Paniermehl etc.)
- E 124 Cochenillerot A (enthalten u.a. in Getränken, Süßwaren, Fruchtaufstrichen, Käse, Chorizo, Lachsersatz)
- E 129 Allurarot AC (enthalten u.a. in Getränken, Süßwaren, Desserts, Hackfleischgerichten)
Azofarbstoffe sind synthetische Färbemittel, die sich durch eine sogenannte Azobrücke (eine chemisch funktionelle Gruppe, bestehend aus zwei Stickstoff-Atomen) auszeichnen. Diese Stoffe finden schon seit Langem vor allem bei der Färbung von Lebensmitteln ihre Anwendung; in der Kritik stehen sie jedoch ebenfalls schon länger. So stehen sie u.a. unter Verdacht, bestimmte (Pseudo-) Allergien, Asthma, Krebsleiden und Tumore zu begünstigen. Seit neuestem wird zudem diskutiert, ob bestimmte Azofarbstoffe bei Kindern ein Aufmerksamkeitsdefizit hervorrufen können.
VI. Kenntlichmachung von Zusatzstoffen in Nahrungsergänzungsmitteln
Gemäß § 9 ZZulV muss der Gehalt an Zusatzstoffen in Nahrungsergänzungsmitteln bei der Abgabe an Verbraucher wie folgt kenntlich gemacht werden:
1. bei Lebensmitteln mit einem Gehalt an Farbstoffen durch die Angabe "mit Farbstoff",
2. bei Lebensmitteln mit einem Gehalt an Zusatzstoffen, die zur Konservierung verwendet werden, durch die Angabe "mit Konservierungsstoff" oder "konserviert"; diese Angaben können durch folgende Angaben ersetzt werden:
a) "mit Nitritpökelsalz" bei Lebensmitteln mit einem Gehalt an Natrium- oder Kaliumnitrit, auch gemischt und in Mischungen mit Kochsalz, jodiertem Kochsalz oder Kochsalzersatz,
b) "mit Nitrat" bei Lebensmitteln mit einem Gehalt an Natrium- oder Kaliumnitrat, auch gemischt, oder
c) "mit Nitritpökelsalz und Nitrat" bei Lebensmitteln mit einem, Gehalt an Natrium- oder Kaliumnitrit und Natrium- oder Kaliumnitrat, jeweils auch gemischt und in Mischungen mit Kochsalz, jodiertem Kochsalz oder Kochsalzersatz,
3. bei Lebensmitteln mit einem Gehalt an Zusatzstoffen, die als Antioxidationsmittel verwendet werden, durch die Angabe "mit Antioxidationsmittel",
4. bei Lebensmitteln mit einem Gehalt an Zusatzstoffen, die als Geschmacksverstärker verwendet werden, durch die Angabe "mit Geschmacksverstärker",
5. bei Lebensmitteln mit einem Gehalt an Zusatzstoffen, der Anlage 5 Teil B von mehr als 10 Milligramm in einem Kilogramm oder einem Liter, berechnet als Schwefeldioxid, durch die Angabe "geschwefelt",
6. bei Oliven mit einem Gehalt an Eisen-II-gluconat (E 579) oder Eisen-II-lactat (E 585) durch die Angabe "geschwärzt",
7. bei frischen Zitrusfrüchten, Melonen, Äpfeln und Birnen mit einem Gehalt an Zusatzstoffen der Nummern E 901 bis E 904, E 912 oder E 914, die zur Oberflächenbehandlung verwendet werden, durch die Angabe "gewachst",
8. bei Fleischerzeugnissen mit einem Gehalt an Zusatzstoffen der Nummern E 338 bis E 341, E 450 bis E 452, die bei der Herstellung der Fleischerzeugnisse verwendet werden, durch die Angabe "mit Phosphat".
Diese Angaben gemäß § 9 VI ZZulV gut sichtbar, in leicht lesbarer Schrift und unverwischbar anzugeben. Sie sind wie folgt anzubringen:
- bei loser Abgabe von Lebensmitteln auf einem Schild auf oder neben dem Lebensmittel,
- bei der Abgabe von Lebensmitteln in Umhüllungen oder Fertigpackungen nach § 1 Abs. 2 der Lebensmittel-Kennzeichnungsverordnung auf einem Schild auf oder neben dem Lebensmittel, auf der Umhüllung oder auf der Fertigpackung,
- bei der Abgabe von Lebensmitteln in Fertigpackungen, die nach der Lebensmittel-Kennzeichnungsverordnung zu kennzeichnen sind, auf der Fertigpackung oder dem mit ihr verbundenen Etikett,
- bei der Abgabe von Lebensmitteln im Versandhandel auch in den Angebotslisten,
- bei der Abgabe von Lebensmitteln in Gaststätten auf Speise- und Getränkekarten,
- bei der Abgabe von Lebensmitteln in Einrichtungen zur Gemeinschaftsverpflegung auf Speisekarten oder in Preisverzeichnissen oder, soweit keine solchen ausgelegt sind oder ausgehändigt werden, in einem sonstigen Aushang oder einer schriftlichen Mitteilung.
Achtung: § 9 ZZulV sieht weitere Kennzeichnungsvorgaben beim Verkauf von Nahrungsergänzungsmitteln vor, auf die im Rahmen dieses Beitrags nicht eingegangen wird.
Werbeverbote
Frage: Welche Werbeverbote bestehen bei Nahrungsergänzungsmitteln?
Folgende Rechtsvorschriften sehen Werbebeschränkungen in Zusammenhang mit dem Vertrieb von Nahrungsergänzungsmitteln vor:
- Ge- und Verbote der Health-Claims-Verordnung
- § 4 Abs. 4 Verordnung über Nahrungsergänzungsmittel (NEMV)
- § 11 Lebensmittel-, Bedarfsgegenstände- und Futtermittelgesetzbuches (LFGB) in Verbindung mit Art. 7 der Lebensmittelinformationsverordnung
Im Einzelnen:
1. Die Health-Claims Verordnung
Die Health-Claims-Verordnung (VO (EG) 1924/2006) – im Folgenden HCVO – trifft Regelungen zu nährwert- und gesundheitsbezogene Lebensmittelwerbung und gilt in jedem Mitgliedstaat in Europa unmittelbar. Die Regelungen der HCVO unterscheiden insbesondere zwischen nährwertbezogenen Angaben und gesundheitsbezogenen Angaben. Zudem wird den Angaben zur Reduzierung von Krankheitsrisiken und die Angaben über die Entwicklung und Gesundheit von Kindern besonderes Gewicht beigemessen.
a) Allgemeine Grundsätze: Artikel 3 - 7 HCVO (Verordnung (EG) Nr. 1924/2006)
Art. 3 der HCVO regelt die allgemeinen Grundsätze für alle Angaben. Gemäß Artikel 3 der Health-Claims-Verordnung dürfen nährwert- und gesundheitsbezogene Angaben
- nicht falsch, mehrdeutig oder irreführend sein;
- keine Zweifel über die Sicherheit und/oder die ernährungsphysiologische Eignung anderer Lebensmittel wecken;
- nicht zum übermäßigen Verzehr eines Lebensmittels ermutigen oder diesen wohlwollend darstellen;
- nicht erklären, suggerieren oder auch nur mittelbar zum Ausdruck bringen, dass eine ausgewogene und abwechslungsreiche Ernährung generell nicht die erforderlichen Mengen an Nährstoffen liefern kann.
- nicht -durch eine Textaussage oder durch Darstellungen in Form von Bildern, grafischen Elementen oder symbolische Darstellungen — auf Veränderungen bei Körperfunktionen Bezug nehmen, die beim Verbraucher Ängste auslösen oder daraus Nutzen ziehen könnten.
Artikel 4 – 7 HCVO regeln die weiteren allgemeinen Bedingungen von nährwert- und gesundheitsbezogenen Angaben. Dabei ist die Rolle der nach Art. 4 HCVO noch von der Kommission festzulegenden Nährwertprofile noch stehts unklar.
Zu beachten ist, dass nach Art. 4 Abs. 4 HCVO bei Getränken mit einem Alkoholgehalt von mehr als 1,2 Volumenprozent
- Keine gesundheitsbezogenen Angaben
- Keine nährwertbezogenen Angaben mit Ausnahme solcher, die sich auf eine Reduzierung des Alkoholgehalts oder des Brennwerts beziehen, tragen
Nach Art. 5 und 6 HCVO müssen alle Angaben hinreichend wissenschaftlich abgesichert sein. Art. 7 HCVO bestimmt, dass nährwert- und gesundheitsbezogene Angaben mit einer Nährwertkennzeichnung gemäß der Nährwertkennzeichnungsrichtlinie. Dies gilt jedoch nicht für produktübergreifende Werbeaussagen.
b) Nährwertbezogene Angaben: Art. 8 und 9 HCVO (Verordnung (EG) Nr. 1924/2006)
Nährwertbezogene Angaben dürfen nur gemacht werden, wenn sie im Anhang aufgeführt sind und den im Anhang festgelegten Bedingungen entsprechen. Auch dürfen vergleichende Werbeaussagen nur getroffen werden, wenn die Lebensmittel derselben Kategorie angehören. Dabei bleibt offen, was in diesem Zusammenhang unter „Kategorie“ zu verstehen ist. Hierzu heißt es im Lebensmittelrecht Handbuch (v. Prof. Dr. Streinz und RA Dr. Markus Kraus, 40. Ergänzungslieferung, Stand Juni 2019):
„Es ist aber anzunehmen, dass eine Kategorie vorliegt, wenn sich aud der Sicht eines Durchschnittsverbrauchers zwei Lebensmittel unter denselben Oberbegriff fassen lassen, wie etwa „Obst“, „Gemüse“, oder Fleisch“.“
c) Gesundheitsbezogene Angaben: Art. 10 – 19 HVCO (Verordnung (EG) Nr. 1924/2006)
Die folgenden gesundheitsbezogenen Angaben sind gemäß Artikel 12 der Health-Claims-Verordnung in keinem Falle zulässig:
- Angaben, die den Eindruck erwecken, durch Verzicht auf das Lebensmittel könnte die Gesundheit beeinträchtigt werden.
- Angaben, die auf Empfehlungen von einzelnen Ärzten oder Vertretern medizinischer Berufe und von Vereinigungen, die nicht in Artikel 11 der Verordnung genannt werden, verweisen. Als Vertreter medizinischer Berufsgruppen gelten etwa Apotheker, Heilpraktiker, Physiotherapeuten und Krankenschwestern (so Meisterernst/Haber, Kommentar HCVO, Art. 12 Rn. 20).
- Angaben über Dauer und Ausmaß der Gewichtsabnahme.
Hierzu heißt es im Handbuch Lebensmittelkennzeichnung (v. Dr. Rempe, Lebensmittelkennzeichnungsrecht, 1. Auflage, 2011 auf S, 72):
"Angaben über die Dauer und das Ausmaß einer Gewichtsabnahme sind bei Lebensmitteln des allgemeinen Verzehrs gemäß Art. 12 Buchstabe b HCVO generell verboten. Dabei handelt es sich etwa um die Aussage "Sie verlieren drei Kilo in 10 Tagen" oder "Reduzieren Sie Ihren Bauchumfang in einer Woche um zwei Zentimeter". Ob auch Vorher-Nachher-Bilder unter das Verbot fallen, hängt vom jeweiligen Einzelfall ab. Sind die Unterschiede derart deutlich, dass mit ihnen eine messbare Gewichtsabnahme in einem bestimmten Zeitraum suggeriert wird, fallen sie jedenfalls auch unter das Verbot."
Schlankheitsbezogene Angaben wie schlank machende oder gewichtskontroliierende Eigenschaften des Lebensmittels oder Angaben bei denen es um
- die Verringerung des Hungergefühls oder
- um ein verstärktes Sättigungsgefühl oder
- eine verringerte Energieaufnahme
geht, sind gemäß Artikel 13 Ab. 1 c) der Health-Claims-Verordnung von dem Verbot nicht berührt. Solche Angaben müssen jedoch wissenschaftlich abgesichert sein und dürfen den Verbraucher nicht täuschen.
Art. 13 HCVO enthält Regelungen über andere gesundheitsbezogene Angaben als Angaben über die Reduzierung eines Krankheitsrisikos. Art. 14 HCVO regelt dagegen wie Angaben über die Verringerung eines Krankheitsrisikos gemacht werden dürfen.
2. § 4 Abs. 4 Verordnung über Nahrungsergänzungsmittel (NEMV)
Gemäß § 4 Absatz 4 NEMV darf die Werbung für Nahrungsergänzungsmittel keinen Hinweis enthalten, mit dem behauptet oder unterstellt wird, dass bei einer ausgewogenen, abwechslungsreichen Ernährung im Allgemeinen die Zufuhr angemessener Nährstoffmengen nicht möglich sei.
Die Vorschrift in Absatz 4 dient dem Schutz des Verbrauchers vor Irreführung und Täuschung. Da eine ausgewogene und abwechslungsreiche Ernährung in der Regel die Nährstoffversorgung sicherstellt, dürfen bei Nahrungsergänzungsmitteln keine Aussagen gemacht werden, die dies in Frage stellen.
3. § 11 des Lebensmittel-, Bedarfsgegenstände- und Futtermittelgesetzbuches (LFGB) in Verbindung mit Art. 7 der Lebensmittelinformationsverordnung
In § 11 LFGB in Verbindung mit Art. 7 der Lebensmittelinformationsverordnung sind Vorschriften zum Schutz vor Irreführung und Täuschung der Verbraucher geregelt.
Demnach dürfen Informationen über Lebensmittel nicht irreführend sein.
Gemäß § 11 I LFGB in Verbindung mit Art. 7 Abs. 1 und 3 in Verbindung mit Abs. 4 der Lebensmittelinformationsverordnung dürfen Lebensmittel nicht irreführend beworben werden, insbesondere
- in Bezug auf die Eigenschaften des Lebensmittels, insbesondere in Bezug auf Art, Identität, Eigenschaften, Zusammensetzung, Menge, Haltbarkeit, Ursprungsland oder Herkunftsort und Methode der Herstellung oder Erzeugung,
- indem ein Lebensmittel Wirkungen oder Eigenschaften zugeschrieben werden, die es nicht besitzt,
- indem zu verstehen gegeben wird, dass sich das durch Lebensmittel besondere Merkmale auszeichnet, obwohl alle vergleichbaren Lebensmittel dieselben Eigenschaften haben ( = spezieller Tatbestand der verbotenen Werbung mit Selbstverständlichkeiten),
- indem durch das Aussehen, die Bezeichnung oder bildliche Darstellungen das Vorhandensein eines bestimmten Lebensmittels oder einer Zutat suggeriert wird, obwohl tatsächlich in dem Lebensmittel ein von Natur aus vorhandener Bestandteil oder eine normalerweise in diesem Lebensmittel verwendete Zutat durch einen anderen Bestandteil oder eine andere Zutat ersetzt wurde.
- Vorbehaltlich unionsrechtlicher Ausnahmen, dürfen Informationen über ein Lebensmittel diesem keine Eigenschaften der Vorbeugung, Behandlung oder Heilung einer menschlichen Krankheit zuschreiben oder den Eindruck dieser Eigenschaften entstehen lassen
Registrierungspflicht und Meldepflicht
Vertreiber von Nahrungsergänzungsmittel haben sich (wie alle Lebensmittelhändler) gemäß EU-Verordnung Nr- 852/2004 behördlich registrieren zu lassen und wesentliche betriebliche Änderungen der jeweils zuständigen Behörde mitzuteilen. Die Registrierungs- und Meldepflicht betrifft auch Online-Händler, die Lebensmittel ausschließlich über das Internet vertreiben. Bei bereits erfolgter Gewerbemeldung entfällt jedoch die Pflicht, sich gesondert registrieren zu lassen.
Frage: Was ist Rechtsgrundlage für die Registrierungspflicht von Lebensmittelunternehmen?
Gemäß Art. 6 Abs. 2 der VO (EG) Nr. 852/2004 über Lebensmittelhygiene hat jeder Lebensmittelunternehmer seine(n) Betrieb(e) bei der zuständigen Lebensmittelüberwachungsbehörde zur Registrierung anzuzeigen.
Frage: Was ist Sinn der Registrierungspflicht?
Hierzu heißt es im Leitfaden für die Durchführung einzelner Bestimmungen der Verordnung (EG) Nr. 852/2004:
„Durch die Eintragung (Registrierung) sollen die zuständigen Behörden in den Mitgliedstaaten einen Überblick über Tätigkeitsort und -art der Betriebe erlangen, so dass amtliche Kontrollen durchgeführt werden können, wann immer dies von der nationalen zuständigen Behörde für erforderlich gehalten wird.“
Frage: Wer muss sich registrieren lassen?
Die Verordnung (EG) Nr. 852/2004 5 verpflichtet alle Lebensmittelunternehmer, die auf einer der Stufen der Produktion, der Verarbeitung oder des Vertriebs von Lebensmitteln tätig sind, der entsprechenden zuständigen Behörde die Betriebe zwecks Eintragung zu melden. Auch sind wichtige Veränderungen bestehender Betriebe durch den Lebensmittelunternehmer der Behörde zu melden.
Wichtige Veränderungen sind beispielsweise:
- Neuanmeldung eines Lebensmittelunternehmens
- Schließung eines Lebensmittelunternehmens
- Änderung der Personen- oder Adressdaten des Lebensmittelunternehmers
- Änderung von Bezeichnung oder Adresse des Betriebes
- Änderung der Betriebsart/Tätigkeit
- Änderung des Produktsortiments
In dem Zusammenhang heißt es im Leitfaden der Kreisverwaltung Rhein-Land:
„Dieser Pflicht unterliegen Betriebsinhaber auf allen Stufen der Herstellung, Verarbeitung und des Handels, vom landwirtschaftlichen Betrieb über Gaststätten bis zur mobilen Imbisseinrichtung. Auch Betriebe, die Lebensmittel nur als Beisortiment führen, wie z.B. Tankstellen, Apotheken, Kosmetik- und Friseursalons, Drogerien und Fitnessstudios, fallen unter diese Regelung ebenso wie Einrichtungen, die nur für begrenzte Zeit betrieben werden, wie z.B. auf Volksfesten, Vereinsfesten, Märkten u.ä. Zu den Lebensmittelunternehmern zählen auch Hersteller und Inverkehrbringer von Bedarfsgegenständen und Kosmetika. (§ 3 Abs. 1 des Lebensmittel- u. Futtermittelgesetzes vom 1.9.05 (BGBl. I S. 2618)“
Frage: Unterliegen auch Online-Händler der Registrierungspflicht?
Ja, auch Unternehmen die Lebensmittel im Internet zum Verkauf anbieten fallen unter die Definition des Lebensmittelunternehmers.
Frage: Muss sich ein Lebensmittelunternehmen bei erfolgter Gewerbeanmeldung neu registrieren?
Zur Meldung verpflichtet ist ausschließlich derjenige Lebensmittelunternehmer, der noch nicht bei der zuständigen Behörde erfasst ist oder wenn sich Änderungen zu den erfassten Daten ergeben.
Sofern eine nach Gewerberecht vorgeschriebene Gewerbeanmeldung bei der örtlichen Kommune erfolgt ist, (..) ist eine nochmalige Meldung ist dann nicht mehr erforderlich. (Quelle: Leitfaden des Rheinisch Bergischen Kreises)
Dies wird im Leitfaden des Bayerischen Staatsministeriums für Umwelt und Gesundheit bestätigt:
„Zur Meldung verpflichtet ist jeder registrierungspflichtige Lebensmittelunternehmer soweit er noch nicht bei der zuständigen Behörde erfasst ist oder wenn sich Änderungen zu den erfassten Daten ergeben. Als Meldung gilt auch die Gewerbe-Anmeldung (…)“
Es gilt also: Sofern bereits eine aktuelle Gewerbemeldung vorliegt, benötigen Lebensmittelunternehmen keine weitere Registrierung!
Frage: Wie kann man sich registrieren lassen?
Die Registrierung erfolgt bei der örtlich zuständigen Lebensmittelüberwachungsbehörde. Jeder registrierungspflichtige Lebensmittelunternehmer, der noch nicht bei der zuständigen Behörde erfasst ist oder bei dem sich Änderungen in den erfassten Daten ergeben, ist verpflichtet sich dort zu melden. Besteht ein Lebensmittelunternehmen aus mehreren Betriebsstätten, ist jede Betriebsstätte anzumelden. Für die Lebensmittelüberwachung zuständige Behörden gibt es in jedem Kreis bzw. jeder kreisfreien Stadt.
Für die Suche nach der jeweils zuständigen Behörde kann auch die „Behördensuchmaschine “ , eingesetzt werden. Für nähere Auskünfte stehen die örtlichen Lebensmittel- und Veterinärämter zur Verfügung.
Achtung: Nahrungsergänzungsmittel müssen vor dem ersten Inverkehrbringen zusätzlich beim Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit (BVL) angezeigt werden. Dasselbe gilt für diätetische Lebensmittel, die nicht zu einer der Gruppen der Anlage 8 der Diätverordnung (DiätV) gehören, diätetische Lebensmittel für besondere medizinische Zwecke (bilanzierte Diäten) sowie Säuglingsanfangsnahrung (die für die besondere Ernährung von Säuglingen während der ersten Lebensmonate bestimmt ist und für sich allein den Ernährungserfordernissen von Säuglingen bis zur Einführung der Beikost entspricht).
Frage: Welche Daten müssen bei Registrierung gemeldet werden?
Dazu gehören:
- Bezeichnung und Adresse der Betriebsstätte und ggf. weiterer Betriebsstätten,
- Personen- und Kontaktdaten des verantwortlichen Lebensmittelunternehmers,
- Betriebsart / Tätigkeit (allg. Beschreibung, z.B. Getränkehersteller, Hofladen, Pizza-Service),
- Angaben zum Produktsortiment (Warengruppen),
- Angaben zur Vornutzung der Betriebsstätte
Frage: In welchen Fällen entfällt die Registrierungspflicht?
Die Registrierungspflicht gilt gemäß Artikel 2 Absatz 2 der EG-Verordnung Nr. 852/2004 nicht für
- die Primärproduktion für den privaten häuslichen Gebrauch;
- die häusliche Verarbeitung, Handhabung oder Lagerung von Lebensmitteln zum häuslichen privaten Verbrauch
- die direkte Abgabe kleiner Mengen von Primärerzeugnissen durch den Erzeuger an den Endverbraucher oder an lokale Einzelhandelsgeschäfte, die die Erzeugnisse unmittelbar an den Endverbraucher abgeben.
- Sammelstellen und Gerbereien, die ausschließlich deshalb unter die Definition "Lebensmittelunternehmen" fallen, weil sie mit Rohstoffen für die Herstellung von Gelatine oder Kollagen umgehen.
Werbung
Frage: Welche speziellen Vorgaben sind bei gesundheitsbezogener Werbung zu beachten?
Da wären zu nennen:
1. Es gilt ein Verbotsprinzip mit Erlaubnisvorbehalt.
2. Es bestehen Kennzeichnungsplichten bei gesundheitsbezogener Werbung
3. Bestimmte gesundheitsbezogene Angaben sind verboten.
Im Einzelnen:
1. Verbotsprinzip mit Erlaubnisvorbehalt
Für gesundheitsbezogene Angaben gilt gemäß Artikel 10 Abs. 1 der Health-Claims-Verordnung das so genannte „Verbotsprinzip mit Erlaubnisvorbehalt“.
Danach sind gesundheitsbezogene Angaben grundsätzlich verboten, sofern sie nicht
- den in Art. 3 bis 7 der Verordnung geregelten allgemeinen Grundsätzen und
- den in Art. 10 bis 19 der Verordnung festgelegten speziellen Anforderungen an gesundheitsbezogene Angaben entsprechen,
- gemäß der Verordnung zugelassen und in die Liste der zugelassenen Angaben gemäß den Art. 13 und 14 der Verordnung aufgenommen sind.
(vgl. (BGH GRUR 2011, 246 Rn. 6 – Gurktaler Kräuterlikör; Meisternst/Haber, Praxiskomm. Health & Nutrition Claims Art. 10 Rn. 4 f.)
Die Verordnungsgeber sehen unterschiedliche Verfahrensweisen hinsichtlich der Zulassung von „Health-Claims“ vor.
- Die Zulassung von „Angaben über die Verringerung eines Krankheitsrisikos“ und „Angaben über die Entwicklung und die Gesundheit von Kindern“ (vgl. Artikel 14 der Verordnung) unterliegen zwingend einem Einzelzulassungsverfahren, das in den Artikeln 15, 16, 17 und 19 der Verordnung näher definiert wird, (vgl. Artikel 14 Abs. 1 der Verordnung).
- Die Zulassung für andere gesundheitsbezogene Angaben als Angaben über die Reduzierung eines Krankheitsrisikos sowie die Entwicklung und die Gesundheit von Kindern“ (vgl. Artikel 13 der Verordnung) erlangen dagegen durch die Aufnahme in die Gemeinschaftsliste nach Artikel 13 Abs. 3 der Verordnung eine Zulassung.
Besonderheit: Produkte mit traditionellen Bezeichnungen
In der Europäischen Union sind Produkte mit traditionellen Bezeichnungen in Verkehr. Diese sollten aufgrund der Inkraftsetzung der Verordnung nicht vom Markt genommen werden müssen. Aus diesem Grund hat der europäische Gesetzgeber in die Verordnung eine Ausnahmeregelung für Produkte mit traditionellen Bezeichnungen aufgenommen.
Nach Artikel 1 Abs. 4 der Verordnung können Lebensmittelunternehmer eine Ausnahme für traditionelle Produktbezeichnungen, die als gesundheitsbezogene Angabe verstanden werden können wie „Rachenpastillen“ oder „Magenbitter“, vom Anwendungsbereich des Artikels 1 Abs. 3 der Verordnung erlangen. Hierzu bedarf es eines Antrages bei der zuständigen nationalen Behörde eines Mitgliedstaates - in Deutschland beim BVL.
2. Kennzeichnungspflichten bei gesundheitsbezogener Werbung
Die Verwendung gesundheitsbezogener Angaben zu Lebensmitteln löst grundsätzlich die spezielle Hinweispflicht nach Art. 10 Abs. 2 lit. a) VO für dieses Produkt aus.
3. Verbot bestimmter gesundheitsbezogener Angaben
Die folgenden gesundheitsbezogenen Angaben sind gemäß Artikel 12 der Health-Claims-Verordnung in keinem Falle zulässig:
a. Angaben, die den Eindruck erwecken, durch Verzicht auf das Lebensmittel könnte die Gesundheit beeinträchtigt werden.
b. Angaben, die auf Empfehlungen von einzelnen Ärzten oder Vertretern medizinischer Berufe und von Vereinigungen, die nicht in Artikel 11 der Verordnung genannt werden, verweisen. Als Vertreter medizinischer Berufsgruppen gelten etwa Apotheker, Heilpraktiker, Physiotherapeuten und Krankenschwestern (so Meisterernst/Haber, Kommentar HCVO, Art. 12 Rn. 20).
c. Angaben über Dauer und Ausmaß der Gewichtsabnahme.
Hierzu heißt es im Handbuch Lebensmittelkennzeichnung (v. Dr. Rempe, Lebensmittelkennzeichnungsrecht, 1. Auflage, 2011 auf S, 72):
"Angaben über die Dauer und das Ausmaß einer Gewichtsabnahme sind bei Lebensmitteln des allgemeinen Verzehrs gemäß Art. 12 Buchstabe b HCVO generell verboten. Dabei handelt es sich etwa um die Aussage "Sie verlieren drei Kilo in 10 Tagen" oder "Reduzieren Sie Ihren Bauchumfang in einer Woche um zwei Zentimeter". Ob auch Vorher-Nachher-Bilder unter das Verbot fallen, hängt vom jeweiligen Einzelfall ab. Sind die Unterschiede derart deutlich, dass mit ihnen eine messbare Gewichtsabnahme in einem bestimmten Zeitraum suggeriert wird, fallen sie jedenfalls auch unter das Verbot."
Schlankheitsbezogene Angaben wie schlank machende oder gewichtskontroliierende Eigenschaften des Lebensmittels oder Angaben bei denen es um
- die Verringerung des Hungergefühls oder
- um ein verstärktes Sättigungsgefühl oder
- eine verringerte Energieaufnahme
geht, sind gemäß Artikel 13 Ab. 1 c) der Health-Claims-Verordnung von dem Verbot nicht berührt. Solche Angaben müssen jedoch wissenschaftlich abgesichert sein und dürfen den Verbraucher nicht täuschen.
Frage: Welche zusätzlichen Hinweispflichten lösen zugelassene gesundheitsbezogene Angaben aus?
Gemäß Artikel 10 Absatz der EU-Verordnung dürfen [gesundheitsbezogene Angaben] nur gemacht werden, wenn die Kennzeichnung oder, falls diese Kennzeichnung fehlt, die Aufmachung der Lebensmittel und die Lebensmittelwerbung folgende Informationen tragen:
a. Einen Hinweis auf die Bedeutung einer abwechslungsreichen und ausgewogenen Ernährung und einer gesunden Lebensweise.
Hierzu heißt es im Durchführungsbeschluss der EU-Kommission vom 24. Januar 2013 (2013/63/EU):
"Diese Bestimmung soll dem Verbraucher dabei helfen, die spezifische positive Wirkung des Lebensmittels zu verstehen, das mit der gesundheitsbezogenen Angabe versehen ist. Damit wird der Wunsch unterstrichen, die Verbraucher darauf hinzuweisen, dass der Verzehr dieses bestimmten Lebensmittels im Hinblick auf eine gesundheitsorientierte Ernährungsweise Teil einer abwechslungsreichen und ausgewogenen Ernährung sein sollte und dass das Lebensmittel nicht übermäßig oder entgegen der vernünftigen Ernährungsgewohnheiten verzehrt werden sollte (Erwägungsgrund 18) sowie dass der Verzehr des Lebensmittels, das mit der gesundheitsbezogenen Angabe versehen ist, im Rahmen einer abwechslungsreichen und ausgewogenen Ernährung nur ein Aspekt einer gesunden Lebensweise ist."
b. Informationen zur Menge des Lebensmittels und zum Verzehrmuster, die erforderlich sind, um die behauptete positive Wirkung zu erzielen.
Hierzu heißt es im Durchführungsbeschluss der EU-Kommission vom 24. Januar 2013 (2013/63/EU):
"Diese Bestimmung soll dem Verbraucher dabei helfen, die spezifische positive Wirkung des Lebensmittels zu verstehen, das mit der gesundheitsbezogenen Angabe versehen ist. Damit wird der Wunsch unterstrichen, die Verbraucher darauf hinzuweisen, dass der Verzehr dieses bestimmten Lebensmittels im Hinblick auf eine gesundheitsorientierte Ernährungsweise Teil einer abwechslungsreichen und ausgewogenen Ernährung sein sollte und dass das Lebensmittel nicht übermäßig oder entgegen der vernünftigen Ernährungsgewohnheiten verzehrt werden sollte (Erwägungsgrund 18) sowie dass der Verzehr des Lebensmittels, das mit der gesundheitsbezogenen Angabe versehen ist, im Rahmen einer abwechslungsreichen und ausgewogenen Ernährung nur ein Aspekt einer gesunden Lebensweise ist."
c. Gegebenenfalls einen Hinweis an Personen, die es vermeiden sollten, dieses Lebensmittel zu verzehren.
d. Einen geeigneten Warnhinweis bei Produkten, die bei übermäßigem Verzehr eine Gesundheitsgefahr darstellen könnten.
Hierzu heißt es im Durchführungsbeschluss der EU-Kommission vom 24. Januar 2013 (2013/63/EU):
"Einige Angaben können unter Anwendung von Verwendungsbeschränkungen zugelassen werden, bzw. für bestimmte Stoffe können gemäß sonstigen Bestimmungen für bestimmte Lebensmittelkategorien zusätzliche Kennzeichnungsanforderungen gelten. All diese Anforderungen sind kumulativ und die Unternehmer sollten sich an sämtliche Bestimmungen halten, die für Lebensmittel und Angaben gelten. Die Lebensmittelunternehmer sollten jedoch die ihnen aus dem allgemeinen Lebensmittelrecht erwachsende Verantwortung wahrnehmen und der grundlegenden Verpflichtung nachkommen, sichere, nicht gesundheitsschädliche Lebensmittel in Verkehr zu bringen, und entscheiden, ob sie die Verwendung entsprechender Aussagen verantworten können."
Frage: Sind die Pflichthinweise immer in der Kennzeichnung eines Nahrungsergänzungsmittels auszuweisen?
Gemäß Artikel 10 Abs. der Verordnung darf gesundheitsbezogene Werbung nur gemacht werden, wenn die Kennzeichnung oder, falls diese Kennzeichnung fehlt, die Aufmachung der Lebensmittel und die Lebensmittelwerbung die zugehörigen Pflichtinformationen tragen.
Folgende Fallkonstellationen sind denkbar:
1. Nur Kennzeichnung eines Lebensmittels enthält gesundheitsbezogene Angaben.
Beispiel: Nur das Etikett eines Lebensmittels enthält gesundheitsbezogene Angaben. Darüber hinaus wird das Lebensmittel nicht gesundheitsbezogen beworben.
2. Sowohl Kennzeichnung als auch Bewerbung eines Lebensmittels weist gesundheitsbezogene Angaben auf
Beispiel: Auf dem Etikett eines Lebensmittels wird gesundheitsbezogen geworben. Dieses Lebensmittel wird auch in Anzeigen gesundheitsbezogen beworben.
3. Nur in allgemeiner Lebensmittelwerbung wird gesundheitsbezogen geworben
Beispiel: Lebensmittel wird ausschließlich via Anzeigen gesundheitsbezogen beworben. Etikett des Lebensmittels weist dagegen keine gesundheitsbezogene Werbung auf.
Für diese Fallkonstellationen gilt: Unabhängig davon, auf welche Art ein Lebensmittel gesundheitsbezogen beworben wird, die Pflichthinweise sind zwingend in der Kennzeichnung des Lebensmittels auszuweisen, auf das sich die Angabe bezieht. Schließlich kommt es entscheidend darauf an, dass dem Verbraucher die verpflichtenden Informationen vor (und bei) dem Kauf des Lebensmittels zur Verfügung stehen.
Frage: Sind Pflichthinweise auch in gesundheitsbezogener Werbung eines Nahrungsergänzungsmittels auszuweisen?
Nicht höchstrichterlich geklärt bzw. umstritten ist derzeit, ob es genügt die Pflichtangaben allein auf dem Etikett eines Lebensmittels darzustellen, sollte z.B. nur die allgemeine Lebensmittelwerbung gesundheitsbezogene Angaben gemacht worden sein.
Beispiel: Ein bestimmtes Lebensmittel wird in Zeitungsanzeigen gesundheitsbezogen beworben. Die Aufmachung des Lebensmittels (z.B. Etikett) enthält dagegen keine gesundheitsbezogenen Angaben.
In dem Zusammenhang haben bereits mehrere Oberlandesgerichte entschieden, dass die Lebensmittelwerbung immer auch die Pflichtinformationen enthalten müsse - sollte in der Werbung auf gesundheitsbezogene Angaben Bezug genommen worden sein.
Auf folgende Entscheidungen ist in dem Zusammenhang hinzuweisen:
- OLG Hamburg (21.06.2012 – 3 U 97/11)
- OLG Koblenz, 20.06.2012 – 9 U 224/12
- OLG Schleswig, 21.06.2012 – 6W1/12
1. Begründung des OLG Hamburg (21.06.2012 – 3 U 97/11)
"Nach dem Wortlaut des Art. 10 Abs. 2 (...) muss einerseits die Kennzeichnung bzw. Aufmachung des Lebensmittels, andererseits aber auch die Lebensmittelwerbung die in Art. 10 Abs. 2 lit. a) bis d) aufgeführten Hinweise enthalten."
Diese Entscheidung sah sich der Kritik ausgesetzt, da sich keinesfalls eindeutig aus dem Gesetzeswortlaut ergäbe, dass bereits jegliche Lebensmittelwerbung die Pflichtinformationen enthalten müsse.
"Die Norm lässt sich nämlich durchaus so verstehen, dass die Aufmachung und die Lebensmittelwerbung die Pflichtinformationen nur tragen müssen, „falls die (...) Kennzeichnung fehlt“. Es gibt keinen Anhaltspunkt dafür, dass bei den Ginkgo-Kapseln eine Kennzeichnung gefehlt hätte – es sei denn, man ist der Meinung, dass in jeder Werbung die Kennzeichnung fehlt. Dann hätte der Gesetzgeber eine solche Doppelkennzeichnungspflicht aber einfach durch das Wort „und“ anordnen, also vorschreiben können, die Hinweise müssten in „Kennzeichnung und Werbung“ erscheinen, bzw. „sowohl in der Kennzeichnung als auch in der Werbung“ (Quelle: RA Prof. Dr. Moritz Hagenmeyer, "Fünfte Beleuchtung der Rechtsprechung zur VO (EG) Nr. 1924,/2006 über nährwert- und gesundheitsbezogene Angaben, WRP 4/2013 S. 451)
2. Begründung des OLG Koblenz, 20.06.2012 – 9 U 224/12
"Der Senat legt Art. 10 II (...) dahingehend aus, dass der Hinweis auf der Kennzeichnung und der Lebensmittelwerbung erfolgen muss. (...) Nur für den Fall, dass eine Kennzeichnung fehlt, hat die Aufmachung der Lebensmittel den entsprechenden Hinweis zu enthalten, wodurch die Hinweispflicht in der Lebensmittelwerbung jedoch nicht berührt wird."
Schließlich diene die Verordnung „dem Schutz des Verbrauchers vor irrführenden Angaben“ und solle „ihm daneben die Wahl zwischen den verschiedenen Lebensmitteln erleichtern“.
Auch die Argumentation des OLG Koblenz wird mit der Begründung kritisert, dass ein "stereotyper Hinweis in der Werbung" den Verbraucher keinesfalls besser stellen bzw. besser vor Irreführungen schützen könne (so etwa RA Prof. Dr. Moritz Hagenmeyer, WRP 4/2013 S. 451.)
Zudem habe sich das Gericht nicht sorgfältig genug mit dem Gesetzeswortlaut auseinandergesetzt:
„Die Norm lässt sich nämlich durchaus so verstehen, dass die Aufmachung und die Lebensmittelwerbung die Pflichtinformationen nur tragen müssen, „falls die (...) Kennzeichnung fehlt“. Es gibt keinen Anhaltspunkt dafür, dass bei den Ginkgo-Kapseln eine Kennzeichnung gefehlt hätte – es sei denn, man ist der Meinung, dass in jeder Werbung die Kennzeichnung fehlt. Dann hätte der Gesetzgeber eine solche Doppelkennzeichnungspflicht aber einfach durch das Wort „und“ anordnen, also vorschreiben können, die Hinweise müssten in „Kennzeichnung und Werbung“ erscheinen, bzw. „sowohl in der Kennzeichnung als auch in der Werbung“ (Quelle: RA Prof. Dr. Moritz Hagenmeyer, "Fünfte Beleuchtung der Rechtsprechung zur VO (EG) Nr. 1924,/2006 über nährwert- und gesundheitsbezogene Angaben, WRP 4/2013 S. 451)
Handlungsempfehlung: Es entspricht dem sichersten Wege die Pflichthinweise in jeglicher „Werbung“ des Lebensmittels auszuweisen, über das die gesundheitsbezogene Angabe gemacht wird. Wird beispielsweise eine gesundheitsbezogene Angabe in einer allgemeinen Werbung für ein Lebensmittel verwendet (z. B. Olivenöl, Milchprodukte, Fleisch usw.), die nicht auf ein bestimmtes Produkt Bezug nimmt, das eine „Kennzeichnung“ aufweisen würde, dann müssen die Pflichthinweise ebenfalls in der „Werbung“ und der „Aufmachung“ dieses Lebensmittels erscheinen.
Frage: Was ist bei der Bewerbung gesundheitsbezogener Angaben im Fernabsatz zu beachten?
Gemäß Artikel 12 der Verordnung (EU) Nr. 1169/2011 sollten dem Verbraucher bei seiner Entscheidung über den Kauf eines Lebensmittels die verpflichtenden Informationen grundsätzlich immer zur Verfügung stehen. Gesondert hinzuweisen ist auf Artikel 14 der Verordnung (EU) Nr. 1169/2011 betreffend den Fernabsatz. Demnach müssen die verpflichtenden Informationen dem Verbraucher vor dem Kauf zur Verfügung stehen, und beim Fernabsatz, wo die „Kennzeichnung“ nur beschränkt zugänglich ist, müssen die verpflichtenden Informationen in der Aufmachung und der Werbung für das Lebensmittel sowie auf dem Trägermaterial des Fernabsatzgeschäfts erscheinen, z. B. Website, Katalog, Broschüre, Schreiben o. Ä.
Frage: Gibt es Ausnahmeregelungen bez. der Pflichtinformationen bei gesundheitsbezogener Werbung?
Gemäß Artikel 1 Absatz 2 der Verordnung gilt eine Ausnahmeregelung für nicht vorverpackte Lebensmittel, die dem Endverbraucher oder Einrichtungen zur Gemeinschaftsverpflegung zum Kauf angeboten werden, und für Lebensmittel, die entweder an der Verkaufsstelle auf Wunsch des Käufers verpackt oder zum sofortigen Verkauf fertig verpackt werden. Gemäß dieser Ausnahmeregelung kann auf die verpflichtenden Informationen nach Maßgabe von Artikel 10 Absatz 2 Buchstaben a und b verzichtet werden. Die Hinweise gemäß Artikel 10 Absatz 2 Buchstaben c und d, sofern zutreffend, sind dagegen in jedem Fall erforderlich.
Frage: Müssen gesundheitsbezogene Angaben genau nach dem in der Gemeinschaftsliste genannten Wortlaut verwendet werden?
Hierzu das Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit:
"Im Rahmen der Verabschiedung der Gemeinschaftsliste der zulässigen Claims wurde eine gewisse Flexibilität beim Gebrauch der Formulierung einer Angabe gewährt, um den linguistischen und kulturellen Unterschieden Rechnung zu tragen. Vorraussetzung hierfür ist jedoch, dass die gewählte Formulierung sinngemäß dieselbe Bedeutung wie die eines in der Liste aufgeführten Claims hat. Entscheidend ist hier, dass die verwendete Formulierung einer gesundheitsbezogenen Angabe den Verbraucher nicht irreführt."
Frage: Was gilt bei Verweisen auf allgemeine, nichtspezifische Vorteile für die Gesundheit?
Hierzu heißt es im Durchführungsbeschluss der EU-Kommission vom 24. Januar 2013 (2013/63/EU):
"Gemäß Artikel 10 Absatz 3 dürfen einfache, werbewirksame Aussagen über die allgemeinen, nichtspezifischen Vorteile eines Lebensmittels für die Gesundheit im Allgemeinen oder das gesundheitsbezogene Wohlbefinden ohne vorherige Zulassung, aber unter Einhaltung spezifischer Anforderungen gemacht werden. Solche Angaben könnten nützlich für den Verbraucher sein, da sie eine verbraucherfreundlichere Botschaft vermitteln. Sie könnten vom Verbraucher jedoch leicht missverstanden und/oder falsch ausgelegt werden und möglicherweise dazu führen, dass er glaubt, das Lebensmittel bringe weitere/bessere Vorteile für die Gesundheit mit sich, als dies tatsächlich der Fall ist. Aus diesem Grund darf nur dann auf allgemeine, nichtspezifische Vorteile für die Gesundheit verwiesen werden, wenn einem solchen Verweis eine spezielle gesundheitsbezogene Angabe aus den Listen der zulässigen gesundheitsbezogenen Angaben im EU-Register beigefügt ist. Für die Zwecke der Verordnung sollte die dem Verweis auf allgemeine, nichtspezifische Vorteile für die Gesundheit beigefügte zugelassene spezielle gesundheitsbezogene Angabe neben oder unter diesem Verweis angebracht werden.
Die speziellen Angaben aus den Listen der zulässigen gesundheitsbezogenen Angaben sollten einen gewissen Bezug zu dem Verweis auf die allgemeinen Vorteile haben. Je breiter dieser Verweis ausgelegt wird, z. B. „für eine gute Gesundheit“, desto mehr gesundheitsbezogene Angaben aus den Listen der zulässigen gesundheitsbezogenen Angaben könnten als begleitende Angaben zum Verweis in Frage kommen. Es ist jedoch zu berücksichtigen, dass Artikel 10 den Rahmen für die Verwendung gesundheitsbezogener Angaben vorgibt, und da Artikel 10 ausdrücklich auf die Vorschriften von Kapitel II und IV Bezug nimmt, sollten diese Vorschriften ebenfalls eingehalten werden, wenn Unternehmer den Anforderungen gemäß Artikel 10 Absatz 3 genügen möchten. Damit die Verbraucher nicht in die Irre geleitet werden, sind die Lebensmittelunternehmer dazu verpflichtet, den Zusammenhang zwischen dem Verweis auf die allgemeinen, nichtspezifischen Vorteile des Lebensmittels und der beigefügten speziellen zulässigen gesundheitsbezogenen Angabe herzustellen.
Bei der wissenschaftlichen Bewertung der zum Zweck der Zulassung vorgelegten Angaben wurden einige Angaben als zu allgemein bzw. zu nichtspezifisch für eine Bewertung eingestuft. Diese Angaben konnten nicht zugelassen werden und werden daher im EU-Register der nährwert- und gesundheitsbezogenen Angaben in der Liste der nicht zugelassenen Angaben geführt. Dies schließt nicht aus, dass auf die betreffenden Angaben die Bestimmungen des Artikels 10 Absatz 3 angewandt werden können, wodurch sie rechtmäßig verwendet werden dürfen, wenn ihnen gemäß dem genannten Artikel eine spezielle Angabe aus der Liste der zulässigen gesundheitsbezogenen Angaben beigefügt ist."
Fragen zum Beitrag? Diskutieren Sie hierzu gerne mit uns in der Unternehmergruppe der IT-Recht Kanzlei auf Facebook.
Link kopieren
Als PDF exportieren
Per E-Mail verschicken
Zum Facebook-Account der Kanzlei
Zum Instagram-Account der Kanzlei

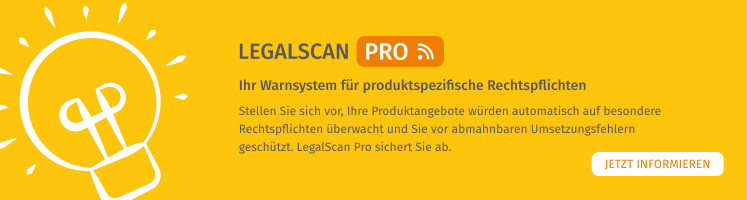




2 Kommentare
Vielen Dank im Voraus.
Das heißt für mich die rechtliche Grundlage hat der Hersteller gestellt. so muss ich mich nicht damit herum schlagen. Aber was ist wenn ich die NEM ins Nichteuropäische Ausland schicken will, was muss ich da beachten?.
Es würde mich freuen Sie könnten mir etwas dabei helfen.
Danke
Stephanie Löwl
wicht04@gmail.com