Änderung von AGB – Was ist aus rechtlicher Sicht zu beachten?

Verwendet ein Unternehmer bei Vertragsschluss AGB, regeln sie fortan das Vertragsverhältnis zwischen ihm und seinen Kunden. Doch was gilt, wenn der Unternehmer seine AGB nachträglich ändern möchte?
Inhaltsverzeichnis
- Was versteht man unter „AGB“?
- Wie werden AGB Vertragsbestandteil?
- 1. Verträge mit Verbrauchern (B2C)
- 2. Verträge mit Unternehmern (B2B)
- Kann man AGB nachträglich ändern?
- 1. Einseitige AGB-Änderung bei Vertragsverhältnissen mit einmaliger Leistungspflicht
- 2. Einseitige AGB-Änderung bei Dauerschuldverhältnissen
- Welche Gründe berechtigen zu einer AGB-Änderung ohne Zustimmung des Kunden?
- Wie kann die erforderliche Zustimmung des Kunden eingeholt werden?
- 1. Fiktion der Zustimmung (Widerspruchslösung)
- 2. Aktive Einholung der Zustimmung
- Was gilt bei Verweigerung der Zustimmung?
- Fazit
Was versteht man unter „AGB“?
Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB) sind gemäß § 305 Abs. 1 BGB alle für eine Vielzahl von Verträgen vorformulierten Vertragsbedingungen, die eine Vertragspartei (Verwender) der anderen Vertragspartei bei Abschluss eines Vertrags stellt. Gleichgültig ist, ob die Bestimmungen einen äußerlich gesonderten Bestandteil des Vertrags bilden oder in die Vertragsurkunde selbst aufgenommen werden, welchen Umfang sie haben, in welcher Schriftart sie verfasst sind und welche Form der Vertrag hat.
AGB bilden somit den rechtlichen Rahmen für Verträge zwischen dem Unternehmer und seinen Kunden, wobei die Kunden grundsätzlich sowohl Verbraucher als auch Unternehmer sein können.
Abzugrenzen sind AGB insbesondere von Individualvereinbarungen und von den gesetzlichen Regelungen.
Wie werden AGB Vertragsbestandteil?
Bei der Frage, wie AGB im Online-Handel wirksam einbezogen werden, muss zwischen Verträgen mit Verbrauchern (B2C) und Verträgen zwischen Unternehmern (B2B) differenziert werden.
1. Verträge mit Verbrauchern (B2C)
Bei Verträgen mit Verbrauchern (B2C) werden Allgemeine Geschäftsbedingungen nach § 305 Abs. 2 BGB nur dann Bestandteil eines Vertrags, wenn der Verwender bei Vertragsschluss
- die andere Vertragspartei ausdrücklich oder, wenn ein ausdrücklicher Hinweis wegen der Art des Vertragsschlusses nur unter unverhältnismäßigen Schwierigkeiten möglich ist, durch deutlich sichtbaren Aushang am Ort des Vertragsschlusses auf sie hinweist und
- der anderen Vertragspartei die Möglichkeit verschafft, in zumutbarer Weise, die auch eine für den Verwender erkennbare körperliche Behinderung der anderen Vertragspartei angemessen berücksichtigt, von ihrem Inhalt Kenntnis zu nehmen,
und wenn die andere Vertragspartei mit ihrer Geltung einverstanden ist.
Das Gesetz regelt nicht explizit, wie AGB vom Unternehmer konkret eingebunden werden müssen. Zudem sind die technischen Voraussetzungen für die Darstellung der Inhalte auch nicht immer gleich und können – je nach Vertriebskanal – völlig unterschiedlich sein. Daher kann insoweit auch kein pauschaler Hinweis erfolgen. Es ist vielmehr zu beachten, welche Darstellungsmöglichkeiten sich dem Unternehmer auf dem jeweiligen Vertriebskanal für seine Rechtstexte bieten.
2. Verträge mit Unternehmern (B2B)
Bei Verträgen mit Unternehmern (B2B) sind die Anforderungen für die wirksame Einbeziehung von AGB nicht ganz so hoch, wie bei Verbrauchern. Dies ergibt sich daraus, dass die Regelung des § 305 Abs. 2 BGB gemäß § 310 Abs. 1 BGB auf solche Verträge keine Anwendung findet, da Unternehmer aus Sicht des Gesetzgebers nicht gleichermaßen schutzbedürftig sind wie Verbraucher.
Im B2B-Geschäftsverkehr reicht es für die Einbeziehung von AGB grundsätzlich aus, dass der Verwender im Zusammenhang mit dem Vertragsschluss auf sie hinweist und der Vertragspartner der Geltung nicht widerspricht.
So hat etwa der EuGH mit Urteil vom 24.11.2022 (C-358/21) entscheiden, dass es insoweit für die Einbeziehung von AGB ausreicht, wenn bei einem schriftlich geschlossenen Vertrag der Hyperlink zur Webseite, auf der die AGB eingesehen und heruntergeladen werden können, angegeben wird. Allerdings müssen die AGB unter dem angegebenen Link auch tatsächlich abrufbar sein, so dass der Vertragspartner diese vor oder bei Vertragsschluss zur Kenntnis nehmen könnte.
Kann man AGB nachträglich ändern?
Eine nachträgliche Änderung von AGB ist gleichbedeutend mit einer nachträglichen Vertragsänderung. Eine solche ist grundsätzlich immer möglich, wenn der Vertrag noch nicht vollständig abgewickelt wurde und wenn beide Vertragsparteien mit der Änderung einverstanden sind.
In der Praxis stellt sich aber häufig das Problem, dass der AGB-Verwender eine einseitige Änderung der AGB herbeiführen möchte, die nicht ausschließlich vorteilhaft für den Vertragspartner ist und mit welcher der Vertragspartner daher nicht unbedingt einverstanden ist. In solchen Fällen muss danach differenziert werden, ob es sich um ein Vertragsverhältnis handelt, welches auf eine einmalige Leistungserbringung beschränkt ist oder um ein Dauerschuldverhältnis, bei dem die geschuldeten Leistungen dauerhaft zu erbringen sind.
1. Einseitige AGB-Änderung bei Vertragsverhältnissen mit einmaliger Leistungspflicht
Bei Vertragsverhältnissen, die auf eine einmalige Leistungserbringung beschränkt sind (z. B. Kaufvertrag mit einmaliger Liefer- und Zahlungspflicht), kann der Unternehmer seine AGB nicht einseitig zum Nachteil des Kunden ändern. Dies stünde dem Grundsatz „pacta sunt servanda“ entgegen und hätte eine massive Rechtsunsicherheit für solche Vertragsverhältnisse zur Folge.
Nicht umsonst sieht das Gesetz nur wenige und zudem stark regulierte Rechtsinstitute vor, die es dem Vertragspartner ermöglichen, sich einseitig von einem wirksam geschlossenen Vertrag zu lösen (z. B. Anfechtung oder Widerruf).
Allerdings kann der Unternehmer seine AGB in solchen Fällen für zukünftige Vertragsverhältnisse grundsätzlich unproblematisch ändern, da es sich jeweils um neue Vertragsgegenstände handelt und die Kunden grundsätzlich nicht darauf vertrauen können, dass die AGB des Unternehmers für alle Vertragsverhältnisse gleich sind.
Etwas anderes könnte aber dann gelten, wenn der Unternehmer seine AGB im Rahmen einer langjährigen Vertragspartnerschaft gegenüber ein und demselben Kunden nie geändert hat und dies unerwartet plötzlich doch macht. In diesem Fall könnte den Unternehmer insoweit zumindest dann eine Aufklärungspflicht treffen, wenn die AGB-Änderung unter Berücksichtigung der beiderseitigen Interessen wesentlich ist.
2. Einseitige AGB-Änderung bei Dauerschuldverhältnissen
Anders als bei Vertragsverhältnissen, die auf eine einmalige Leistungserbringung beschränkt sind, kann der Unternehmer bei Vertragsverhältnissen, die auf eine längere Dauer angelegt sind (z. B. Mobilfunk- oder Fitnessstudioverträge) durchaus ein berechtigtes Interesse daran haben, seine AGB nachträglich zu ändern, etwa weil sich die Umstände für sein Unternehmen im Lauf der Zeit so geändert haben, dass eine Vertragsfortsetzung zu den seinerzeit vereinbarten Konditionen für den Unternehmer wirtschaftlich nicht mehr vertretbar ist.
Allerdings muss dabei immer auch das Interesse des Vertragspartners berücksichtigt werden, der den Vertrag seinerzeit zu bestimmten Konditionen abgeschlossen hat und nicht mit einer einseitigen Änderung dieser Konditionen zu seinem Nachteil rechnen muss.
Bei der einseitigen AGB-Änderung im Rahmen von Dauerschuldverhältnissen muss daher nach dem Grund der Änderung differenziert werden. So kann es Gründe geben, die den Unternehmer zu einer Änderung seiner AGB auch ohne Zustimmung des Kunden berechtigen und es kann Gründe geben, bei der die Änderung nur mit Zustimmung des Kunden zulässig ist.
Welche Gründe berechtigen zu einer AGB-Änderung ohne Zustimmung des Kunden?
Der Unternehmer kann seine AGB im Rahmen eines Dauerschuldverhältnisses auch ohne Zustimmung des Kunden ändern,
- soweit er hierzu aufgrund einer Änderung der Rechtslage verpflichtet ist;
- soweit er damit einem gegen sich gerichteten Gerichtsurteil oder einer Behördenentscheidung nachkommt;
- soweit er zusätzliche, gänzlich neue Leistungen einführt, die das bisherige Vertragsverhältnis nicht zum Nachteil des Kunden verändern;
- wenn die Änderung lediglich vorteilhaft für den Kunden ist; oder
- wenn die Änderung rein technisch oder prozessual bedingt ist und keine wesentliche Auswirkungen für den Kunden hat.
Über wesentliche Änderungen der AGB muss der Unternehmer den Kunden rechtzeitig und in geeigneter Form informieren. Wesentlich sind solche Änderungen, die das Vertragsverhältnis erheblich zum Nachteil des Kunden verschieben würden oder dem Abschluss eines völlig neuen Vertrags gleichkämen. Hierzu zählen etwa Regelungen über Art und Umfang der Hauptleistung oder über Vertragslaufzeit und Kündigungsmodalitäten.
Wie kann die erforderliche Zustimmung des Kunden eingeholt werden?
Soweit eine Änderung der AGB nicht ohne Zustimmung des Kunden möglich ist, muss der Unternehmer hierfür eine Zustimmung des Kunden einholen.
1. Fiktion der Zustimmung (Widerspruchslösung)
Insoweit war es in der Vergangenheit in der Praxis üblich, die Zustimmung von Kunden zu Änderungen der AGB durch entsprechende Änderungsklauseln in AGB zu fingieren. Danach wurden dem Kunden beabsichtigte AGB-Änderungen eine angemessene Zeit (z. B. 2 Monate) vor dem Inkrafttreten der Änderungen angeboten. Die Zustimmung des Kunden galt als erteilt, wenn er den Änderungen trotz eines entsprechenden Hinweises durch den Unternehmer nicht bis zum Wirksamwerden der Änderungen widersprach. War der Kunde mit den vorgeschlagenen Änderungen nicht einverstanden, konnte er die vertragliche Beziehung durch Kündigung gegenüber dem Unternehmer beenden.
Dieser Vorgehensweise hat jedoch der BGH mit Urteil vom 27. April 2021 (Az. XI ZR 2620) einen Riegel vorgeschoben. Darin hat er entschieden, dass Klauseln in AGB, die eine Zustimmung des Kunden zu AGB-Änderungen fingieren, falls er nicht innerhalb einer bestimmten Frist widerspricht, unwirksam sein können. Dies gilt insbesondere, wenn die Änderungen die Grundlagen der rechtlichen Beziehungen der Parteien betreffen und zu einer Verschiebung des Äquivalenzverhältnisses von Leistung und Gegenleistung zugunsten des AGB-Verwenders führen können.
Die Entscheidung des BGH bezog sich lediglich auf Vertragsverhältnisse mit Verbrauchern (B2C). Ob dies auch für B2B-Verhältnisse gilt, ist bisher noch nicht abschließend geklärt. Die Argumente des BGH lassen sich aber auch auf B2B-Verhältnisse übertragen, so dass die Verwendung entsprechender Änderungsklauseln in AGB auch insoweit mit einem rechtlichen Risiko verbunden ist.
2. Aktive Einholung der Zustimmung
Da eine fingierte Zustimmung nach aktueller Rechtslage jedenfalls bei Vertragsverhältnissen mit Verbrauchern (B2C) nicht in Betracht kommt, muss die Zustimmung für relevante AGB-Änderungen aktiv vom Kunden eingeholt werden. Danach muss der Unternehmer den Kunden über die geplanten Änderungen in Kenntnis setzen und ihn zur Zustimmung auffordern. Dieser Prozess kann – je nach vertraglicher Ausgestaltung – sowohl analog als auch online durchgeführt werden. Verfügt der Kunde über ein digitales Nutzerkonto, kann der Zustimmungsprozess etwa über eine „Klickstrecke“ im Rahmen des Registrierungs- oder Login-Prozesses erfolgen.
Was gilt bei Verweigerung der Zustimmung?
Verweigert der Kunde seine Zustimmung zu den geplanten AGB-Änderungen, etwa indem er den Änderungen ausdrücklich widerspricht oder indem er die Aufforderung zur Zustimmung beharrlich ignoriert, steht es dem Unternehmer frei, den Vertrag nach Ablauf einer angemessenen Frist ordentlich zu kündigen, sofern kein Kontrahierungszwang besteht.
Ein Kontrahierungszwang besteht in der Regel in Sektoren der Daseinsvorsorge oder bei Monopolstrukturen, wie im Gesundheitswesen (Krankenkassenaufnahme, Basistarif der PKV) oder bei der Energieversorgung, wo die Leistung für den Bürger unverzichtbar ist.
Hat der Unternehmer in seinen AGB wirksame Regelungen zur ordentlichen Kündigung getroffen, so sind für Kündigungsfrist und Kündigungstermin diese Regelungen maßgeblich. Anderenfalls gelten insoweit die gesetzlichen Regelungen zur ordentlichen Kündigung von Dauerschuldverhältnissen.
Erfolgt weder eine Zustimmung des Kunden zu den geplanten AGB-Änderungen noch eine Kündigung des Unternehmers, besteht der Vertrag bis auf Weiteres zu den bisherigen Konditionen fort.
Fazit
Eine nachträgliche Änderung von AGB im Rahmen bestehender Vertragsverhältnisse kommt grundsätzlich nur bei Dauerschuldverhältnissen in Betracht.
Bei wesentlichen Änderungen, die Auswirkungen auf das Äquivalenzverhältnis von Leistung und Gegenleistung haben, muss der AGB-Verwender grundsätzlich die Zustimmung des Vertragspartners zur AGB-Änderung einholen.
Dabei kann die Zustimmung jedenfalls bei Vertragsverhältnissen mit Verbrauchern (B2C) nicht durch entsprechende Änderungsklauseln in AGB fingiert werden. Erforderlich ist insoweit vielmehr eine aktive Zustimmung des Vertragspartners.
Verweigert der Vertragspartner die Zustimmung, so kann der AGB-Verwender den Vertrag ordentlich kündigen, sofern kein Kontrahierungszwang besteht.
Fragen zum Beitrag? Diskutieren Sie hierzu gerne mit uns in der Unternehmergruppe der IT-Recht Kanzlei auf Facebook.
Link kopieren
Als PDF exportieren
Per E-Mail verschicken
Zum Facebook-Account der Kanzlei
Zum Instagram-Account der Kanzlei
Beiträge zum Thema







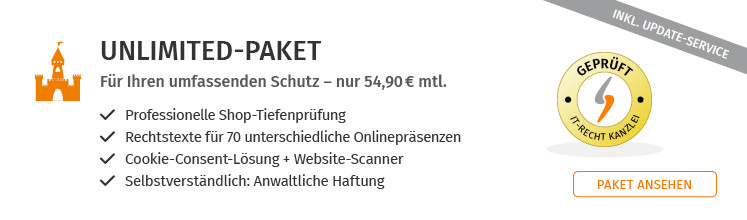

0 Kommentare