Google Webfonts: Abmahnwelle von RA Lenard aus Berlin + Muster

Seit das LG München I einem Seitenbesucher einen Schadensersatz von 100,00€ aufgrund Datenschutzverletzungen im Zusammenhang mit Google Webfonts zugesprochen hatte, sind Abmahnungen auf diesem Gebiet zum Massenphänomen geworden. Nun kursiert eine neue Welle von Schreiben.
Inhaltsverzeichnis
- Die datenschutzrechtliche Problematik der Google Webfonts
- Neue Forderungswelle: RA Lenard als Berlin fordert Schadensersatz von 170,00€
- Was ist von den neuen anwaltlichen Ersatzforderungen zu halten?
- Sollte den Forderungen stattgegeben werden?
- Muster-Verteidigungsschreiben für Mandanten
- Google Fonts: Datenschutzkonformität herstellen und rechtlichen Problemen vorbeugen
Die datenschutzrechtliche Problematik der Google Webfonts
Seit geraumer Zeit sind „Webfonts“ in aller Munde.
Bei diesen handelt es sich um online-basierten Services für das Laden von Schriftarten und Typographie-Elementen auf Websites.
Sind Webfonts (etwa solche von Google) auf einer Website eingebunden, wird bei Seitenaufruf eine Verbindung zum Google-Netzwerk aufgenommen wird, damit die verwendeten Schriftstile geladen werden können.
Durch diese Verbindungsaufnahme kommt es zur Übertragung von Nutzerinformationen, insbesondere der personenbezogenen IP-Adresse, an Google.
Diese Übertragung ist nun aus zweierlei Gründen problematisch.
Einerseits fehlt es an einer hinreichenden datenschutzrechtlichen Rechtfertigung für die Informationsübermittlung an Google. Insbesondere können sich Seitenbetreiber nicht auf berechtigte Interessen an der graphisch ansprechenden Seitengestaltung gemäß Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO stützen, weil hierfür die Übermittlung personenbezogener Daten an Google nicht zwingend erforderlich ist.
Andererseits werden Informationen, darunter auch die personenbezogene IP-Adresse, zumindest auch an Google-Server in den USA übertragen. Drittstaatentransfers sind aber datenschutzrechtlich nur nach den strengen Voraussetzungen der Art. 44 ff. DSGVO zulässig und aktuell für das Zielland USA allgemein nicht rechtskonform möglich, weil es wegen weiter Datenzugriffsbefugnisse der US-Geheimdienste an einem hinreichenden Schutzniveau für personenbezogene Daten fehlt.
Neue Forderungswelle: RA Lenard als Berlin fordert Schadensersatz von 170,00€
Nachdem bereits etliche Privatpersonen versuchten, unter Berufung auf das Urteil des Landgericht München I vom 20.01.2022 (Az. 3 O 17493/20) Seitenbetreiber wegen der Einbindung von Google Webfonts durch Ersatzforderungen unter dem Deckmantel einer Datenschutzverletzung bares Geld aus der Tasche zu locken, kursiert nun eine neue Welle von Ersatzforderungen.
Mit immer identischem Inhalt geht der Berliner Anwalt Kilian Lenard derzeit im Namen von Privatpersonen gegen Seitenbetreiber vor.
Diese Personen seien Mitglieder einer sog. „Interessengemeinschaft Datenschutz“ und bei einem willkürlichen Besuch auf betroffenen Websites an die Information gelangt, dass bestimmte personenbezogene Informationen (darunter die IP-Adresse) durch das Laden von Google Webfonts in unzulässiger Weise an Google übermittelt worden seien.
Mangels Rechtfertigungsgrundlage für diese Datenübermittlung habe der Seitenbetreiber eine Datenschutzverletzung begangen, die den Mandanten in seinem Recht auf informationelle Selbstbestimmung (§ 823 Abs. 1 BGB) beeinträchtige.
Dies rechtfertige einen Schadensersatz von 170,00€, bei dessen alsbaldiger Begleichung die Angelegenheit als erledigt betrachtet werden könne.
Was ist von den neuen anwaltlichen Ersatzforderungen zu halten?
Nach Ansicht der IT-Recht Kanzlei handelt es sich auch bei der neuen Forderungswelle um einen fragwürdigen, rechtlich durchaus verwerflichen Versuch, unter Berufung auf eine vermeintliche Datenschutzverletzung finanzielle Mittel bei den betroffenen Seitenbetreibern zu lockern und eine eigene finanzielle Bereicherung in nicht unerheblichem Umfang zu erzielen.
Neu ist in diesem Fall, dass sich mit RA Lenard ein deutscher Anwalt zum Schirmherrn der Welle aufschwingt, um den Forderungen – nun anwaltlich – Nachdruck zu verleihen und ihnen einen Charakter der Beachtungswürdigkeit und Bedrohlichkeit zu verleihen.
Sollte den Forderungen stattgegeben werden?
Nein, davon ist zwingend abzuraten.
Es ist nämlich anzunehmen, dass es RA Lenard und seiner Mandantschaft offensichtlich nicht um die Wahrung des Datenschutzes, sondern um die schnelle Beschaffung finanzieller Mittel unter anwaltlicher Drohgebärde geht.
Dies liegt bereits deswegen auf der Hand, weil neben dem Ersatzanspruch keine datenschutzrechtlichen Ansprüche, insbesondere kein Auskunftsanspruch, geltend gemacht werden.
Es ist daher mehr als naheliegend, dass mit den Schreiben datenschutzfremde, nämlich finanzielle Interessen verfolgt werden, die aufgrund der Menge und aufgrund des gezielten Aufsuchens einschlägiger Websites mit dem Motiv, sich sehenden Auges in die gerügte Datenschutzverletzung hineinzubegeben, um aus dieser sodann Ansprüche ableiten zu können, als rechtsmissbräuchlich angesehen werden können.
Hinzu kommt, dass für die Ersatzfähigkeit eines immateriellen Schadens nach der DSGVO nicht nur die Behauptung einer bloßen Datenschutzverletzung ausreicht. Vielmehr müsste gleichzeitig substantiiert dargelegt werden, dass diese Verletzung auch zu einer Beeinträchtigung von persönlichkeitsrechtlichen Belangen geführt hat, die über ein bloßes Gefühl des Unbehagens hinausgehen.
Dazu wird in den gegenständlichen Schreiben aber gerade nichts vorgetragen. Vielmehr nimmt RA Lenard aus Berlin fälschlicherweise an, allein der gerügte Datenschutzverstoß führe unmittelbar zu einem Anspruch auf Schadensersatz.
Ob dies unwissentlich oder absichtlich zum Zwecke der schnellen Forderungseintreibung erfolgt, sei dahingestellt.
Weil es sich bei der erneuten Forderungswelle aller Voraussicht nach um eine rechtsmissbräuchliche Geltendmachung von Ersatzansprüchen handelt, wären diese bereits unzulässig.
Immerhin sind die Forderungen materiell aber unbegründet, weil es an der Geltendmachung eines konkreten Schadens fehlt. Nur ein solcher kann nach Regeln der DSGVO auch mit einem Ersatz kompensiert werden.
Muster-Verteidigungsschreiben für Mandanten
Betroffene Seitenbetreiber, die Post von RA Lenard aus Berlin erhalten haben, sind also gut beraten, sich vom Schreiben nicht einschüchtern zu lassen und der geäußerten Forderung nicht einfach statt zu geben.
Vielmehr sollten sich Seitenbetreiber auf geeignete Weise verteidigen, RA Lenard auf die rechtliche Unzulänglichkeit seiner Forderung hinweisen und diese damit zu Fall bringen.
Weil es sich bei den derzeit kursierenden Schreiben um ein Massenphänomen handelt, ist davon auszugehen, dass RA Lenard bei Gegenwehr die Sache im Konkreten wegen naheliegender Aussichtslosigkeit nicht weiterverfolgen wird. Vielmehr soll bereits das erste Forderungsschreiben als Drohgebärde zur nicht hinterfragten Zahlung führen.
Für die Verteidigung können Mandanten Folgendes Musterschreiben verwenden:
Exklusiv-Inhalt für Mandanten
Noch kein Mandant?
-
WissensvorsprungZugriff auf exklusive Beiträge, Muster und Leitfäden
-
Schutz vor AbmahnungenProfessionelle Rechtstexte – ständig aktualisiert
-
Monatlich kündbarSchutzpakete mit flexibler Laufzeit
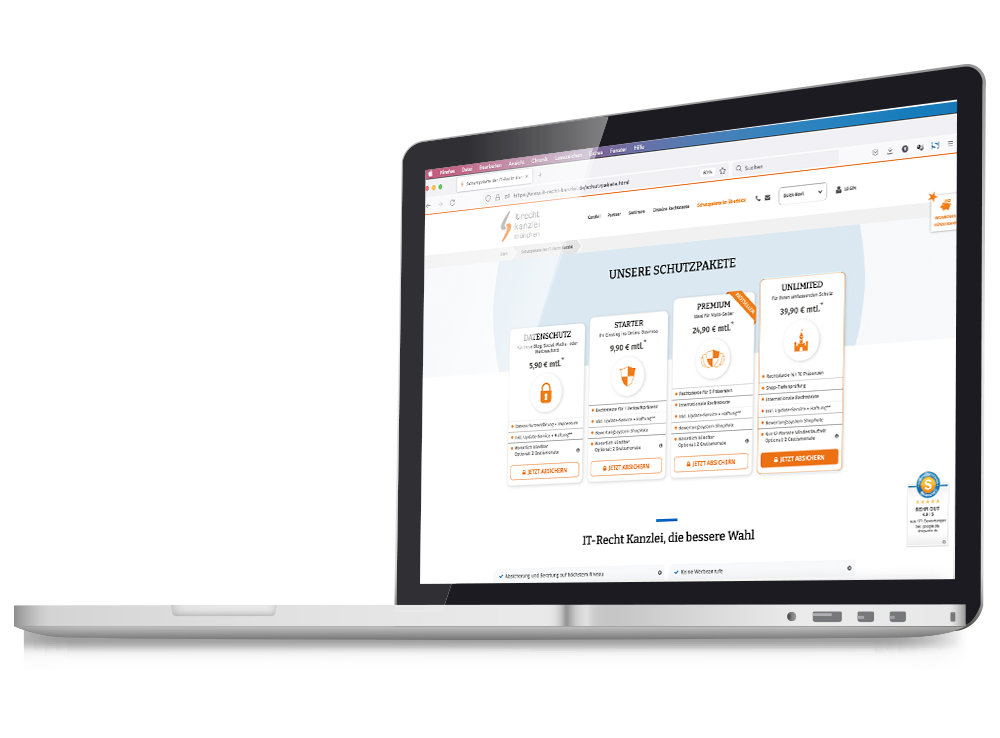
Google Fonts: Datenschutzkonformität herstellen und rechtlichen Problemen vorbeugen
Die Crux bei der Verwendung von Webfonts ist, dass Schriftarten und Typo-Stile dadurch geladen werden, dass der Browser des Seitenbesuchers eine Verbindung zu den Servern des Font-Anbieters aufnimmt. Durch diese Verbindungsaufnahme werden regelmäßig diverse Nutzerinformationen an Server des Anbieters übertragen. Enthalten diese Informationen auch personenbezogene Daten wie die IP-Adresse des Nutzers, drohen Verstöße gegen die DSGVO.
Um dies zu umgehen, ist zwingend zu empfehlen, Fonts, insbesondere solche von Google, ausschließlich lokal einzubinden und vom eigenen Server (nicht vom Server des Anbieters) laden zu lassen.
So kommt es nämlich zu keiner Erhebung und Übermittlung von personenbezogenen Daten durch/an Google, weil die Fonts nicht durch eine Verbindungsaufnahme zu Google Servern erst geladen werden müssen.
Fragen zum Beitrag? Diskutieren Sie hierzu gerne mit uns in der Unternehmergruppe der IT-Recht Kanzlei auf Facebook.
Link kopieren
Als PDF exportieren
Per E-Mail verschicken
Zum Facebook-Account der Kanzlei
Zum Instagram-Account der Kanzlei

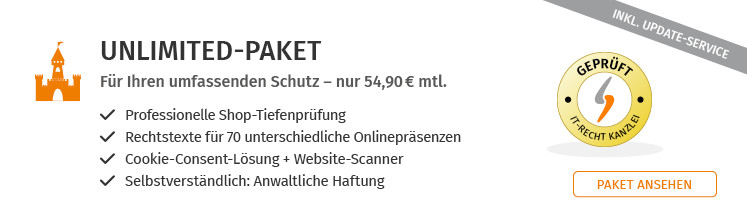

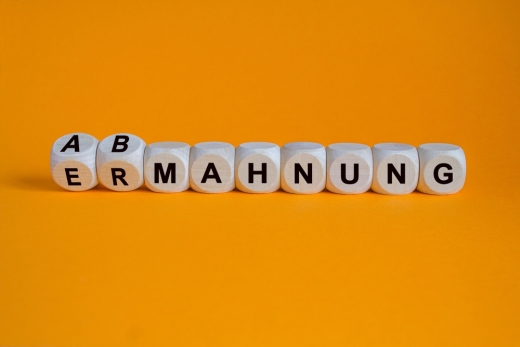


17 Kommentare
Ich gehe davon aus trotzdem nicht zu zahlen.
Oh mann!
Grüße Katriny☆
Ich wäre sehr dafür, gemeinsam dagegen vorzugehen, wenn es Aussicht auf Erfolg gibt.
Bei tausenden dieser "Abmahnungen" ist der Gesamtschaden immens.
Denn jeder von uns muss sich damit befassen, die Rechtslage recherchieren, reagieren mit einem Widerspruchsschreiben, usw.
Kostbare Arbeitszeit, warum eigentlich sollte der Rechtsmissbraucher dafür nicht aufkommen müssen?
Denn dieser Schaden ist nicht imaginär wie bei Herrn Ismail, sondern real.
Und wie ist es mit Schmerzensgeld für den Schock und Stress, den das Ganze bei den meisten auslöst?
Die Masche erinnert mich an die Schockanrufe, mit denen meist alte Leute überrumpelt werden, um an ihr Geld zu kommen.
Nur dass es hier ein kleinerer Betrag ist und mittels Serienbrief passiert.
Es wäre aus meiner Sicht wünschenswert, wenn dieser Beispielfall zu einem Musterurteil führt, dass Nachahmungstäter abschreckt.
Kanzlei IT-Recht, was sagen Sie dazu?
Ich habe leider der Forderung stattgegeben, mit dem Hinweis keiner Anerkennung einer Rechtspflicht und Zahlung unter Vorbehalt der Rückforderung nach rechtlicher Prüfung.
Die lokale Einbindung der Fonts bereite ich gerade vor.
Wie sollte ich hinsichtlich dem RA bzw. der Rückforderung vorgehen?
Ganz miese Masche Herr Anwalt, aber warum die Berufsaufsicht der Rechtsanwaltskammer sich dieses Schauspiel anschaut erschließt sich mir leider auch nicht?
Macht sich hier dann also nicht eigentlich Etsy (Pattern) mit dem Thema Google Fonts strafbar, da es der User ja gar nicht selber in der Hand hat? Und wie sollten sich Pattern-Shop User verhalten?
Ich denke aber das ist abzocke…. Weiß ich nicht was soll ich tun, schicke ich aber weiter für mein Rechtsanwalt.
Es liegt sehr nahe, dass hier gar kein Mensch unterwegs ist, sondern sogenannte Crawler das Internet nach Verstößen durchforsten. Zumindest in diesem Falle gilt: einem Crawler kann man keine Persönlichkeitsrechte verletzen, die Abmahnung ist nach meiner Auffassung rechtsmissbräuchlich.
muss ich überhaupt bei Post vom Anwalt reagieren? Ich mein, es ist Aufwand. Schreiben kann mir erstmal jeder Mensch auf dieser Welt.
Ich habe keine Google Fonts eingebunden. Dennoch Post erhalten. Sehr unseriöse Geschäftspraktiken.
Kann ich mein Antwortschreiben in Rechnung stellen?
Wie sieht es mit einer Gegenklage / Feststellungsklage aus? Sinnvoll?
Es ärgert mich, mit was man sich alles rumschlagen muss.
Viele Grüße
Jonas
Denn meine Domain die Abgemahnt wird, hat 0 Inhalt, es ist eine reine Weiterleitung auf eine andere Domain, die nicht zu mir gehört aber dennoch bekomme ich Abmahnung mit Inhalt der fremden Domain.
Wo hat der meine Daten her? DENIC? darf die das rausgeben? denn an vorhandene Impressum Daten hat er sich ja nicht gemeldet.
Wäre doch auch verstoß der DENIC.
Wie geht es denn nun weiter? Ich habe schon einmal eine Frist verpasst und das ist richtig teuer geworden. Was passiert, wenn ich nichts mehr höre aus Berlin? Muss ich die angeforderte Stellungnahme des Berliner Anwaltes einfordern/anmahnen?
Vielen Dank für eine kurze Antwort und beste Grüße aus Stuttgart
Muss man antworten und dafür noch Zeit und Geld verschwenden, wenn das so offensichtlich ist. Für mich ist das rechtswidrig