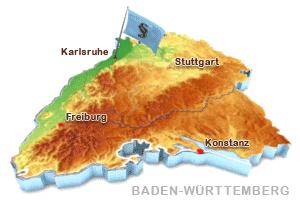
„Anno dazumal: Ein Schuh namens Gaby im Warenzeichengesetz“
Urteil vom BGH
Entscheidungsdatum: 26.11.1987
Aktenzeichen: I ZR 123/85
Leitsätze
1. Bewirbt ein Kaufhausunternehmen einen Damenschuh mittels eines gebräuchlichen, weiblichen Vornamens, ist darin eine zeichenmäßige Benutzung zu sehen; dies gilt auch dann, wenn der Markenname keine besondere Eigenart aufweist.
2. Ausschlaggebend bei der Verwendung eines fremden Zeichens ist, wie sich diese Darstellung beim Verkehr wiederspiegelt.
3. Die Bezeichnung mit einem Frauennamen dient hier nicht als Herkunftshinweis, sondern vielmehr der Verkaufsförderung; ein spezielles Publikum soll durch den Vornamen angesprochen werden.
Tatbestand
Die Klägerin ist Inhaberin des seit dem 1. Juni 1962 für Schuhwaren eingetragenen Warenzeichens Nr. 762025 "Gaby".
Die Beklagte, ein Kaufhausunternehmen, warb in der "H." Nr. 32/1982 für eine Damen-Stiefelette "Gabi" im "Goldenen K. Angebot". Außer diesem Schuh wurden in der Werbeanzeige auch drei weitere Damen-Stiefeletten jeweils unter den Bezeichnungen "Helen", "Katrin" und "Ina" angeboten. Die Beklagte hatte außerdem in der "H." vom 15. August 1981 für einen Sport- und College-Schuh "Gaby" und in der "B." Nr. 8/1981 vom 16.2.1981 für eine Damen-Sandalette "Gaby" geworben. Auch diese beiden Inserate erschienen mit dem hervorgehobenen Text "Das goldene K. Angebot". Sie zeigten ebenfalls jeweils drei weitere Schuhmodelle, die mit weiblichen Vornamen bezeichnet waren, und zwar den Namen "Elfie", "Anne" und "Sophia" (15.8.1981) und "Rosy", "Jenny" und "Elly" (16.2.1981).
Die Klägerin, die in den Anzeigen eine zeichenmäßige Benutzung ihrer Marke "Gaby" und damit deren Verletzung sieht, hat - nach Abgabe einer strafbewehrten Unterlassungsverpflichtungserklärung der Beklagten am 2. September 1982 - einen Schadensersatzanspruch geltend gemacht, hinsichtlich dessen das Verfahren in der Berufungsinstanz zum Ruhen gebracht worden ist. Außerdem hat sie einen Auskunftsantrag gestellt, dem sie im Berufungsrechtszug in Abänderung seiner ursprünglichen Formulierung folgende Fassung gegeben hat:
Die Beklagte wird verurteilt, der Klägerin seit 15. Juni 1962 darüber Auskunft zu erteilen,
in welchem Umfang sie sich der Bezeichnung "Gaby" oder "Gabi" zur Bezeichnung von Schuhmodellen in Werbeanzeigen nach Art der Anzeigen gemäß K 2 und B 1 bedient hat, und zwar unter Angabe der Stückzahlen, Umsatzerlöse und Gestehungskosten der jeweils nach Erscheinen der betreffenden Werbemittel verkauften Schuhe sowie des Umfanges der betriebenen Werbung unter Angabe der Werbungsträger, Erscheinungszeiten, Verbreitungsgebiete, Auflagenhöhen und Werbungskosten und unter Vorlage eines Belegexemplars oder einer Kopie der Werbemittel, soweit sich diese noch im Besitz der Beklagten befinden.
Die Beklagte, die in beiden Instanzen Abweisung des Auskunftsantrags beantragt hat, ist vom Landgericht im wesentlichen entsprechend dem ursprünglichen Auskunftsantrag verurteilt worden. Auf ihre Berufung und unter Teilberücksichtigung der Umformulierung des Antrags der Klägerin hat das Berufungsgericht die Auskunftsverurteilung wie folgt eingeschränkt:
Die Beklagte wird verurteilt, der Klägerin für den Zeitraum vom 15. Juni 1962 bis zum 2. September 1982 darüber Auskunft zu erteilen, in welchem Umfang sie sich der Bezeichnung "Gaby" oder "Gabi" zur Bezeichnung von Schuhmodellen in Werbeanzeigen gemäß den diesem Urteil beigefügten Anlagen bedient hat, und zwar unter Angabe der Stückzahlen, Umsatzerlöse und Gestehungskosten der in einem Zeitraum bis zu jeweils 4 Wochen nach Erscheinen der betreffenden Werbemittel verkauften Schuhe sowie des Umfangs der betriebenen Werbung unter Angabe der Werbungsträger, Erscheinungszeiten, Verbreitungsgebiete, Auflagenhöhen und Werbungskosten.
Hiergegen richtet sich die Revision der Beklagten, die ihren Antrag auf Abweisung der Auskunftsklage weiterverfolgt. Die Klägerin beantragt die Zurückweisung der Revision.
Gründe
I. Das Berufungsgericht hat den Teil des Antrags, der sich auf Auskunft über den Umfang der Werbung der Beklagten "nach Art der Anzeigen gemäß K 2 und B 1" bezieht, als nicht hinreichend bestimmt i.S. des § 253 Abs. 2 Nr. 2 ZPO angesehen, jedoch einen Auskunftsanspruch der Klägerin in dem in der Urteilsformel zum Ausdruck gebrachten Umfang für begründet erachtet.
Zur Begründung hat es ausgeführt, daß der Klägerin ein Schadensersatzanspruch gemäß §§ 24, 25, 31 WZG zustehe; denn die Beklagte habe durch zeichenmäßige Benutzung der Bezeichnungen "Gabi" bzw. "Gaby" in den Anzeigen die Rechte der Klägerin an deren (unstreitig benutztem) Zeichen "Gaby" verletzt. Der Verkehr, auf dessen Sicht es ankomme, werde bei Verwendung einer Marke in einer Werbeanzeige jedenfalls zu einem nicht ganz unerheblichen Teil eine zeichenmäßige Benutzung sehen, selbst wenn - wie vorliegend - die Marke aus einem häufig vorkommenden Vornamen ohne besondere Eigenart bestehe und vom Benutzer selbst lediglich als Bestellzeichen gedacht sei.
Warenzeichenrechts der Klägerin für sie bei Anwendung der erforderlichen Sorgfalt erkennbar gewesen sei.
Bestehe somit ein Schadensersatzanspruch, so habe die Klägerin nach Treu und Glauben einen Anspruch auf eine Auskunft, die es ihr ermögliche, den Schadensersatz zu bemessen.
II. Diese Beurteilung hält der revisionsrechtlichen Nachprüfung nicht stand.
1. Das Berufungsgericht ist rechtsfehlerfrei davon ausgegangen, daß ein Auskunftsanspruch der Klägerin besteht, wenn und soweit ihr ein Schadensersatzanspruch gegen die Beklagte zusteht und die begehrte Auskunft für die Schadensberechnung erforderlich und der Beklagten zumutbar ist (RGZ 158, 377, 379; BGHZ 10, 385, 387; st. Rspr. und inzwischen Gewohnheitsrecht, vgl. BGH, Urt. v. 7.12.1979 - I ZR 157/77, GRUR 1980, 227, 232 - Monumenta Germaniae Historica).
Einen Schadensersatzanspruch der Klägerin hat das Berufungsgericht nach §§ 24, 25 und 31 WZG deshalb als gegeben erachtet, weil die Beklagte in den in Frage stehenden Werbeanzeigen die Bezeichnung "Gabi" bzw. "Gaby" warenzeichenmäßig benutzt und damit - schuldhaft - das Warenzeichen "Gaby" der Klägerin verletzt habe. Dies wird von der Revision mit Erfolg angegriffen.
a) Das Berufungsgericht hat ohne Rechtsverstoß angenommen, daß es für die Frage der zeichenmäßigen Benutzung eines sog. Bestellzeichens nicht auf dessen Zweckbestimmung durch den Verwender, sondern allein darauf ankommt, ob der angesprochene Verkehr das Zeichen auch als Hinweis auf die Herkunft der Ware aus einem bestimmten Betrieb versteht (BGH, Urt. v. 19.12.1960 - I ZR 39/59, GRUR 1961, 280, 281 - Tosca). Ob dies der Fall ist, kann - wie der Senat in der genannten Entscheidung ebenfalls ausgeführt hat - nur unter sorgfältiger Berücksichtigung der Verhältnisse des Einzelfalls beurteilt werden. Bei deren Würdigung hat das Berufungsgericht zwar rechtsfehlerfrei berücksichtigt, daß die Beklagte im vorliegenden Fall ein Warenzeichen der Klägerin in einer Werbeanzeige verwendet hat und daß bei einer solchen Verwendungsweise die Annahme einer (zumindest auch) zeichenmäßigen Verwendung der fremden Kennzeichnung für den Verkehr naheliegt und im Zweifel zugrundezulegen ist (vgl. BGH aaO - Tosca; ferner BGH, Urt. v. 26.2.1971 - I ZR 67/69, GRUR 1971, 251, 252 = WRP 1971, 312 - Oldtimer). Es hat jedoch nicht hinreichend beachtet, daß es auch bei der Verwendung eines fremden Warenzeichens in einer Anzeige entscheidend darauf ankommt, wie - und als was - sich dieses Zeichen seiner Art und seinem Sinngehalt nach dem Verkehr darstellt.
Zwar hat das Berufungsgericht nicht verkannt, daß das Zeichen hier lediglich aus einem weiblichen Vornamen besteht, der wegen seines häufigen Vorkommens jeder besonderen Eigenart entbehrt. Es hat diesem Umstand jedoch nicht die ihm zukommende Bedeutung beigemessen.
b) Der Bundesgerichtshof hat schon in seiner Entscheidung vom 19. Dezember 1960 (aaO - Tosca) maßgeblich darauf abgestellt, daß es sich bei dem dort in Frage stehenden Zeichen "Tosca" um einen aus einem fremden Sprachgebiet stammenden, im Bereich der Bundesrepublik Deutschland ungebräuchlichen Namen handelte, den der Durchschnittsleser nicht notwendig als weiblichen Vornamen, sondern möglicherweise als reines Phantasiewort oder auch, wenn er sich an die Gestalt der Tosca in der gleichnamigen Oper von Puccini erinnert, als Familiennamen auffassen wird. Ob mit der in Fällen dieser Art nicht unzweideutig auszuschließenden Möglichkeit des Verständnisses der Bezeichnung als Herkunftshinweis auch dann ernstlich zu rechnen ist, wenn es sich - wie vorliegend vom Berufungsgericht beanstandungsfrei festgestellt - um eine Kennzeichnung mit einem weiblichen Vornamen handelt, der wegen seines häufigen Vorkommens jeder besonderen Eigenart entbehrt, hat der Senat in seiner damaligen Entscheidung zwar offen gelassen, aber in Frage gestellt. Diesen Bedenken sucht das Berufungsgericht mit der Erwägung gerecht zu werden, daß die Annahme einer zeichenmäßigen Verwendung vorliegend trotz der Gebräuchlichkeit des Vornamens deswegen naheliege, weil die Beklagte in ihren Anzeigen lediglich je vier Kennzeichnungen verwendet habe, während in dem vom Bundesgerichtshof entschiedenen Fall der Name "Tosca" eine von rund 200 Kennzeichnungen im Katalog gewesen sei. Bei dieser Erwägung hat das Berufungsgericht jedoch nicht hinreichend berücksichtigt, daß es sich bei den in den Anzeigen der Beklagten verwendeten Bezeichnungen ausschließlich um weibliche Vornamen handelt, die allesamt gebräuchlich sind, und daß deshalb keine der Bezeichnungen eine besondere Eigenart aufweist und deshalb ihrerseits auf einen zeichenmäßigen Gebrauch hindeuten könnte. Hierzu hätte das Berufungsgericht weiter prüfen müssen, ob - ähnlich wie in der Textilbranche (vgl. dazu BGH, Urt. v. 20.3.1970 - I ZR 7/69, GRUR 1970, 552, 553 - Felina-Britta) - auch bei Damenschuhen die dem Verbraucher geläufige Übung besteht, Vornamen in Katalogen, Preislisten und Dekorationen als bloße Artikelbezeichnung zu verwenden, und ob dadurch die Annahme einer zeichenmäßigen Benutzung solcher bloßen Modellbezeichnungen als betrieblicher Herkunftshinweis ausgeschlossen erscheint.
Das Berufungsgericht hat dabei ferner nicht hinreichend berücksichtigt, daß die Anführung der fraglichen Mädchenvornamen durch deren derzeit und in der jüngeren Vergangenheit häufige Verwendung als Vornamen objektiv geeignet sein kann, dem Leser der Anzeige in erster Linie den Eindruck zu vermitteln, hier sollten jugendlich bzw. modisch "flotte" Modelle als solche werbend gekennzeichnet werden, was ebenfalls die Annahme einer betrieblichen Herkunftsfunktion als fernliegend erscheinen lassen könnte.
Bei hinreichender Berücksichtigung dieser besonderen Umstände des Falles durfte das Berufungsgericht die Feststellung, daß dennoch ein beachtlicher Teil des Verkehrs die Bezeichnung der einzelnen Schuhmodelle mit den Namen "Gaby" oder "Gabi" als Herkunftshinweis verstehen werde, jedenfalls nicht treffen, ohne die von der Beklagten für das Gegenteil angebotenen Beweise zu erheben oder in anderer Weise geeignete zusätzliche Feststellungen zu treffen.
2. Das Berufungsurteil kann daher keinen Bestand haben. Die Zurückverweisung der Sache an das Berufungsgericht ist jedoch nicht in vollem Umfang erforderlich, da der Rechtsstreit teilweise bereits entscheidungsreif ist. Die Klage ist insoweit abzuweisen, als sie auf Auskunftserteilung auch für die Zeit vom 15. Juni 1962 bis zum 15. Februar 1981 gerichtet ist, da es insoweit an einer Rechtsgrundlage für einen Auskunftsanspruch der Klägerin fehlt.
Als Hilfsanspruch zum Schadensersatzanspruch (vgl. BGH, Urt. v. 14.1.1977 - I ZR 170/75, GRUR 1977, 491, 494 = WRP 1977, 264 - Allstar) setzt der Auskunftsanspruch voraus, daß ein Schadensersatzanspruch dem Grunde nach besteht. Wird ein entsprechender Schadensersatzanspruch - wie vorliegend -aus einer Kennzeichnungsverletzung hergeleitet, so kann er frühestens mit deren Begehung entstehen. Ob und wann eine Verletzungshandlung begangen worden ist, hat - als klagebegründende Tatsache - der Gläubiger im Prozeß vorzutragen. Im vorliegenden Fall ist nach den Feststellungen des Berufungsgerichts als - zeitlich - erster von drei Verletzungsakten die Veröffentlichung der Anzeige in Heft 8/1981 der Zeitschrift "B." von der Klägerin vorgetragen worden, die - wie sich aus dem Schreiben des Klägervertreters vom 17.5.1983 (Anlage K 7 GA) ergibt, dem der Beklagtenvertreter mit Schreiben vom 24.5.1983 (Anlage K 8GA) insoweit nicht widersprochen hat - unter dem Datum vom 16.2.1981 erfolgt ist. Eine frühere Verletzungshandlung wird von der Klägerin nicht konkret behauptet und unter Beweis gestellt. Damit sind die Voraussetzungen eines Schadensersatzanspruchs für den Zeitraum vor dem 16.2.1981 nicht dargetan.
III. Das vom Berufungsgericht erlassene Teilurteil ist daher aufzuheben. Auf die Berufung der Beklagten ist das landgerichtliche Urteil teilweise abzuändern und die Klage insoweit als unbegründet abzuweisen, als sie auf Auskunftserteilung auch für die Zeit vom 15. Juni 1962 bis zum 15. Februar 1981 gerichtet ist. Im übrigen ist der Rechtsstreit zur erneuten Verhandlung und Entscheidung - auch über die Kosten des Revisionsverfahrens - an das Berufungsgericht zurückverwiesen.
Aktuelle IT-Urteile
-

LG Köln 31. Zivilkammer: „gelenkig?“ – widerrechtliche Wirkversprechen für Lebensmittel
Entscheidungsdatum: d.m.Y, H:i, AZ: 31 O 119/10 -
LG Rostock: „Stärkungsmittel“ – unlautere Werbung mit gesundheitsbezogenen Angaben
Entscheidungsdatum: d.m.Y, H:i, AZ: 5 HK O 18/11 -
OLG Rostock 2. Zivilsenat: „Schönheit kommt von innen!?“ – nährwertbezogene Angaben & das UWG
Entscheidungsdatum: d.m.Y, H:i, AZ: 2 U 2/11 -

OLG Frankfurt: „Akku-Schrauber“ – irreführende geografische Herkunftsangaben
Entscheidungsdatum: d.m.Y, H:i, AZ: 6 U 41/10 -
LG Darmstadt: „Bist Du reif für die Abnahme?“ – Sonderpreisklausel als Allgemeine Geschäftsbedingung
Entscheidungsdatum: d.m.Y, H:i, AZ: 25 S 162/10 -
KG Berlin: „Stummfilmkino“ – markenrechtliche Kurzbezeichnung der Örtlichkeit
Entscheidungsdatum: d.m.Y, H:i, AZ: 5 W 71/11 -

KG Berlin: „Mitbringsel“ – Werbung per Mail & das Wettbewerbsrecht
Entscheidungsdatum: d.m.Y, H:i, AZ: 5 W 59/11 -
BGH: „fliegender Teppich?“ – wettbewerbswidrige Werbung mit sog. Einführungspreisen
Entscheidungsdatum: d.m.Y, H:i, AZ: I ZR 81/09 -
OLG Hamm 4. Zivilsenat: „Scha la li“ – Anbieterkennzeichnung & Widerrufsrecht beim Onlinegeschäft
Entscheidungsdatum: d.m.Y, H:i, AZ: 4 U 204/10 -

LG Berlin: „Sternentaufe“ – Wettbewerbsverstöße durch Erhebung personenbezogener Daten
Entscheidungsdatum: d.m.Y, H:i, AZ: 91 O 25/11 -
OLG Düsseldorf: „Kauf per Klick“ – Negativer Käuferbewertung & ihre Folgen
Entscheidungsdatum: d.m.Y, H:i, AZ: 15 W 14/11 -
BPatG München: „Well & Slim oder Wellslim“? – identische Bezeichnungen & ihre markenrechtlichen Folgen
Entscheidungsdatum: d.m.Y, H:i, AZ: 25 W (pat) 50/10 -

LG Göttingen: „Grillunfall?“ – Ethanol-Kamin & die Produkthaftung
Entscheidungsdatum: d.m.Y, H:i, AZ: 2 O 218/09 -
OLG Köln 6. Zivilsenat: „Testsieger“ – Produktvergleich aus Verbrauchersicht
Entscheidungsdatum: d.m.Y, H:i, AZ: 6 U 159/10 -
Brandenburgisches Oberlandesgericht: „Preise & Zahlungsbedingungen“ – beliebige Rücksendekosten & das UWG
Entscheidungsdatum: d.m.Y, H:i, AZ: 6 U 80/10 -

LG Berlin: „Sternchen-Frage“ – unlauteres Serviceentgelt & die Preisangabenverordnung
Entscheidungsdatum: d.m.Y, H:i, AZ: 15 O 276/10 -
BPatG: „DJ Führerschein“ – markenrechtliche Unterscheidungskraft
Entscheidungsdatum: d.m.Y, H:i, AZ: 27 W (pat) 48/10 -
OLG Hamm: „Kontaktdaten“ – wettbewerbswidrige formularmäßige Einwilligung
Entscheidungsdatum: d.m.Y, H:i, AZ: 4 U 174/10 -

KG Berlin: „Polarweiß“ – unlautere Werbung mit Testergebnissen
Entscheidungsdatum: d.m.Y, H:i, AZ: 5 W 17/11 -
LG Nürnberg-Fürth 4. Kammer für Handelssachen: „mein picture?“ – Urheberrechte an Lichtbildern
Entscheidungsdatum: d.m.Y, H:i, AZ: 4 HK O 9301/10
